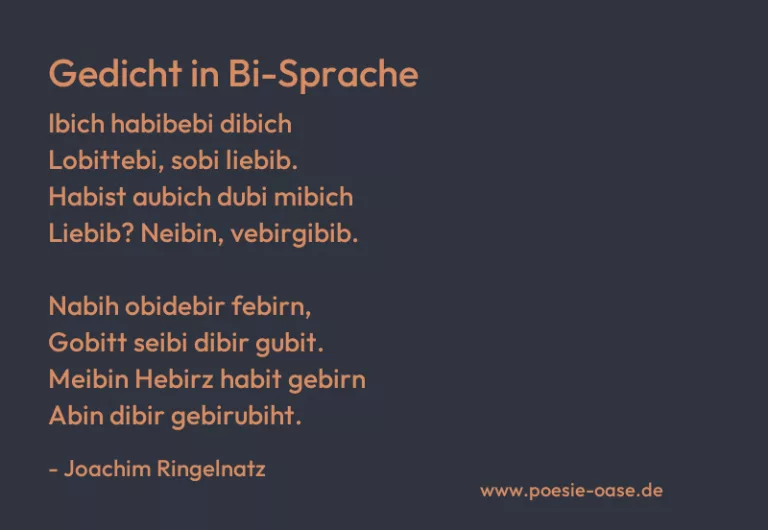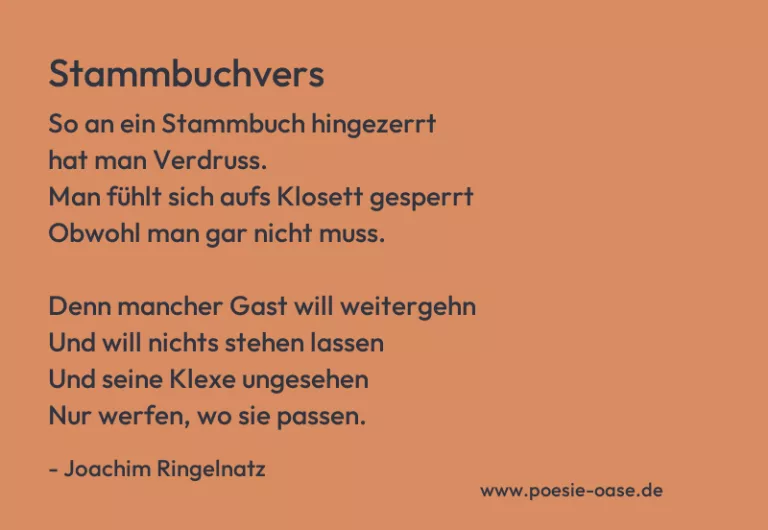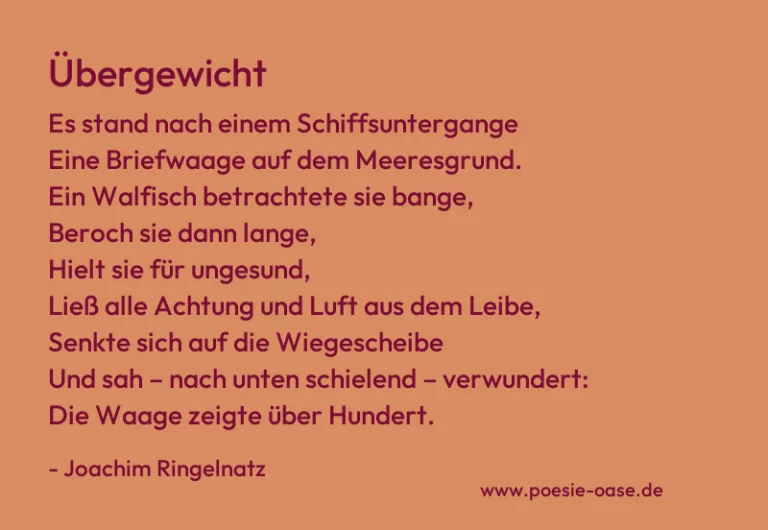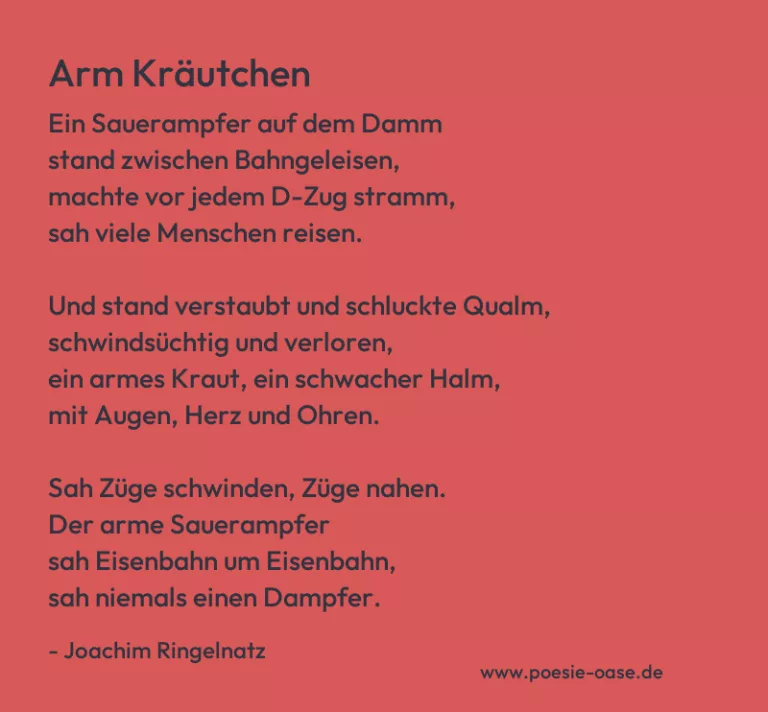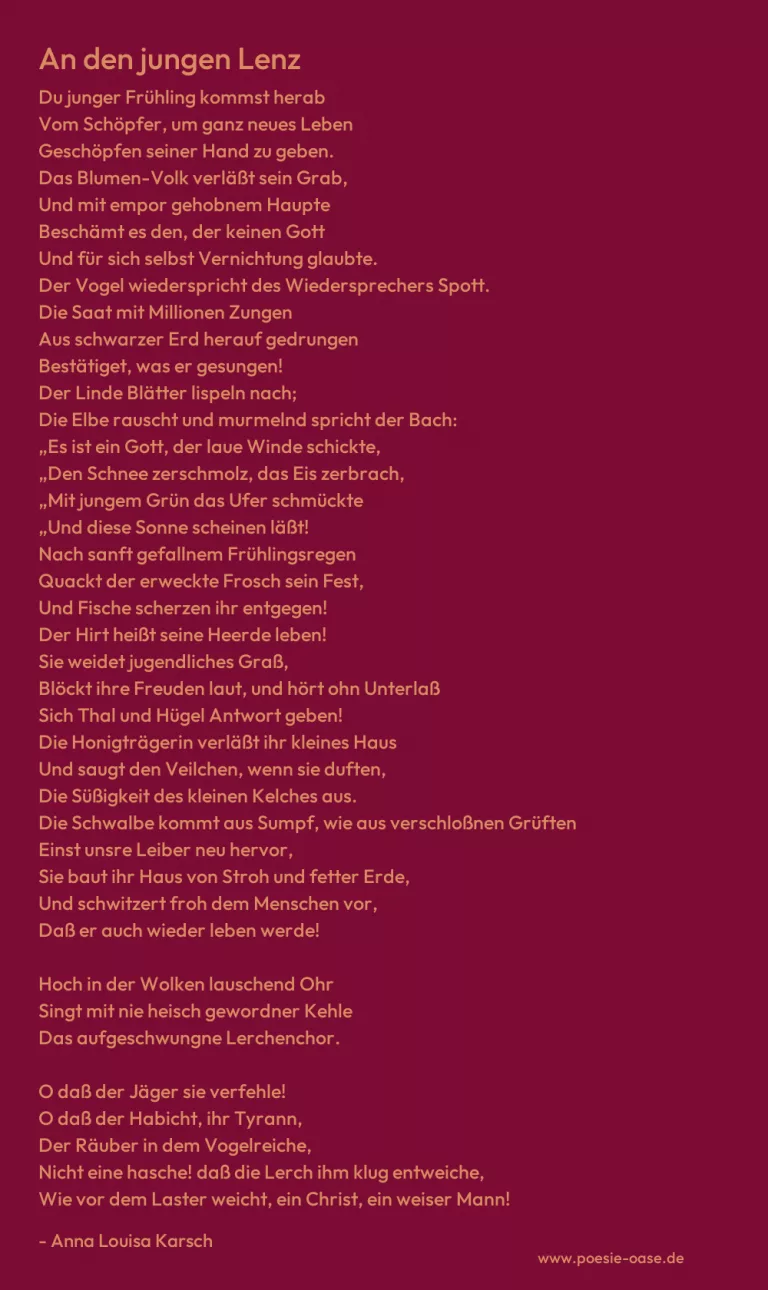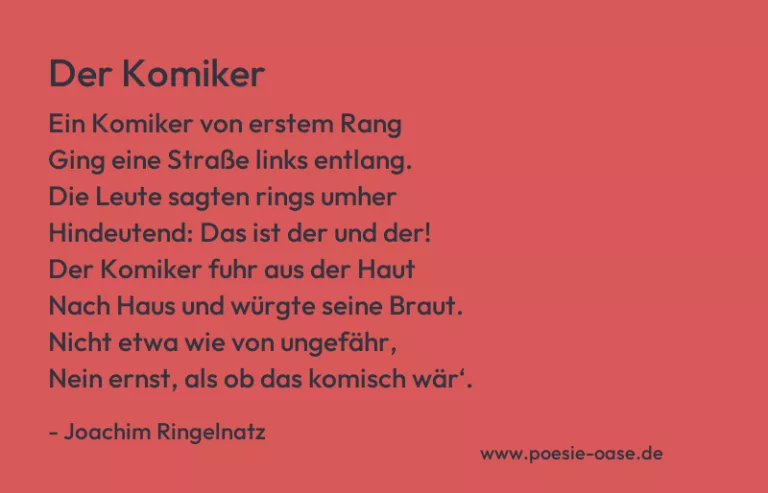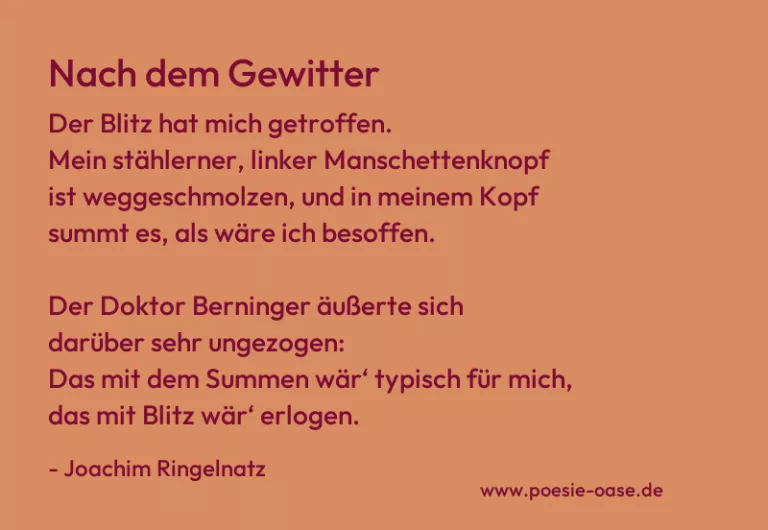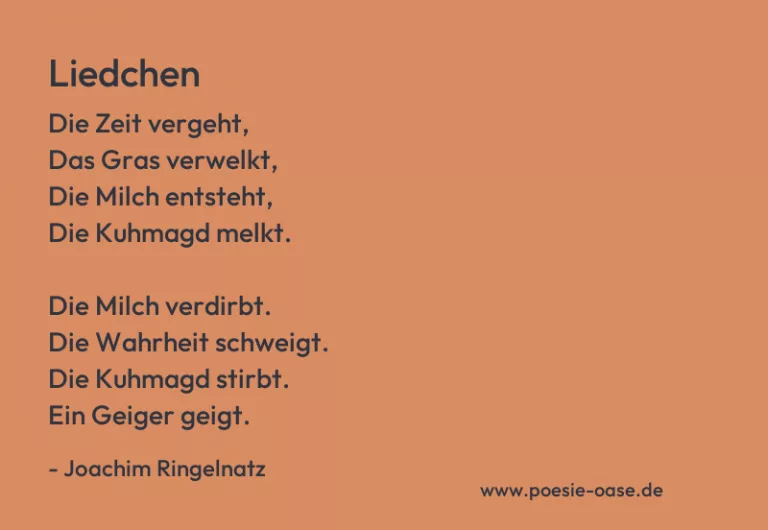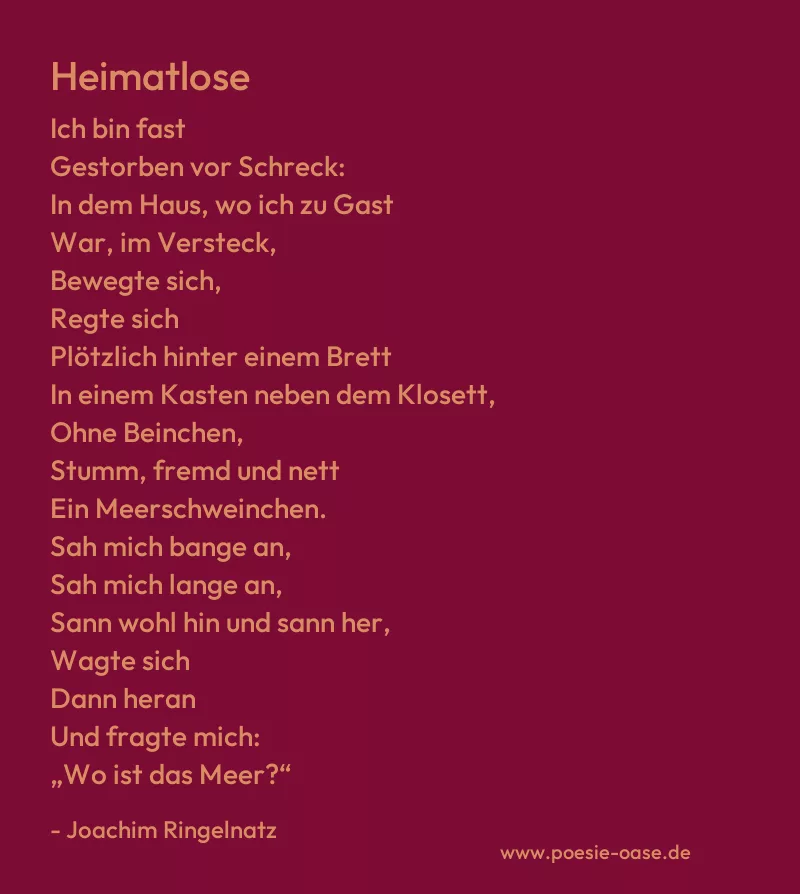Heimatlose
Ich bin fast
Gestorben vor Schreck:
In dem Haus, wo ich zu Gast
War, im Versteck,
Bewegte sich,
Regte sich
Plötzlich hinter einem Brett
In einem Kasten neben dem Klosett,
Ohne Beinchen,
Stumm, fremd und nett
Ein Meerschweinchen.
Sah mich bange an,
Sah mich lange an,
Sann wohl hin und sann her,
Wagte sich
Dann heran
Und fragte mich:
„Wo ist das Meer?“
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
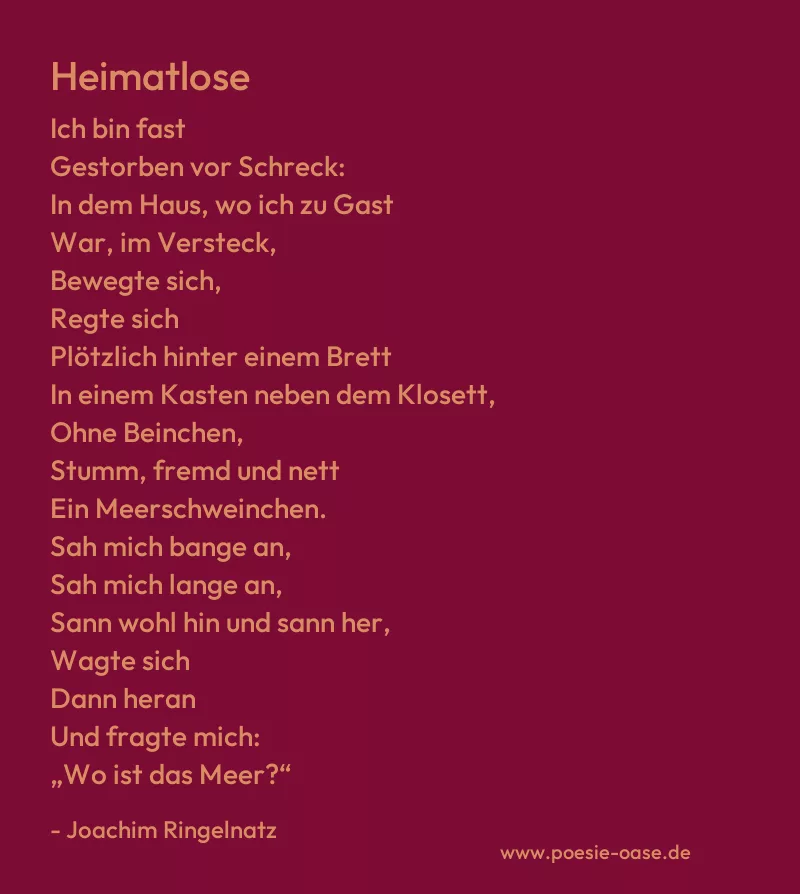
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Heimatlose“ von Joachim Ringelnatz erzählt in einer Mischung aus Komik und Melancholie die Begegnung des lyrischen Ichs mit einem Meerschweinchen an einem ungewöhnlichen Ort. Die überraschende Entdeckung des kleinen Tieres in einem Versteck neben dem Klosett löst zunächst einen Moment des Schrecks aus, der sich schnell in Neugier und leise Rührung verwandelt.
Das Meerschweinchen wird liebevoll beschrieben: stumm, fremd, aber „nett“, es wirkt verloren und ängstlich. Seine vorsichtige Annäherung und das lange, bange Anschauen verdeutlichen seine Unsicherheit und seine tiefe Sehnsucht nach Orientierung oder Trost. Das Tier erscheint fast menschlich in seiner zaghaften Kontaktaufnahme.
Der Höhepunkt des Gedichts ist die überraschende Frage des Meerschweinchens: „Wo ist das Meer?“ Diese absurde, traurige Frage verleiht dem Gedicht eine doppelte Bedeutungsebene. Einerseits spielt Ringelnatz humorvoll mit dem Wort „Meerschweinchen“, andererseits offenbart die Frage eine tiefe existenzielle Heimatlosigkeit – eine Sehnsucht nach etwas, das das Tier, seinem Namen nach, nie gekannt hat.
Mit einfacher Sprache und einer skurrilen Szene gelingt es Ringelnatz, eine leise Parabel über Entfremdung und die Suche nach einem verlorenen Ursprung zu erzählen. Das Meerschweinchen wird so zum Sinnbild des Menschen, der – manchmal naiv, manchmal traurig – auf der Suche nach einem Platz in der Welt ist, den er vielleicht nie erreichen kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.