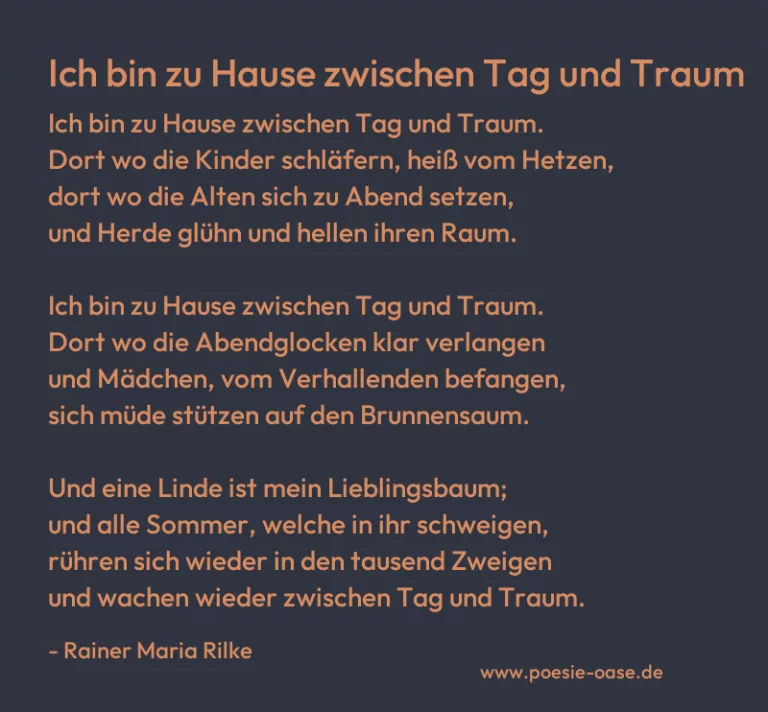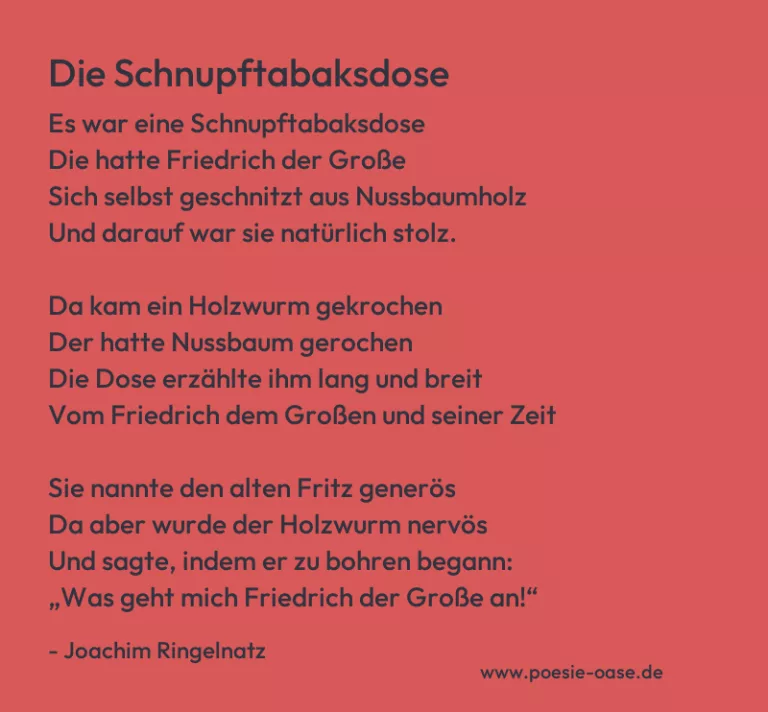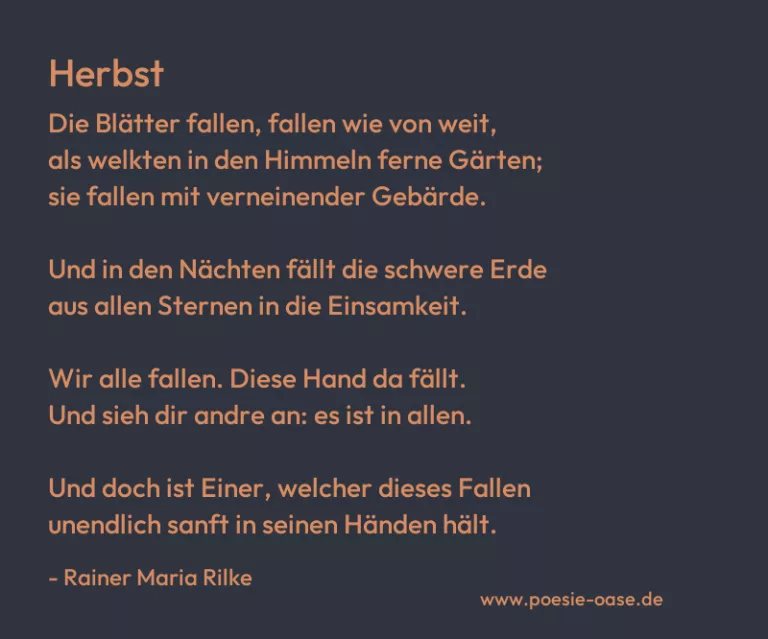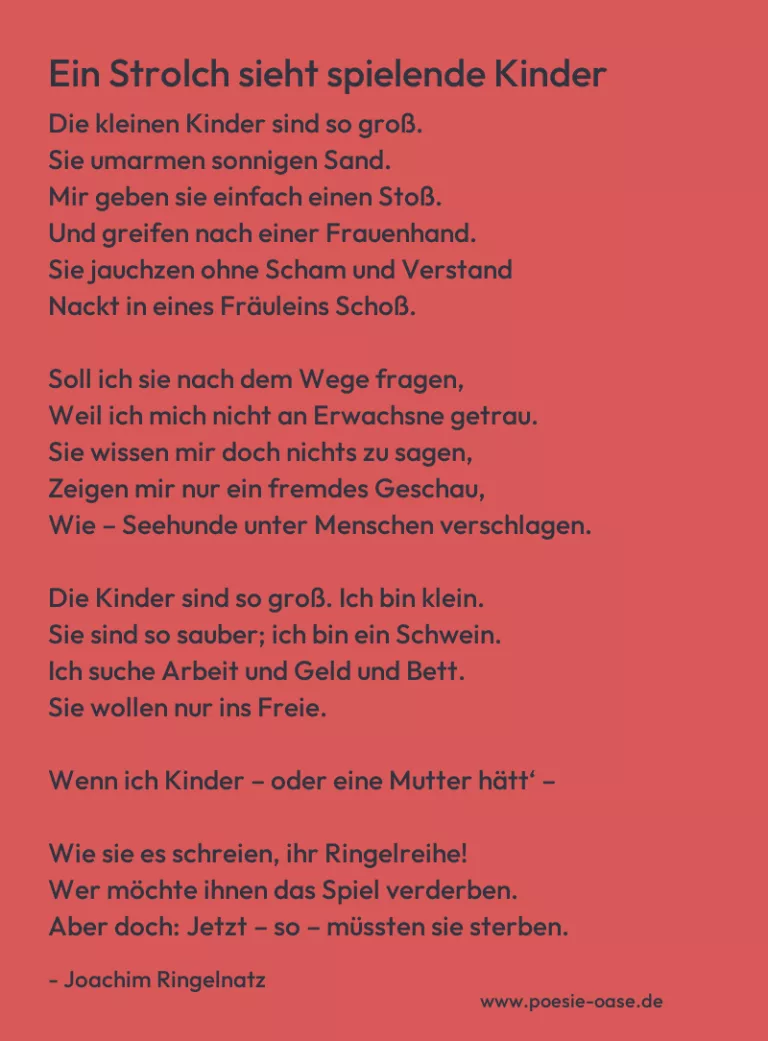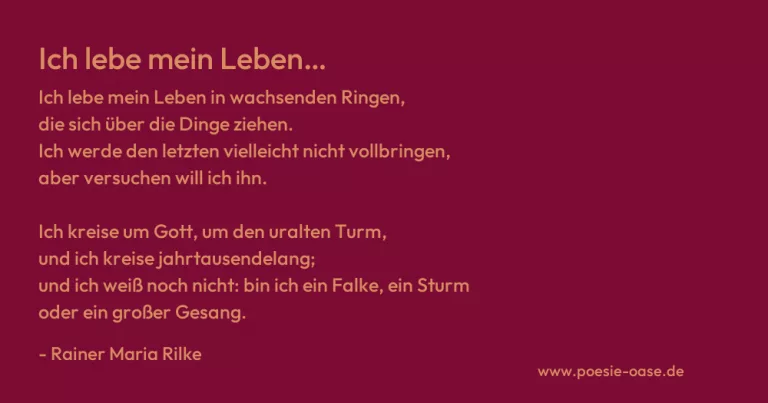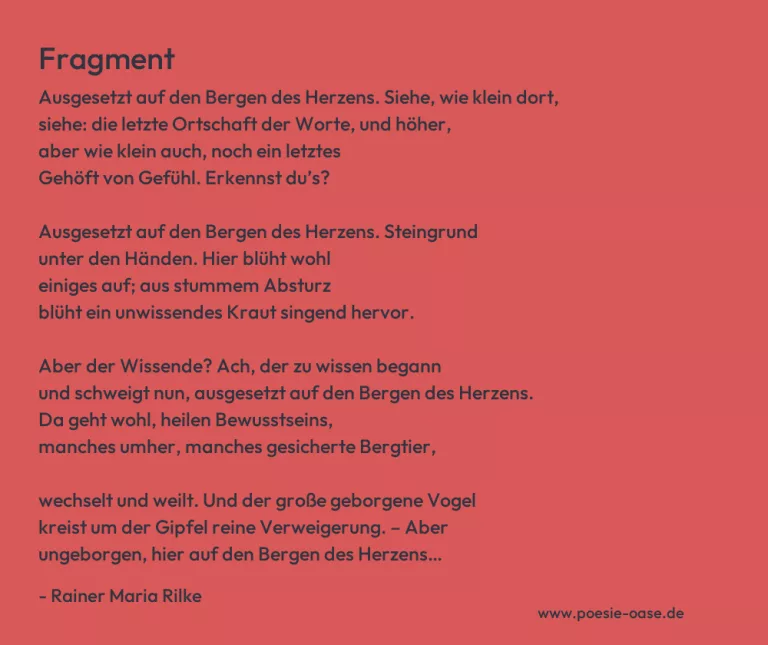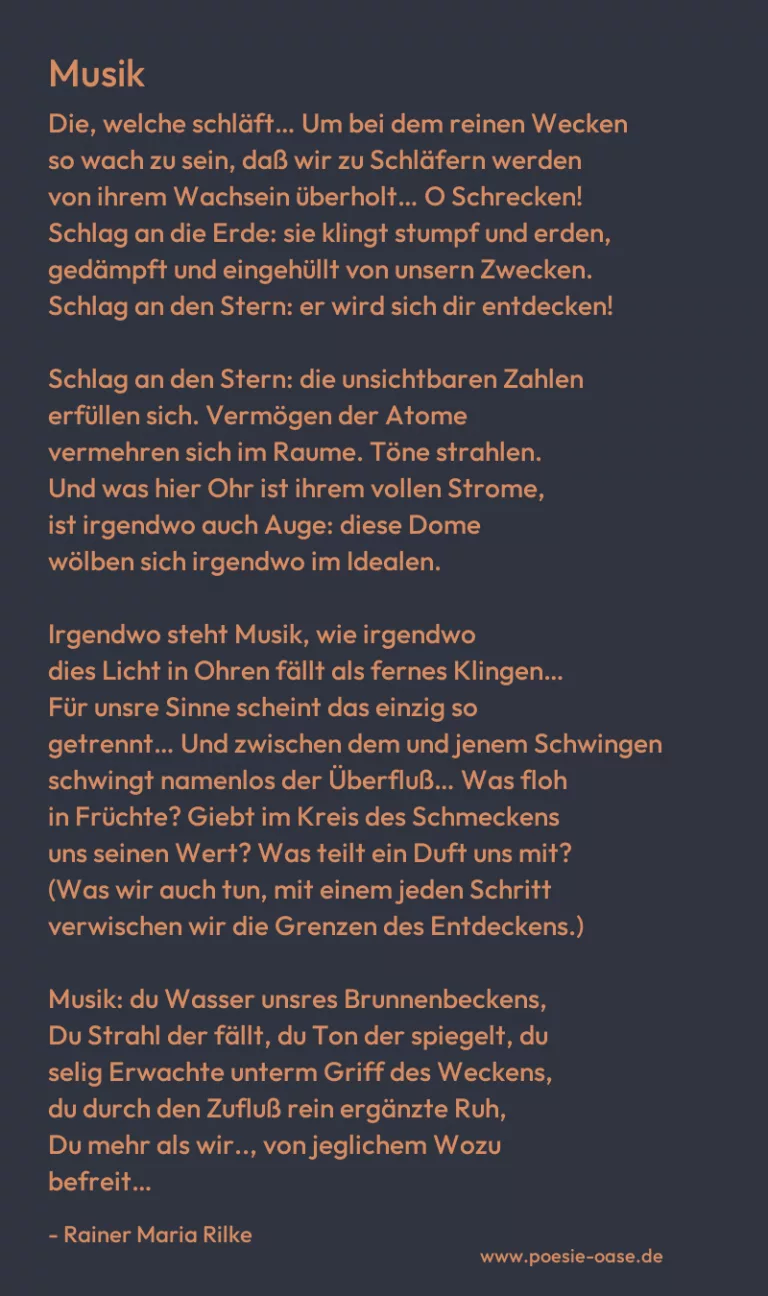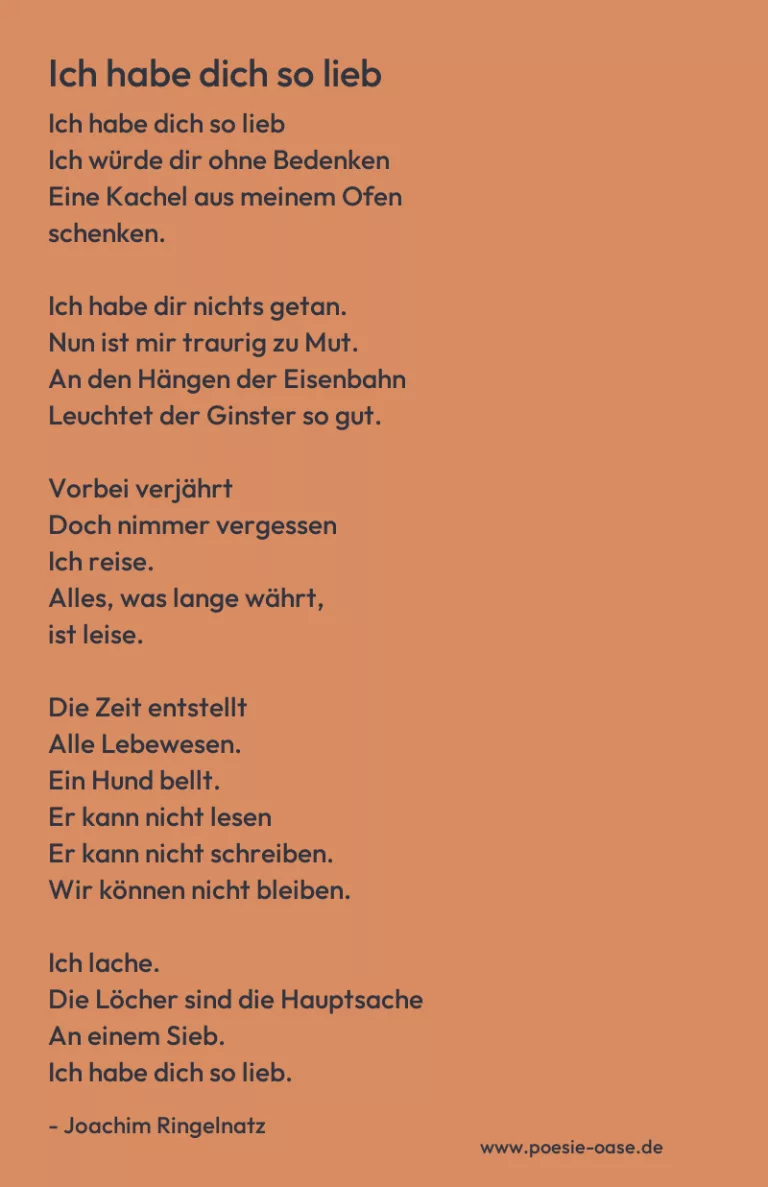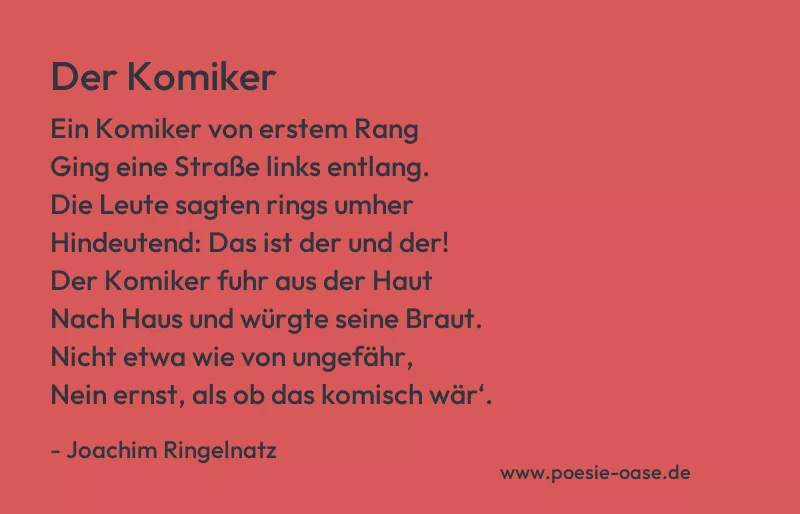Abstrakt, Achtzeiler, Beruf, Gemeinfrei, Humor & Ironie, Ironie, Kritik, Kurz, Moderne, Vierzeiler, Wut
Der Komiker
Ein Komiker von erstem Rang
Ging eine Straße links entlang.
Die Leute sagten rings umher
Hindeutend: Das ist der und der!
Der Komiker fuhr aus der Haut
Nach Haus und würgte seine Braut.
Nicht etwa wie von ungefähr,
Nein ernst, als ob das komisch wär‘.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
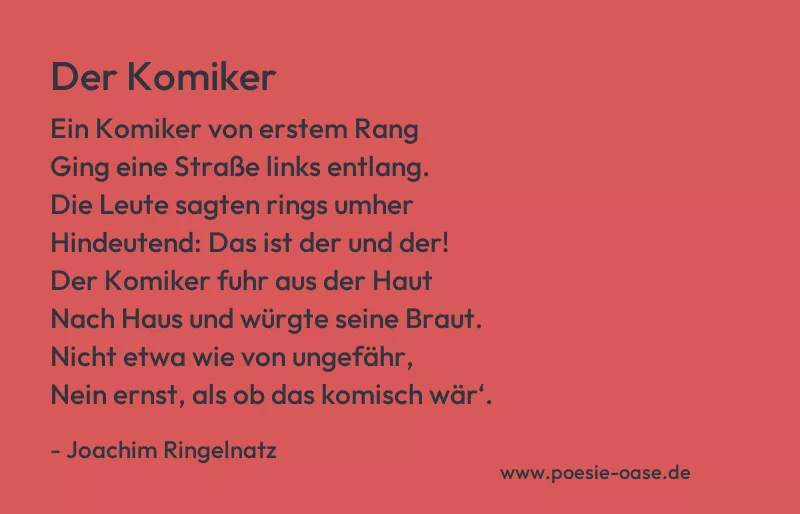
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Komiker“ von Joachim Ringelnatz spielt in wenigen Zeilen mit der Erwartungshaltung gegenüber Menschen, die als lustig oder unterhaltsam gelten. Der Komiker wird auf offener Straße erkannt und mit neugierigen Blicken bedacht – eine Situation, die ihn nicht erfreut, sondern tief verärgert. Statt der erwarteten Fröhlichkeit zeigt er eine erschreckend gewalttätige Reaktion.
Ringelnatz beschreibt hier auf bittere Weise die Diskrepanz zwischen öffentlichem Bild und privater Realität. Der Komiker, der im Beruf für Heiterkeit sorgt, empfindet in seinem privaten Leben Zorn und Aggression. Die Ironie entsteht dadurch, dass seine Wut und die darauf folgende Tat – das Würgen seiner Braut – in einem Kontext stehen, der vermeintlich komisch sein könnte, tatsächlich aber schockierend ernst ist.
Die Sprache ist bewusst nüchtern und reduziert gehalten, wodurch die Absurdität und Härte der Handlung noch deutlicher hervortreten. Ringelnatz entlarvt die Erwartung, dass jemand, der auf der Bühne Lachen erzeugt, auch im Leben stets heiter und harmlos sei. Stattdessen zeigt er, dass auch hinter einer komischen Fassade dunkle und zerstörerische Seiten existieren können.
Das Gedicht wirkt wie eine lakonische, fast kalte Parabel auf die Masken der Gesellschaft und die tragischen Abgründe individueller Persönlichkeiten. Die letzte Zeile stellt die beklemmende Frage, ob selbst Gewalt unter dem Deckmantel der Komik verharmlost oder missverstanden werden könnte – ein bitterer, nachdenklicher Schlussakkord.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.