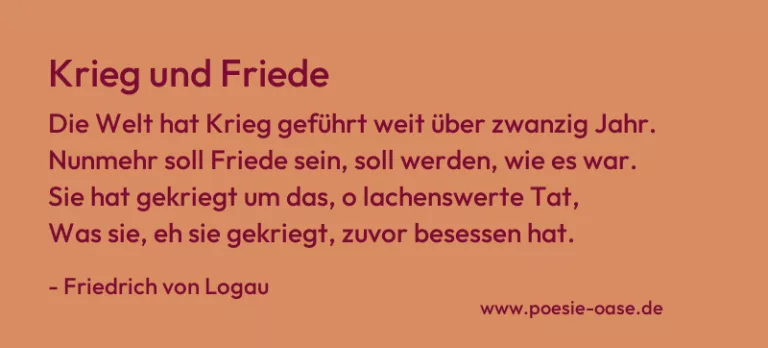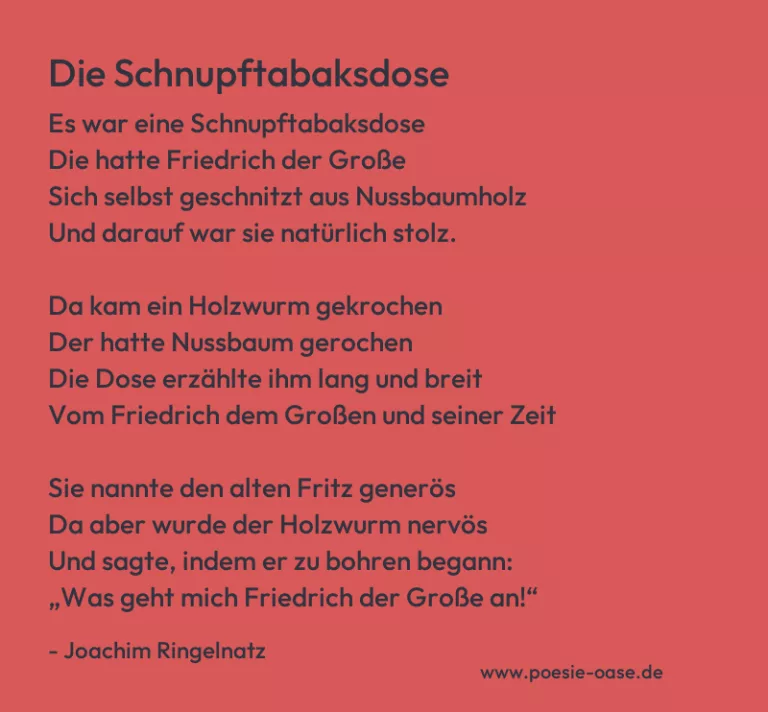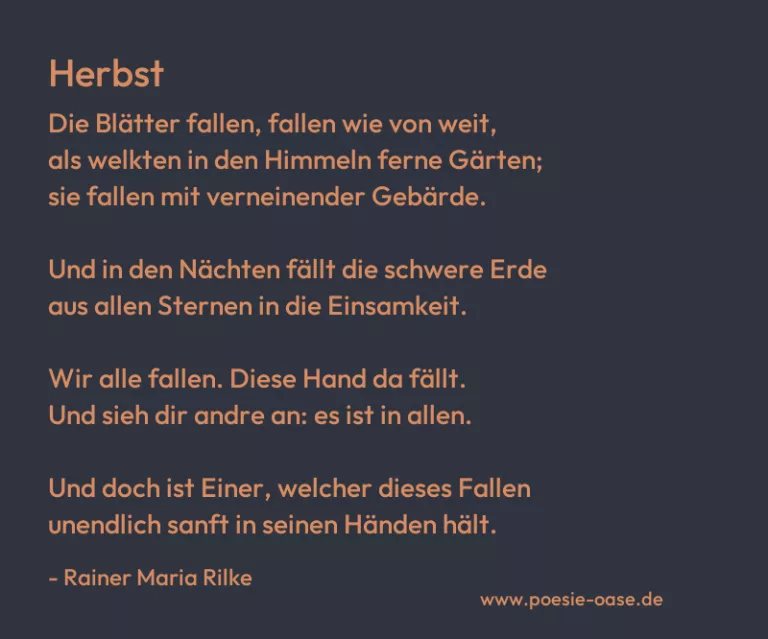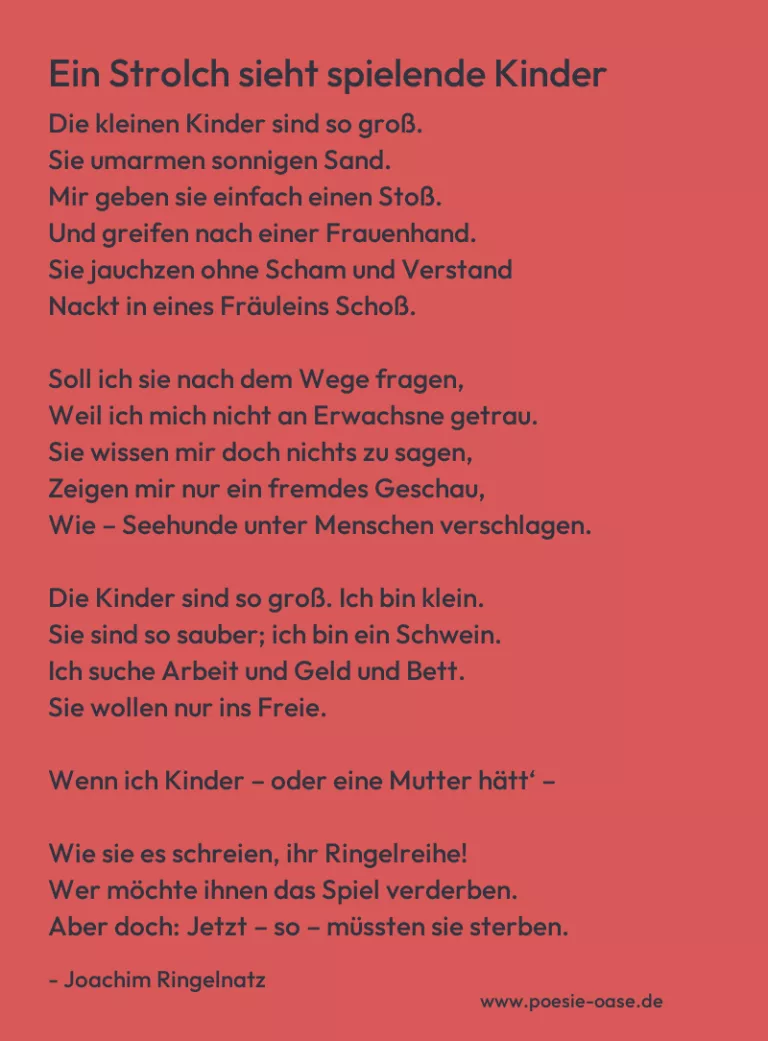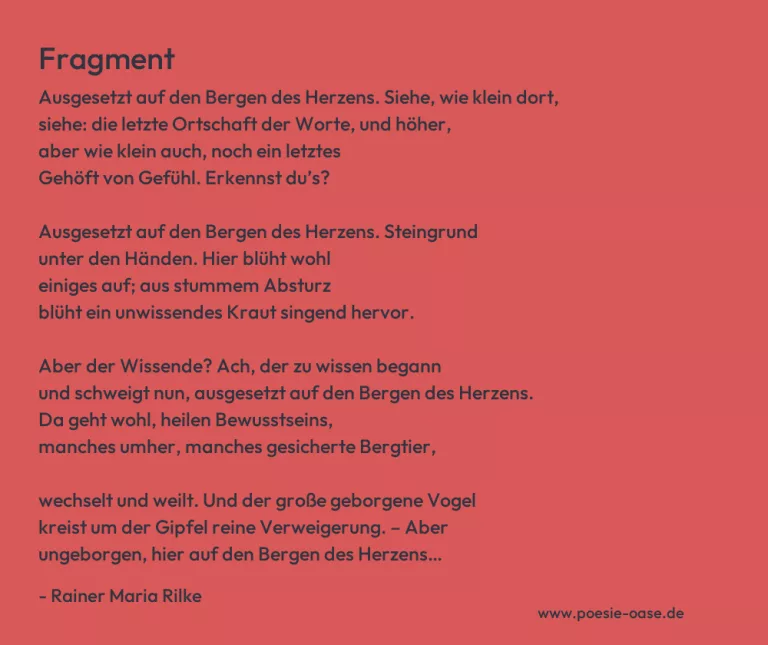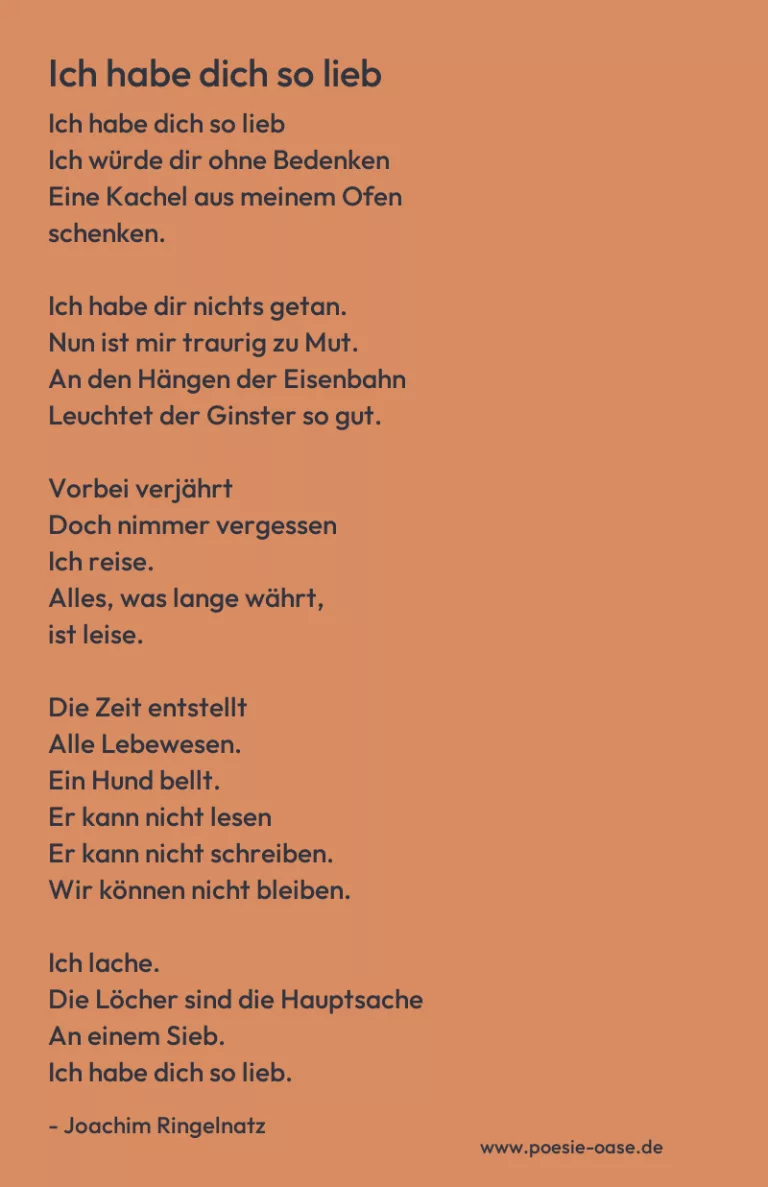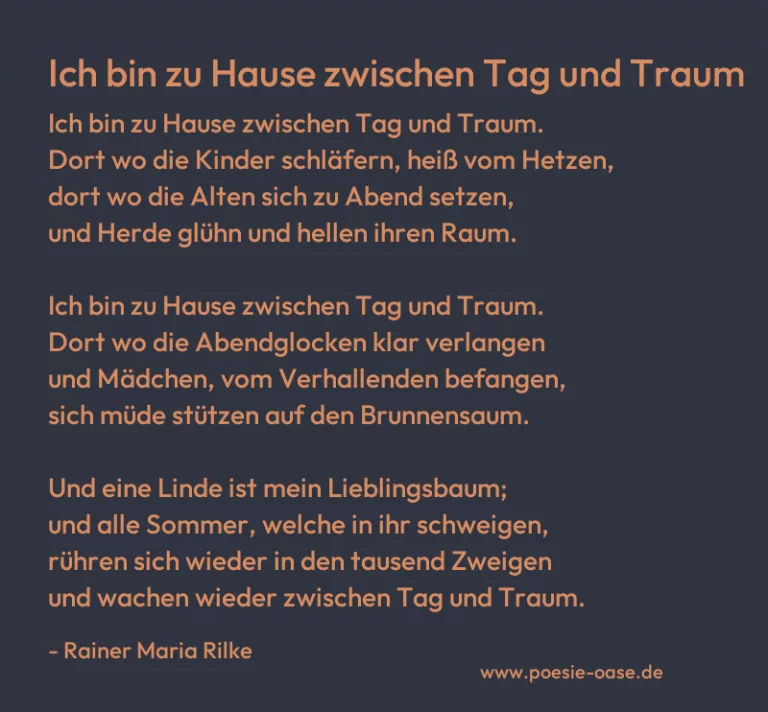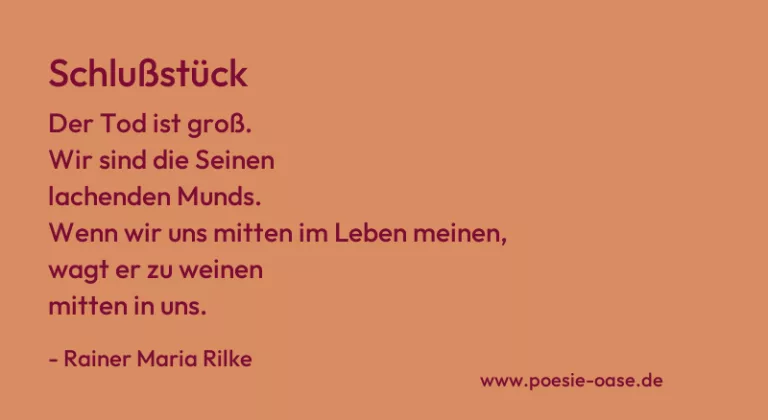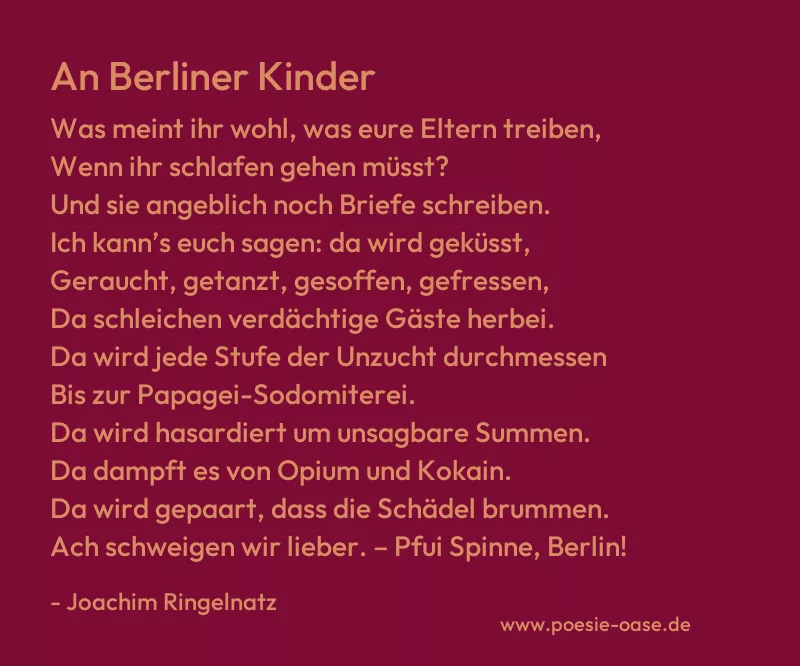An Berliner Kinder
Was meint ihr wohl, was eure Eltern treiben,
Wenn ihr schlafen gehen müsst?
Und sie angeblich noch Briefe schreiben.
Ich kann’s euch sagen: da wird geküsst,
Geraucht, getanzt, gesoffen, gefressen,
Da schleichen verdächtige Gäste herbei.
Da wird jede Stufe der Unzucht durchmessen
Bis zur Papagei-Sodomiterei.
Da wird hasardiert um unsagbare Summen.
Da dampft es von Opium und Kokain.
Da wird gepaart, dass die Schädel brummen.
Ach schweigen wir lieber. – Pfui Spinne, Berlin!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
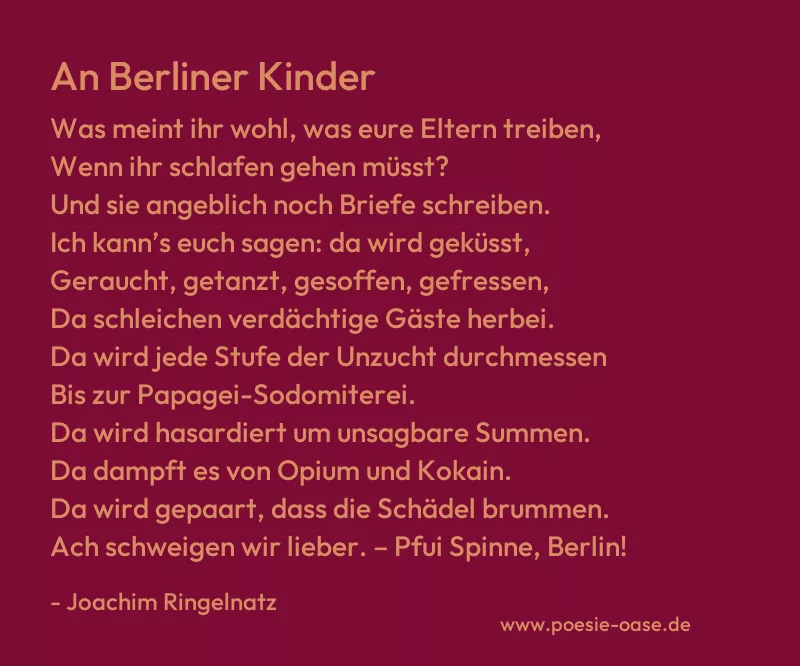
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Berliner Kinder“ von Joachim Ringelnatz spielt auf humorvolle, aber zugleich provokante Weise mit den kindlichen Vorstellungen vom nächtlichen Treiben der Erwachsenen. Es beginnt scheinbar harmlos mit der Frage, was die Eltern tun, wenn die Kinder schlafen gehen, doch schnell schlägt der Ton in eine überzeichnete, satirische Darstellung um. Mit übertriebenen Bildern von Lasterhaftigkeit – vom Küssen und Rauchen bis hin zu Hasardspielen, Drogenkonsum und „Papagei-Sodomiterei“ – entwirft Ringelnatz eine groteske Karikatur nächtlichen Stadtlebens.
Die Übertreibung ist dabei ein zentrales Stilmittel des Gedichts. Die Fantasie wird immer wilder, bis die Zustände völlig absurd erscheinen. Dies unterstreicht den ironischen Charakter des Gedichts, das eher die Klischees über das Berliner Nachtleben aufs Korn nimmt als eine ernsthafte Anklage zu erheben. Gerade durch die Steigerung der Ausschweifungen bis ins Groteske entsteht eine komische Wirkung, die typisch für Ringelnatz‘ Stil ist.
Die abschließende Wendung „Ach schweigen wir lieber. – Pfui Spinne, Berlin!“ verstärkt den ironischen Unterton. Das scheinbare Entsetzen über die nächtlichen Exzesse steht im Kontrast zur amüsanten Überzeichnung zuvor. So zeigt das Gedicht auf satirische Weise die Faszination und gleichzeitige Empörung, mit der das wilde Treiben einer Großstadt betrachtet werden kann – eine humorvolle Reflexion über Moral, Vorurteile und Großstadtmythen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.