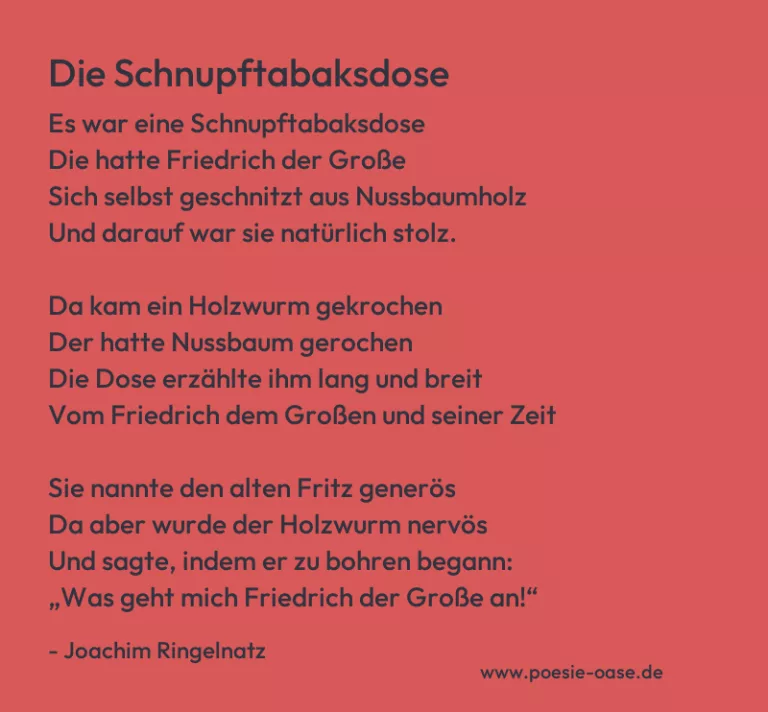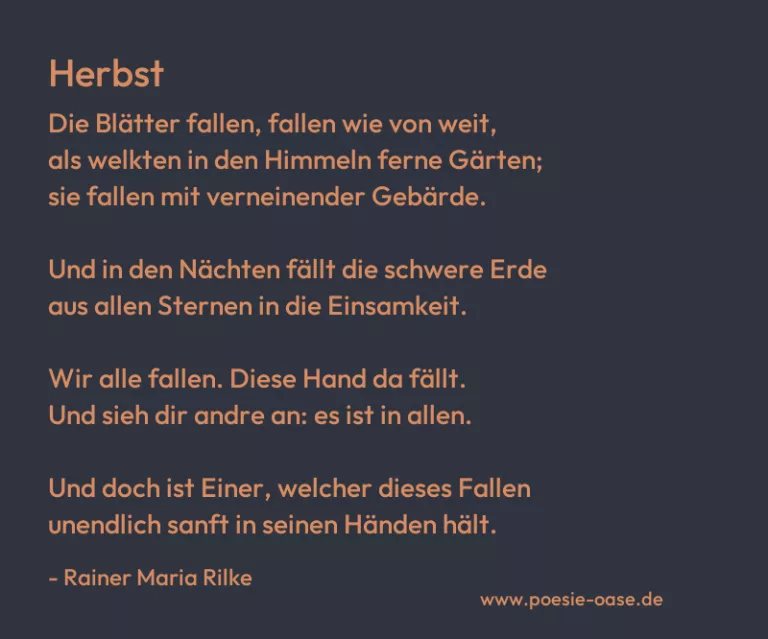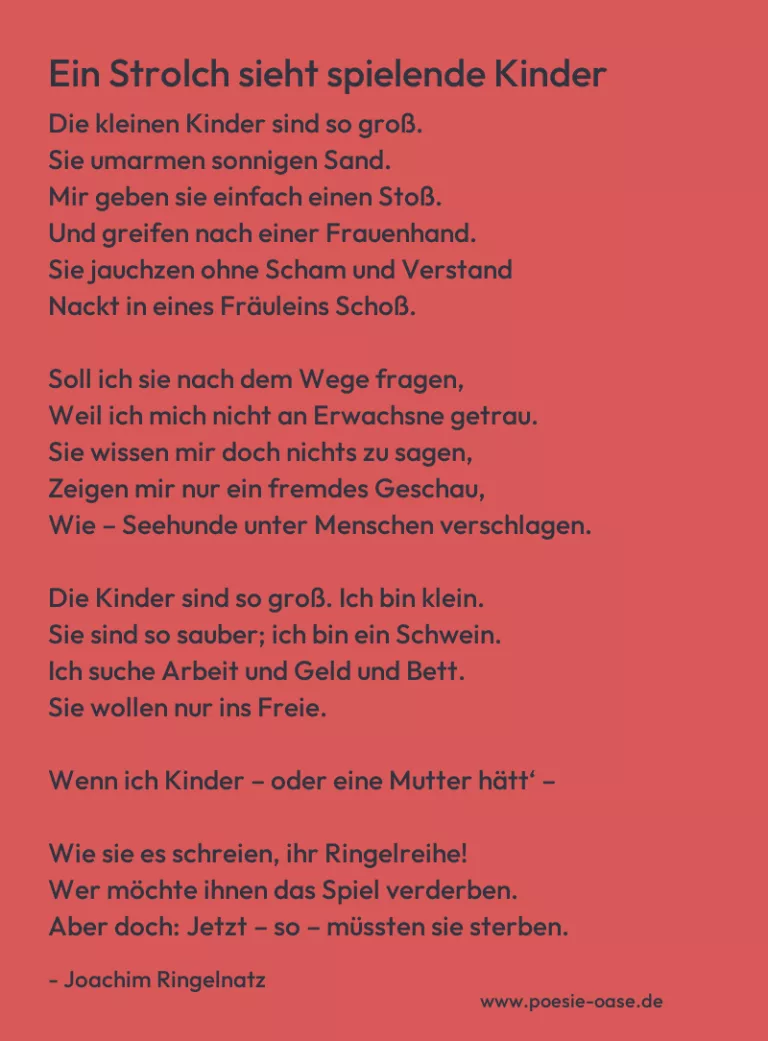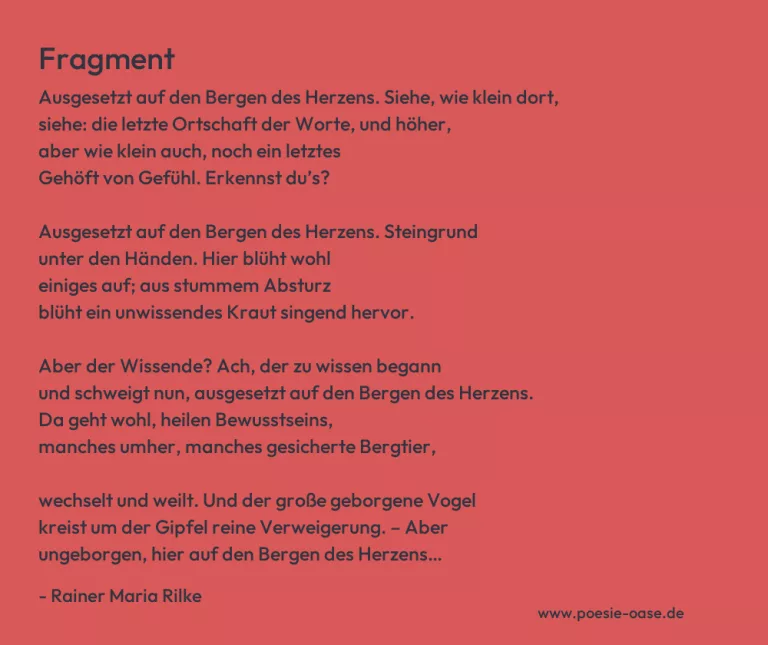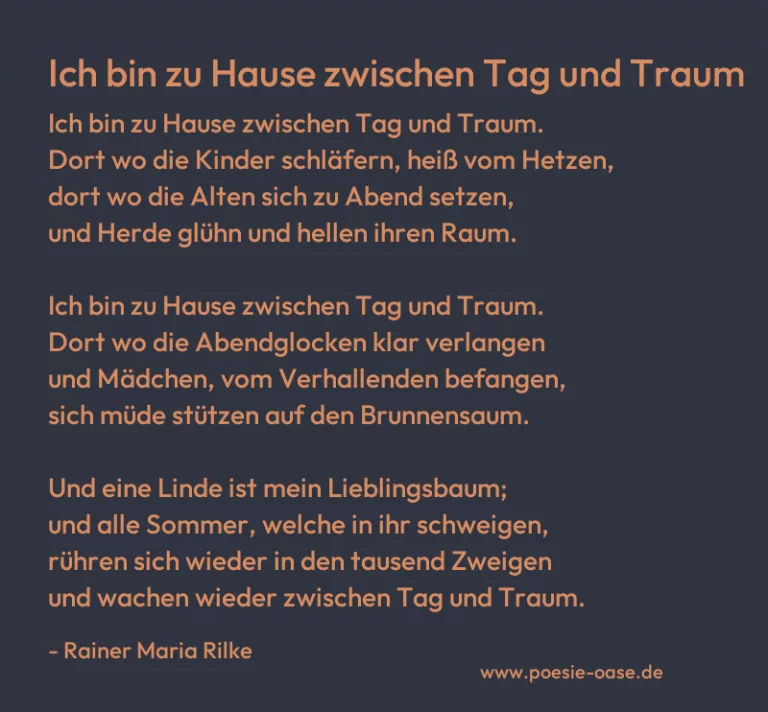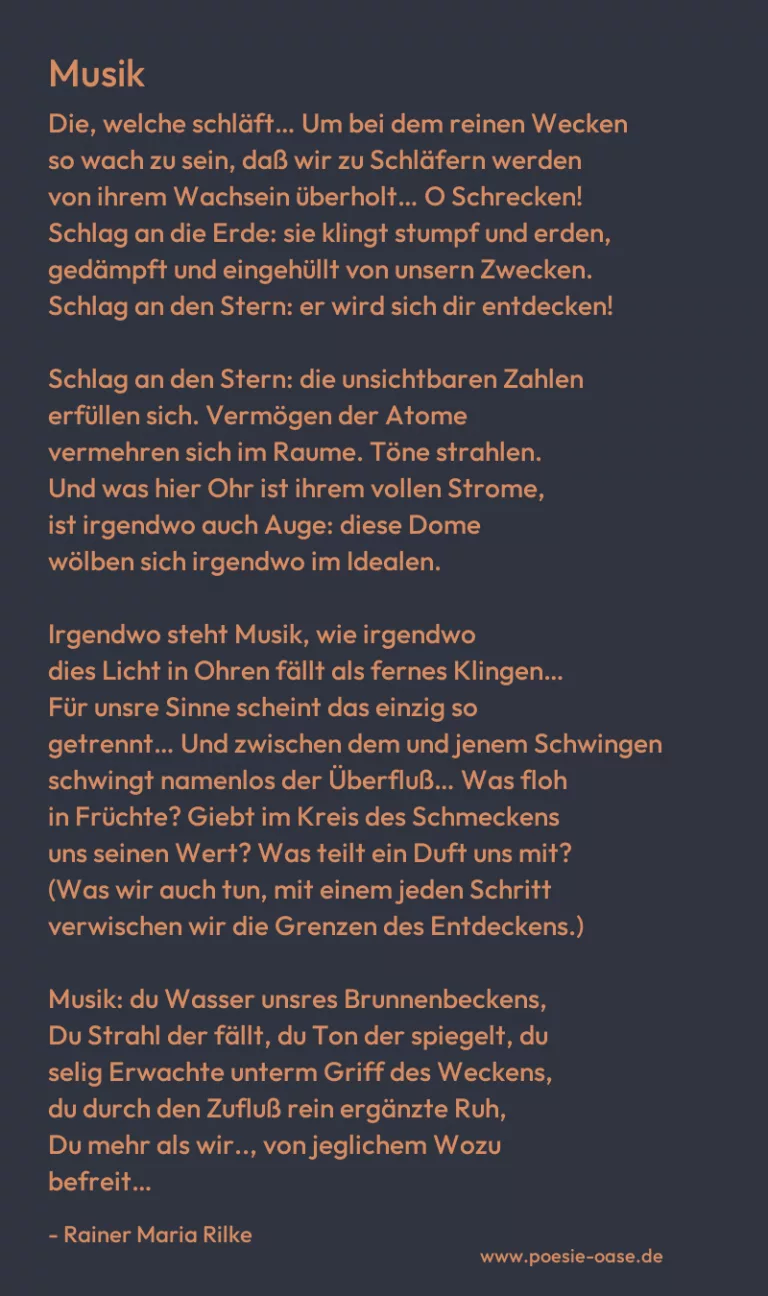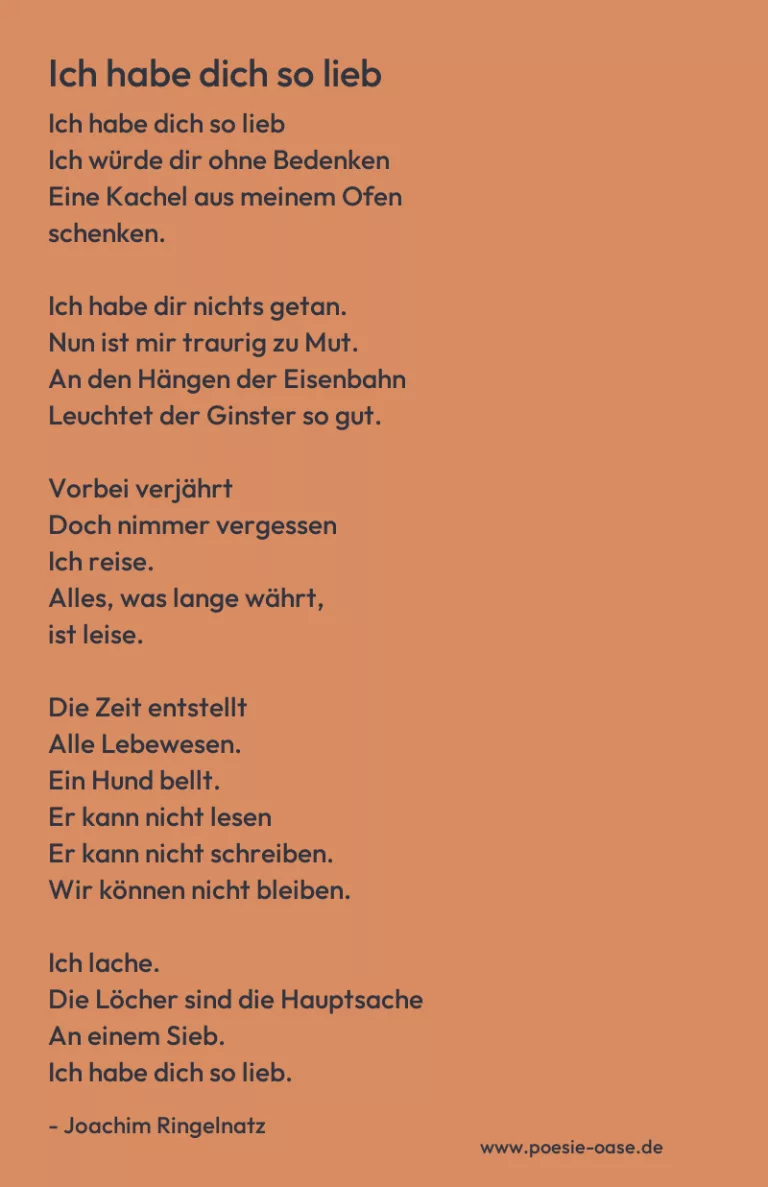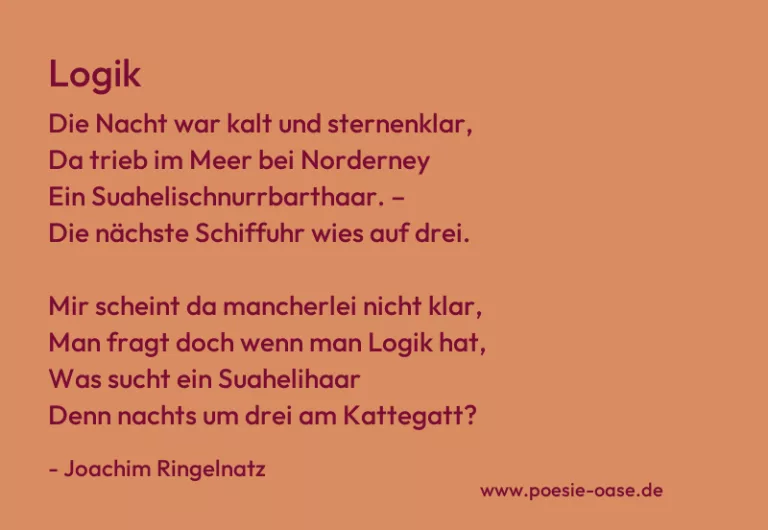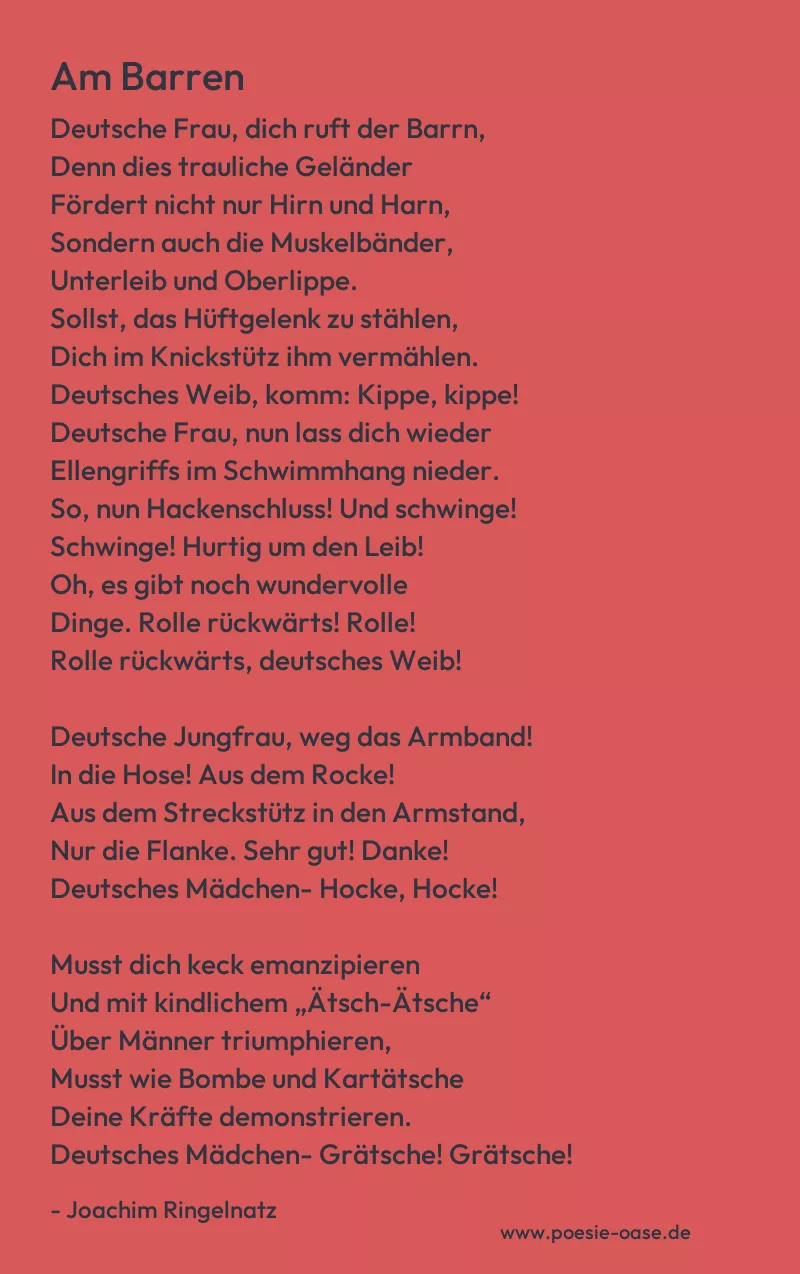Am Barren
Deutsche Frau, dich ruft der Barrn,
Denn dies trauliche Geländer
Fördert nicht nur Hirn und Harn,
Sondern auch die Muskelbänder,
Unterleib und Oberlippe.
Sollst, das Hüftgelenk zu stählen,
Dich im Knickstütz ihm vermählen.
Deutsches Weib, komm: Kippe, kippe!
Deutsche Frau, nun lass dich wieder
Ellengriffs im Schwimmhang nieder.
So, nun Hackenschluss! Und schwinge!
Schwinge! Hurtig um den Leib!
Oh, es gibt noch wundervolle
Dinge. Rolle rückwärts! Rolle!
Rolle rückwärts, deutsches Weib!
Deutsche Jungfrau, weg das Armband!
In die Hose! Aus dem Rocke!
Aus dem Streckstütz in den Armstand,
Nur die Flanke. Sehr gut! Danke!
Deutsches Mädchen- Hocke, Hocke!
Musst dich keck emanzipieren
Und mit kindlichem „Ätsch-Ätsche“
Über Männer triumphieren,
Musst wie Bombe und Kartätsche
Deine Kräfte demonstrieren.
Deutsches Mädchen- Grätsche! Grätsche!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
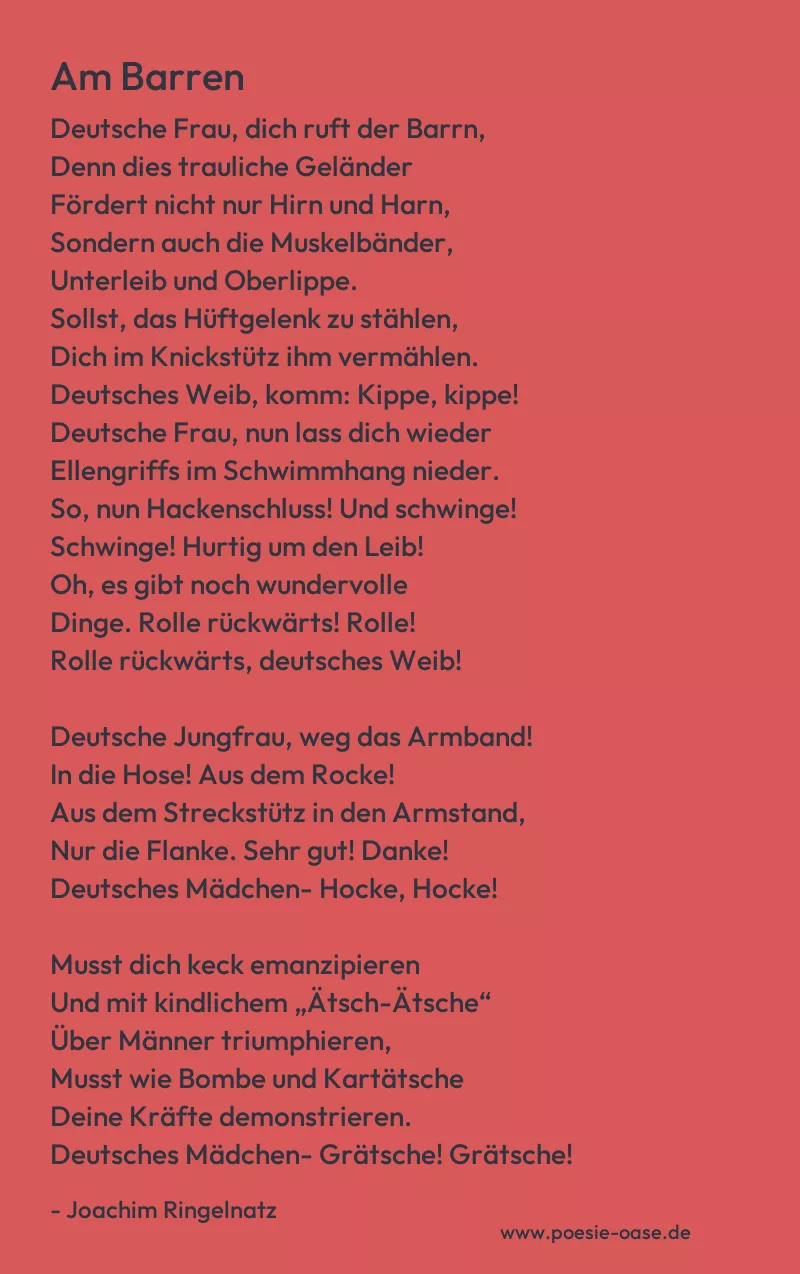
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Am Barren“ von Joachim Ringelnatz ist eine humorvolle, aber auch satirische Auseinandersetzung mit der Vorstellung von körperlicher Ertüchtigung und der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Der Sprecher, der anscheinend eine Art sportliche Anleitung gibt, fordert die „deutsche Frau“ zu verschiedenen Übungen am Barren auf. Dabei wird der Barren nicht nur als Gerät zur körperlichen Fitness dargestellt, sondern auch als Symbol für Disziplin und den Versuch, körperliche und geistige Fähigkeiten zu fördern. Diese Sportübungen, die von „Kippe, kippe!“ bis zu „Rolle rückwärts!“ reichen, stellen eine Art übersteigerte Aufforderung zur körperlichen Leistung dar, die eine gewisse Ironie in Bezug auf die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen zeigt.
Die wiederholte Anrede der „deutschen Frau“ und „deutschen Jungfrau“ verweist auf stereotype Vorstellungen von Weiblichkeit und die enge Verbindung von Frauenkörper und gesellschaftlicher Norm. Das Gedicht stellt den sportlichen Akt als eine Art emanzipatorische Handlung dar, in der die Frauen ihre körperlichen Fähigkeiten und ihre Unabhängigkeit demonstrieren können. Doch diese vermeintliche Emanzipation ist ironisch überhöht: Der Sprecher fordert zu übertriebenen und teils absurden Übungen auf, was die tatsächliche Bedeutung von Selbstbestimmung und Gleichberechtigung in Frage stellt. Das Bild der „Grätsche“, das die Beweglichkeit und Flexibilität betont, könnte als eine Metapher für die weibliche Anpassung an gesellschaftliche Normen gesehen werden.
Die humorvolle Sprache, die sich in Form von Aufforderungen wie „Kippe, kippe!“ und „Hocke, Hocke!“ äußert, nimmt die sportliche Ertüchtigung auf eine fast kindliche, verspielte Weise auf, wodurch eine gewisse Absurdität und Übertreibung erzeugt wird. Die Vorstellung, dass körperliche Übungen wie „Rolle rückwärts“ und „Grätsche“ zu einer Form der Emanzipation führen, wirkt im Kontext des Gedichts eher als eine Kritik an der oberflächlichen Wahrnehmung von Gleichberechtigung und der Rolle der Frau. Statt einer echten Emanzipation wird hier eine oberflächliche Darstellung von Aktivität und Leistung ins Spiel gebracht, die jedoch die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Zwänge nicht infrage stellt.
Am Ende des Gedichts wird eine fast militärische Aufforderung zur Demonstration von „Kräften“ in einer Weise formuliert, die sowohl die körperliche Leistungsfähigkeit als auch das Bedürfnis nach Anerkennung im sozialen Kontext betont. Das Gedicht endet mit der Forderung nach einer „Grätsche“, die sowohl als sportliche Bewegung als auch als eine symbolische Geste der Anpassung verstanden werden kann. In seiner humorvollen Übertreibung und seinen ironischen Wendungen zeigt Ringelnatz die Absurdität und den Widerspruch in der Vorstellung, dass körperliche Disziplin und Leistung allein zur Emanzipation führen können. Das Gedicht ist eine satirische Kritik an den engen gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen und an der oberflächlichen Betrachtung von „Emanzipation“ durch körperliche Leistung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.