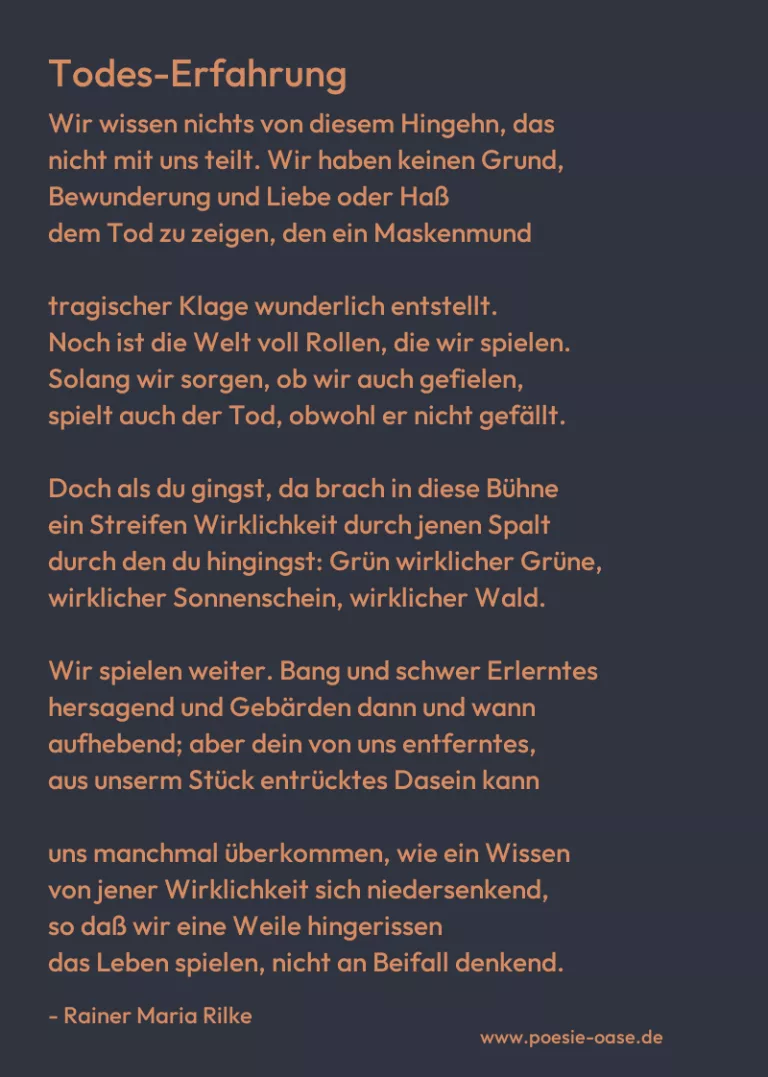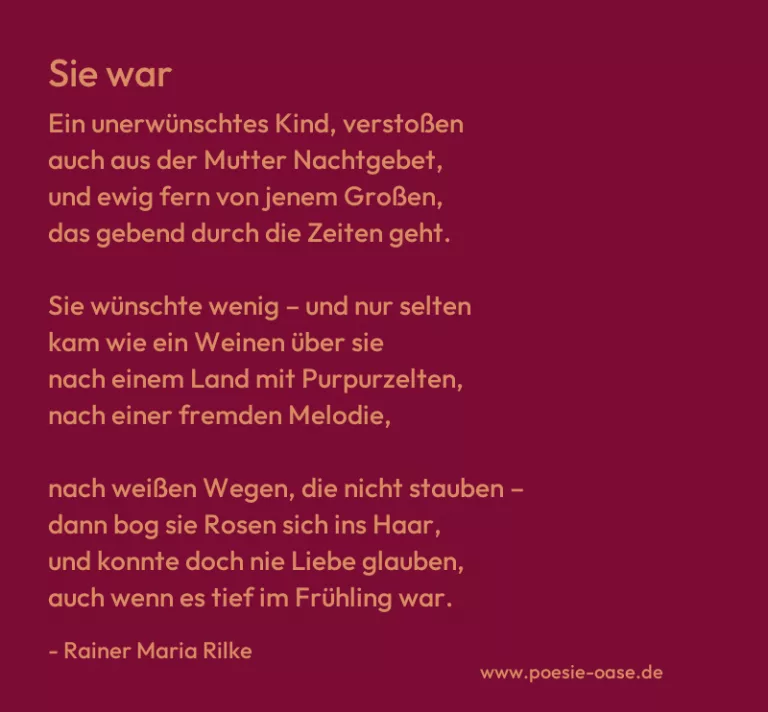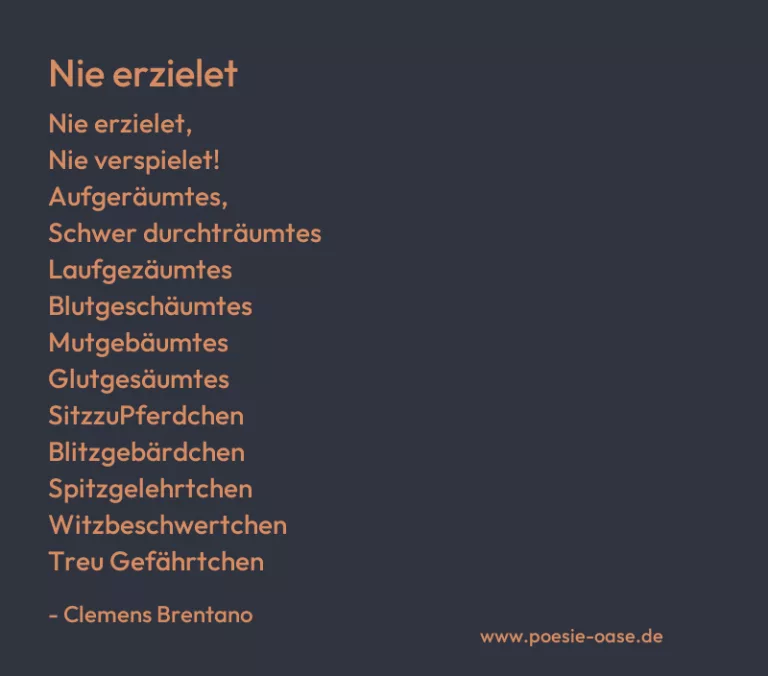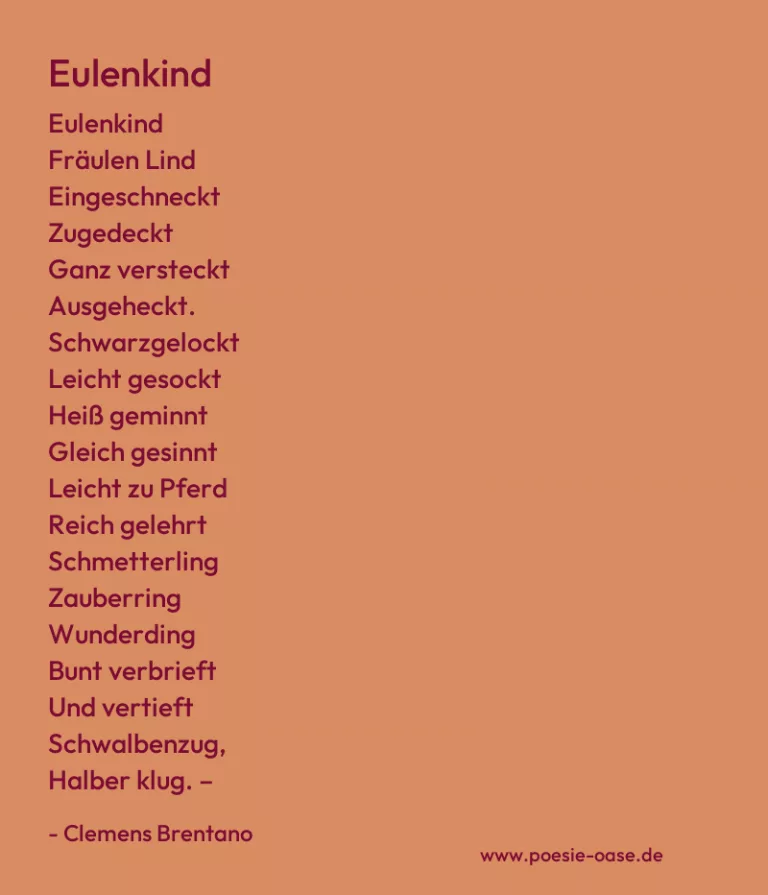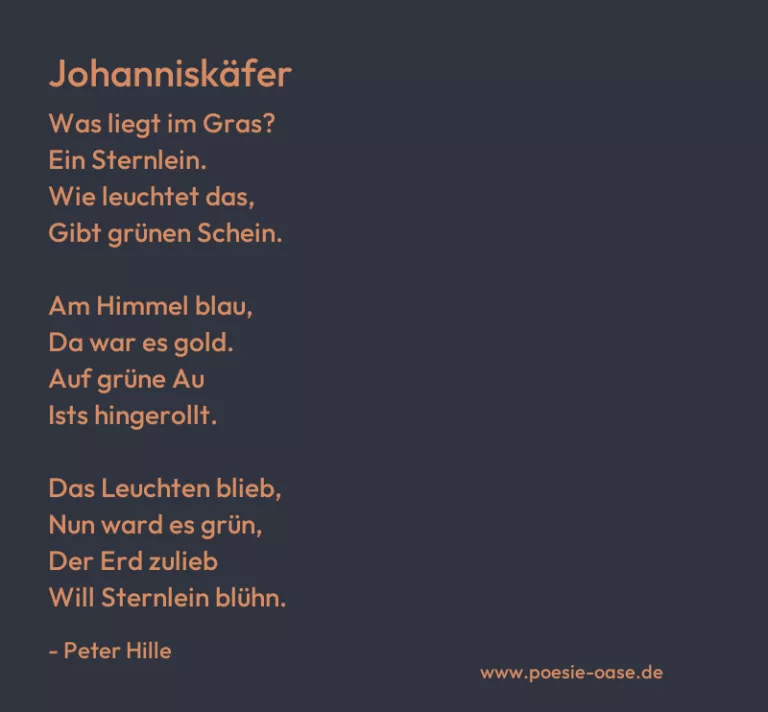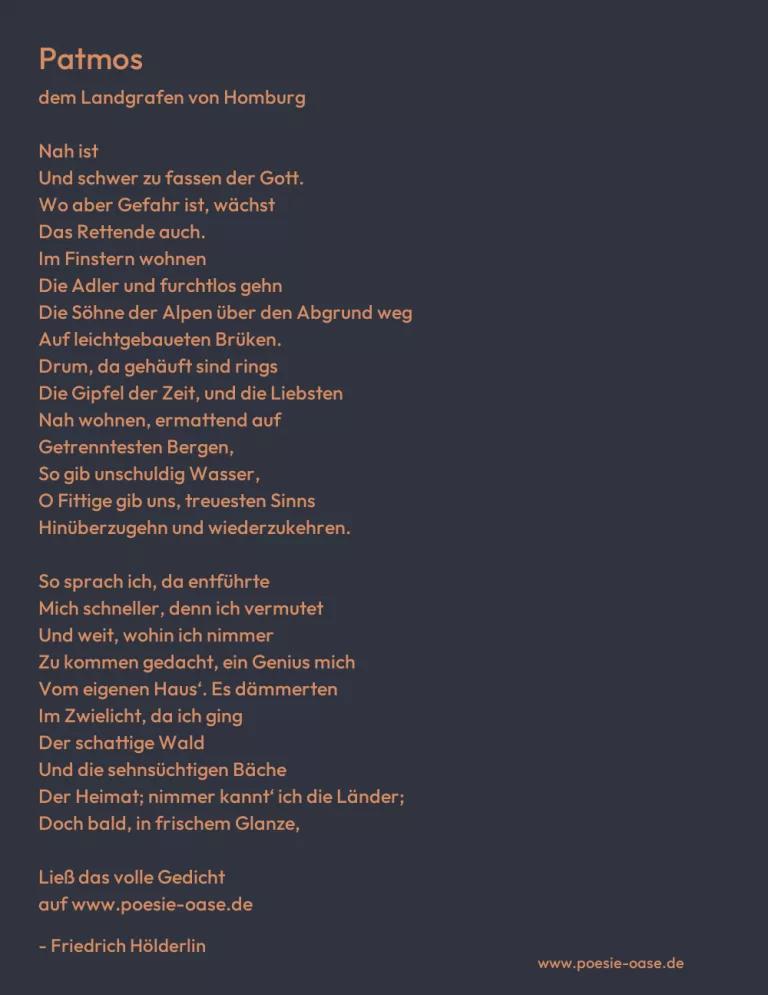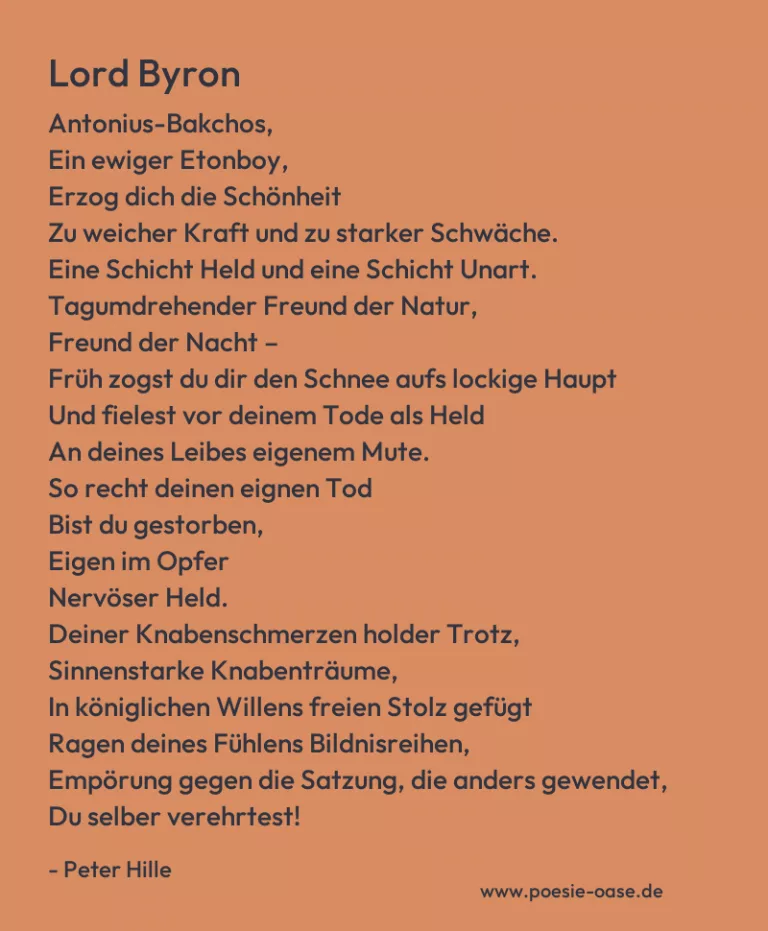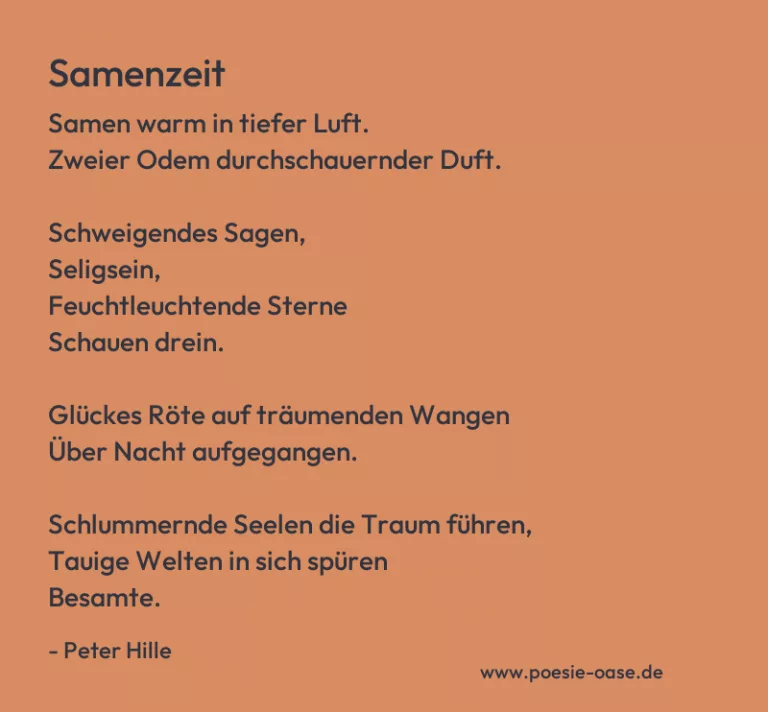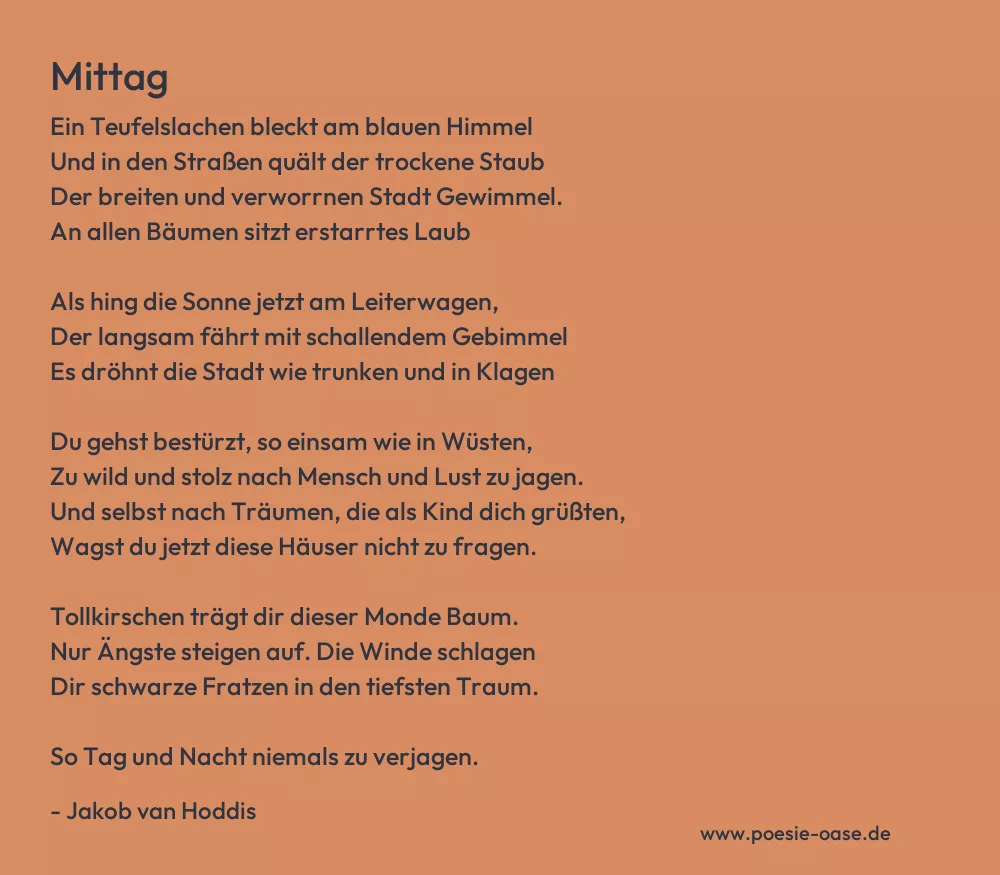Einsamkeit, Gegenwart, Gemeinfrei, Götter, Heimat & Identität, Herbst, Himmel & Wolken, Leichtigkeit, Leidenschaft, Natur, Sommer, Wälder & Bäume
Mittag
Ein Teufelslachen bleckt am blauen Himmel
Und in den Straßen quält der trockene Staub
Der breiten und verworrnen Stadt Gewimmel.
An allen Bäumen sitzt erstarrtes Laub
Als hing die Sonne jetzt am Leiterwagen,
Der langsam fährt mit schallendem Gebimmel
Es dröhnt die Stadt wie trunken und in Klagen
Du gehst bestürzt, so einsam wie in Wüsten,
Zu wild und stolz nach Mensch und Lust zu jagen.
Und selbst nach Träumen, die als Kind dich grüßten,
Wagst du jetzt diese Häuser nicht zu fragen.
Tollkirschen trägt dir dieser Monde Baum.
Nur Ängste steigen auf. Die Winde schlagen
Dir schwarze Fratzen in den tiefsten Traum.
So Tag und Nacht niemals zu verjagen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
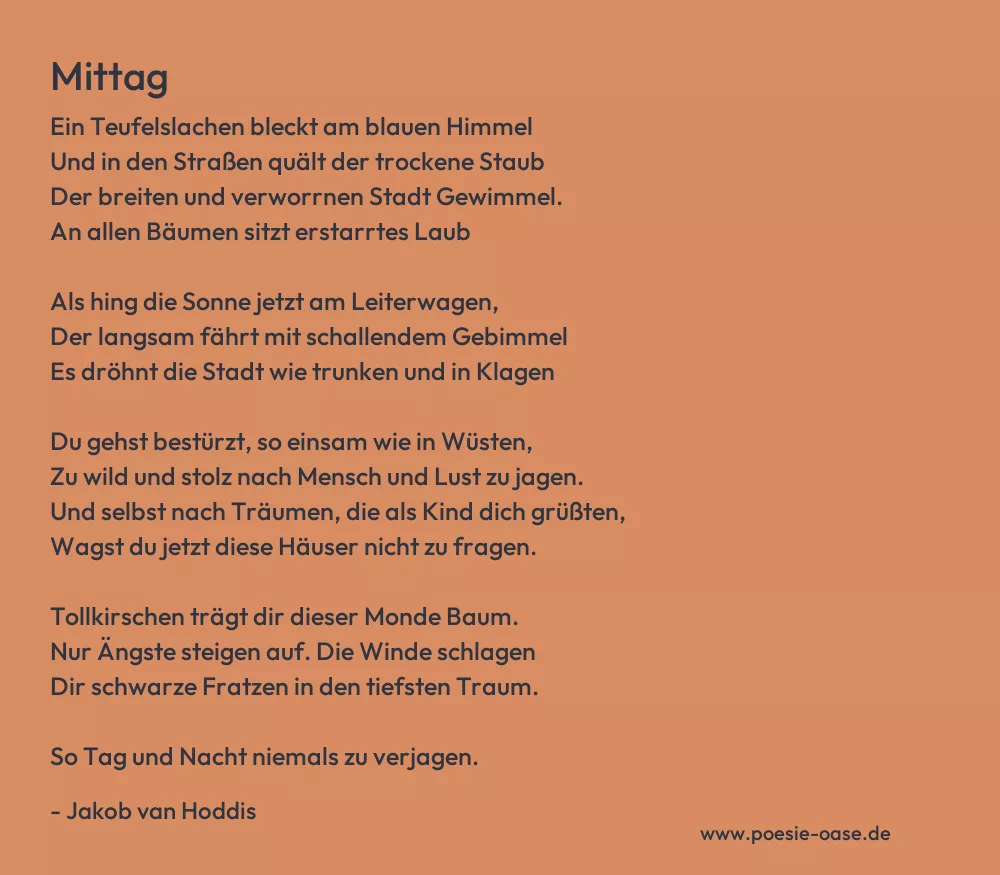
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Mittag“ von Jakob van Hoddis entfaltet eine düstere und bedrückende Stimmung, die von einer überwältigenden Sinneseindrücke und einer Entfremdung des lyrischen Ichs geprägt ist. Der „Teufelslachen“, der „am blauen Himmel bleckt“, lässt bereits zu Beginn eine bedrohliche und unheilvolle Atmosphäre aufkommen. Das Bild des Teufels ist eine starke Metapher für das Unheil, das sich im Hintergrund abspielt – eine weltliche, von Lärm und Chaos durchzogene Realität, in der die Natur selbst verzerrt und vom „Teufel“ beherrscht erscheint. Der „trockene Staub“, der durch die Straßen der „breiten und verworrenen Stadt“ weht, verstärkt das Gefühl der Trostlosigkeit und Verlorenheit, das der Protagonist empfindet.
Die Darstellung der Stadt ist nicht nur physisch, sondern auch emotional belastend: „erstarrtes Laub“ an den Bäumen verweist auf das Stillstehen der Natur und auf eine Welt, die nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich erstarrt ist. Die Sonne, die „jetzt am Leiterwagen“ hängt, wird von der düsteren Sicht des lyrischen Ichs als Symbol für die Last und Schwere des Lebens dargestellt. Der „Leiterwagen“, der „langsam fährt mit schallendem Gebimmel“, steht für die Trägheit und das monotone Voranschreiten der Zeit, begleitet von einem dröhnenden, klagenden Geräusch, das die drückende Atmosphäre noch verstärkt.
Der Übergang zu den inneren Empfindungen des lyrischen Ichs bringt das Gefühl der Einsamkeit und der Orientierungslosigkeit auf eine persönliche Ebene. Es wird beschrieben, wie der Protagonist „bestürzt“ durch die Stadt geht, „einsam wie in Wüsten“, was das Gefühl der Entfremdung und der Leere unterstreicht. Er ist auf der Jagd „nach Mensch und Lust“, aber auch nach den „Träumen“, die ihn als Kind einst begleiteten, doch „wagst du jetzt diese Häuser nicht zu fragen“. Diese Zeilen spiegeln eine verlorene Unschuld wider, die dem lyrischen Ich mittlerweile verschlossen ist. Die Stadt, die einst vertraut schien, erscheint jetzt als ein undurchdringlicher Ort, an dem selbst die Erinnerung an die Vergangenheit nicht mehr zugänglich ist.
Das Bild der „Tollkirschen“, die der „Monde Baum“ trägt, verstärkt die Stimmung von Gefahr und Verführung. Tollkirschen sind giftig und symbolisieren sowohl die Verlockung als auch das drohende Unheil, das der Protagonist in seiner inneren Zerrissenheit spürt. Die „Ängste“, die „aufsteigen“ und die „schwarzen Fratzen“, die in den „tiefsten Traum“ schlagen, manifestieren sich als düstere, quälende Gedanken und Ängste, die das lyrische Ich umhüllen und die Freiheit des Traumes ersticken. Der Gedanke, dass Tag und Nacht „niemals zu verjagen“ sind, verdeutlicht die Unausweichlichkeit und die Dauerhaftigkeit des inneren Schmerzes, den der Protagonist empfindet. Das Gedicht endet in einer Art mentaler Gefangenschaft, in der die Last der Existenz und der inneren Ängste erdrückend wirken.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.