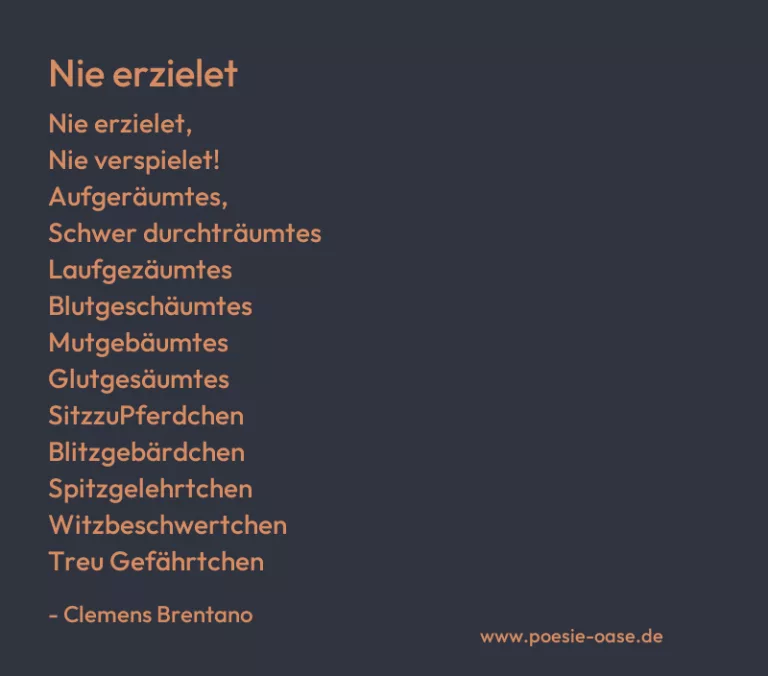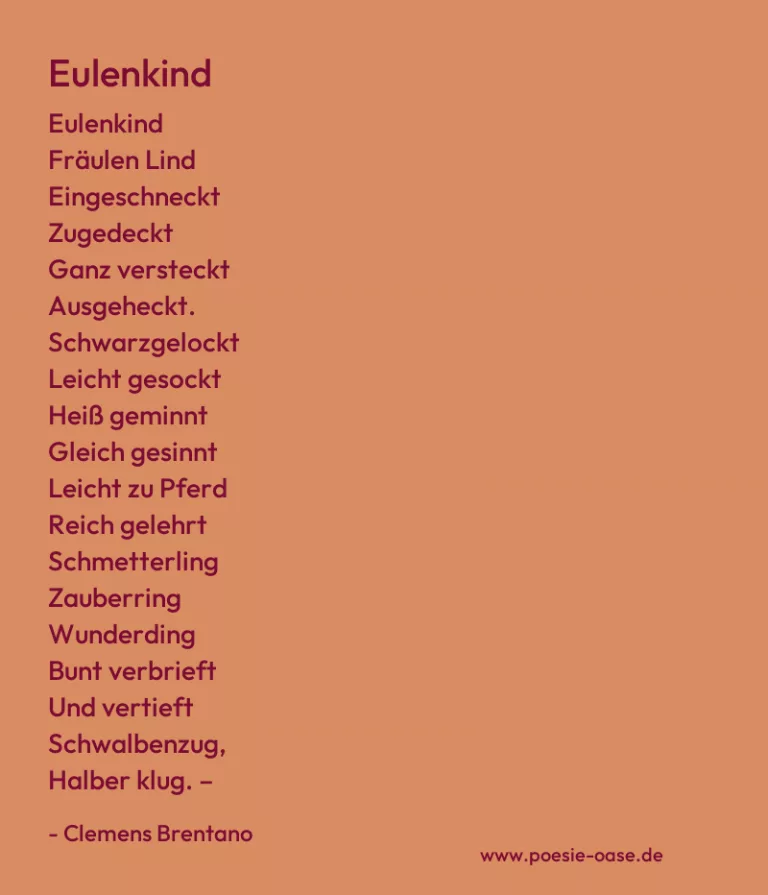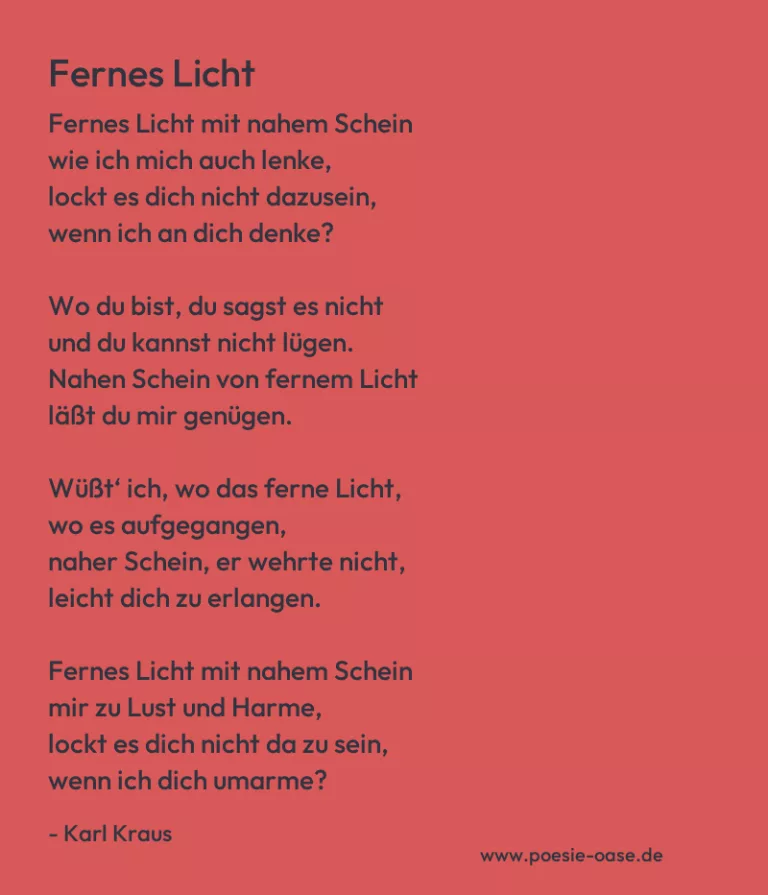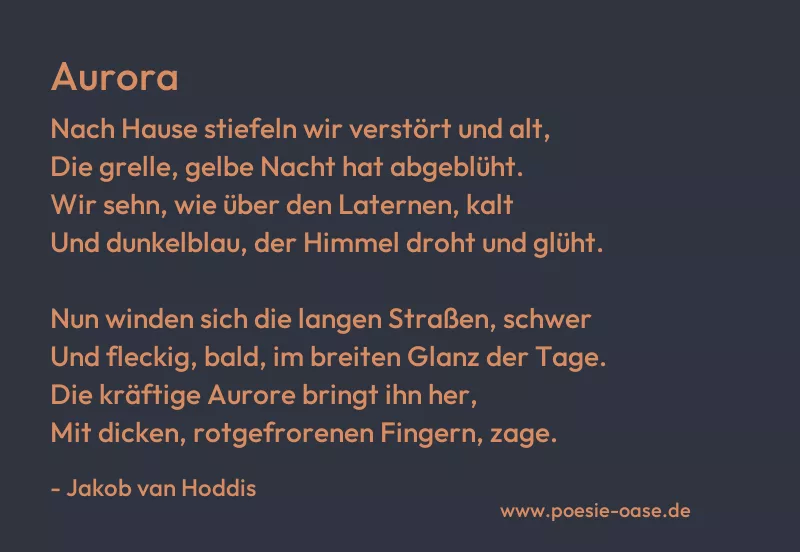Aurora
Nach Hause stiefeln wir verstört und alt,
Die grelle, gelbe Nacht hat abgeblüht.
Wir sehn, wie über den Laternen, kalt
Und dunkelblau, der Himmel droht und glüht.
Nun winden sich die langen Straßen, schwer
Und fleckig, bald, im breiten Glanz der Tage.
Die kräftige Aurore bringt ihn her,
Mit dicken, rotgefrorenen Fingern, zage.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
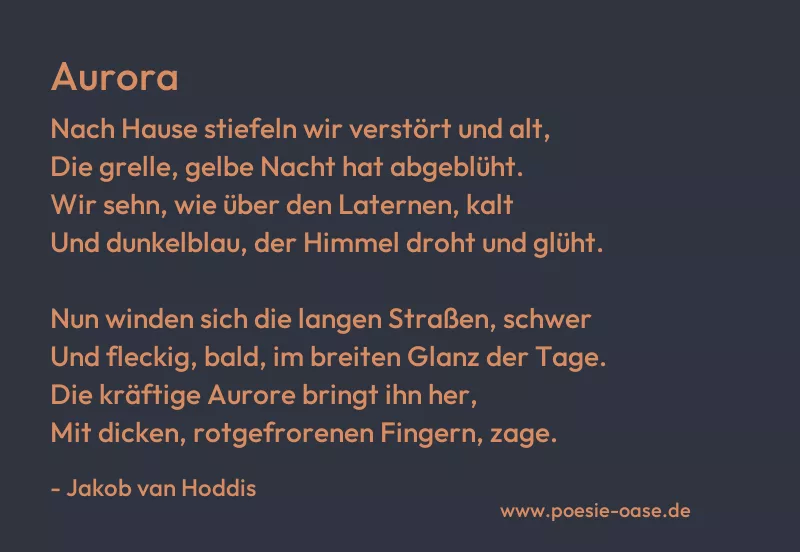
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Aurora“ von Jakob van Hoddis schildert in düsterer und resignierter Stimmung den Übergang von der Nacht zum Tag. Die „verstörten und alten“ Gestalten, die nach Hause „stiefeln“, wirken wie müde Nachtschwärmer oder Gestrandete im urbanen Raum, die von einer „grellen, gelben Nacht“ geprägt sind – einer Nacht, die nicht romantisch oder friedlich, sondern künstlich und unangenehm erscheint. Das „Abgeblühtsein“ der Nacht verweist auf Erschöpfung und Ernüchterung.
Im zweiten Verspaar wird die Kälte und Schwere der Szenerie noch verstärkt. Über den Straßen „droht und glüht“ der „dunkelblaue“ Himmel – ein Gegensatz zwischen abweisender Kälte und einer bedrückenden, glühenden Bedrohung. Der Morgen bringt keine Erleichterung, sondern erscheint unheimlich und fremd. Die „langen Straßen“ wirken „schwer und fleckig“ und nehmen unter dem Licht des beginnenden Tages eine unwirtliche, bedrückende Gestalt an.
Aurora, die Göttin der Morgenröte, erscheint hier als kräftige, aber zögerliche Gestalt: Mit „dicken, rotgefrorenen Fingern“ bringt sie den Tag. Die Beschreibung ist ungewöhnlich – Aurora wirkt nicht als himmlisches Lichtwesen, sondern als kraftlos und frostig. Ihre „zagende“ Erscheinung verleiht dem Tag eine trostlose Schwere, als sei das Licht selbst nur eine müde, kühle Eröffnung eines weiteren belastenden Tages.
„Aurora“ ist somit eine poetische Momentaufnahme des frühen Morgens, die mit expressionistischer Bildsprache eine urbane, depressive Atmosphäre erzeugt. Der Tag bringt hier keine Erneuerung, sondern verstärkt den Eindruck von Entfremdung und Tristesse im modernen Stadtleben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.