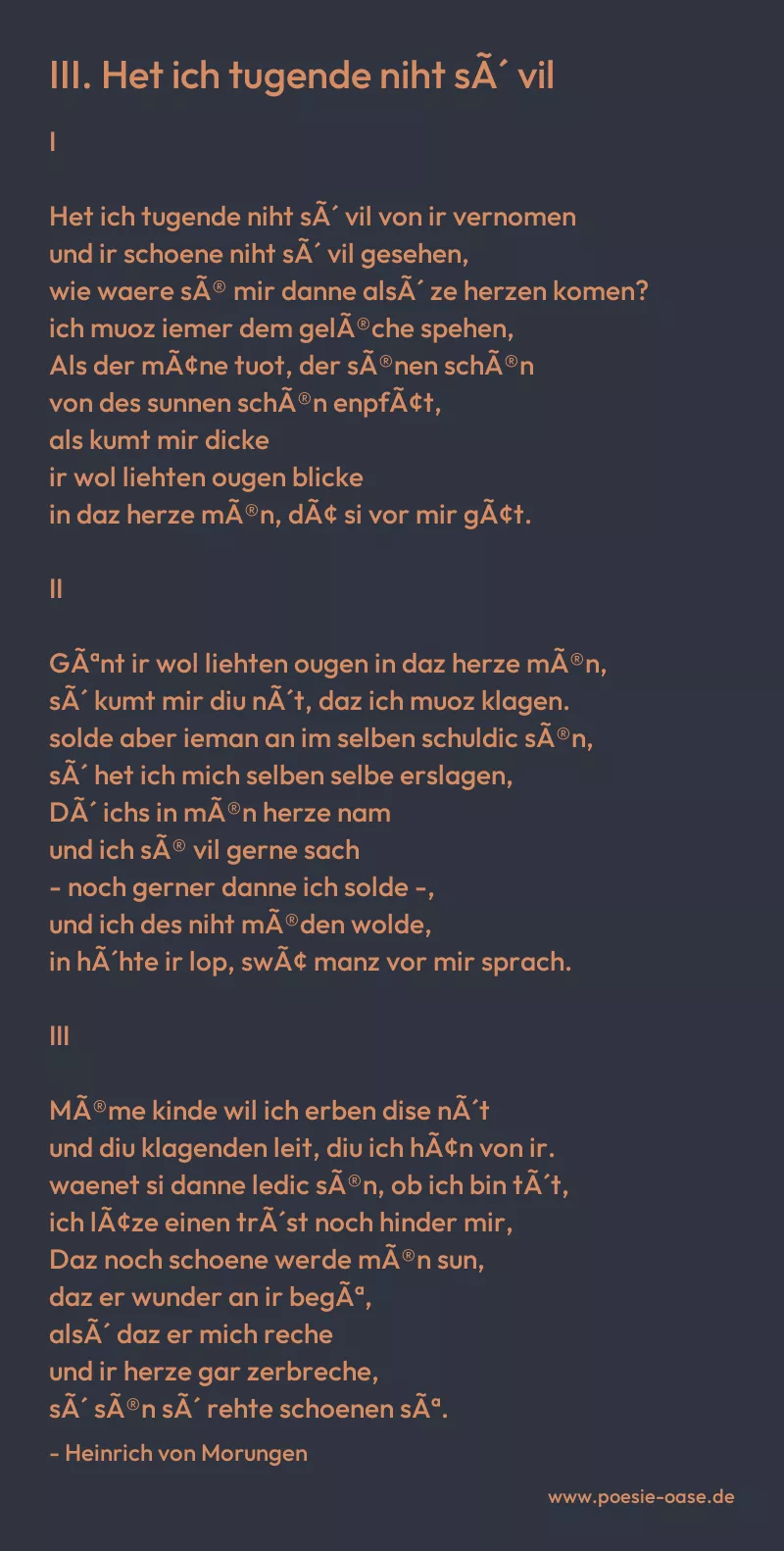III. Het ich tugende niht sô vil
I
Het ich tugende niht sô vil von ir vernomen
und ir schoene niht sô vil gesehen,
wie waere sî mir danne alsô ze herzen komen?
ich muoz iemer dem gelîche spehen,
Als der mâne tuot, der sînen schîn
von des sunnen schîn enpfât,
als kumt mir dicke
ir wol liehten ougen blicke
in daz herze mîn, dâ si vor mir gât.
II
Gênt ir wol liehten ougen in daz herze mîn,
sô kumt mir diu nôt, daz ich muoz klagen.
solde aber ieman an im selben schuldic sîn,
sô het ich mich selben selbe erslagen,
Dô ichs in mîn herze nam
und ich sî vil gerne sach
– noch gerner danne ich solde -,
und ich des niht mîden wolde,
in hôhte ir lop, swâ manz vor mir sprach.
III
Mîme kinde wil ich erben dise nôt
und diu klagenden leit, diu ich hân von ir.
waenet si danne ledic sîn, ob ich bin tôt,
ich lâze einen trôst noch hinder mir,
Daz noch schoene werde mîn sun,
daz er wunder an ir begê,
alsô daz er mich reche
und ir herze gar zerbreche,
sô sîn sô rehte schoenen sê.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
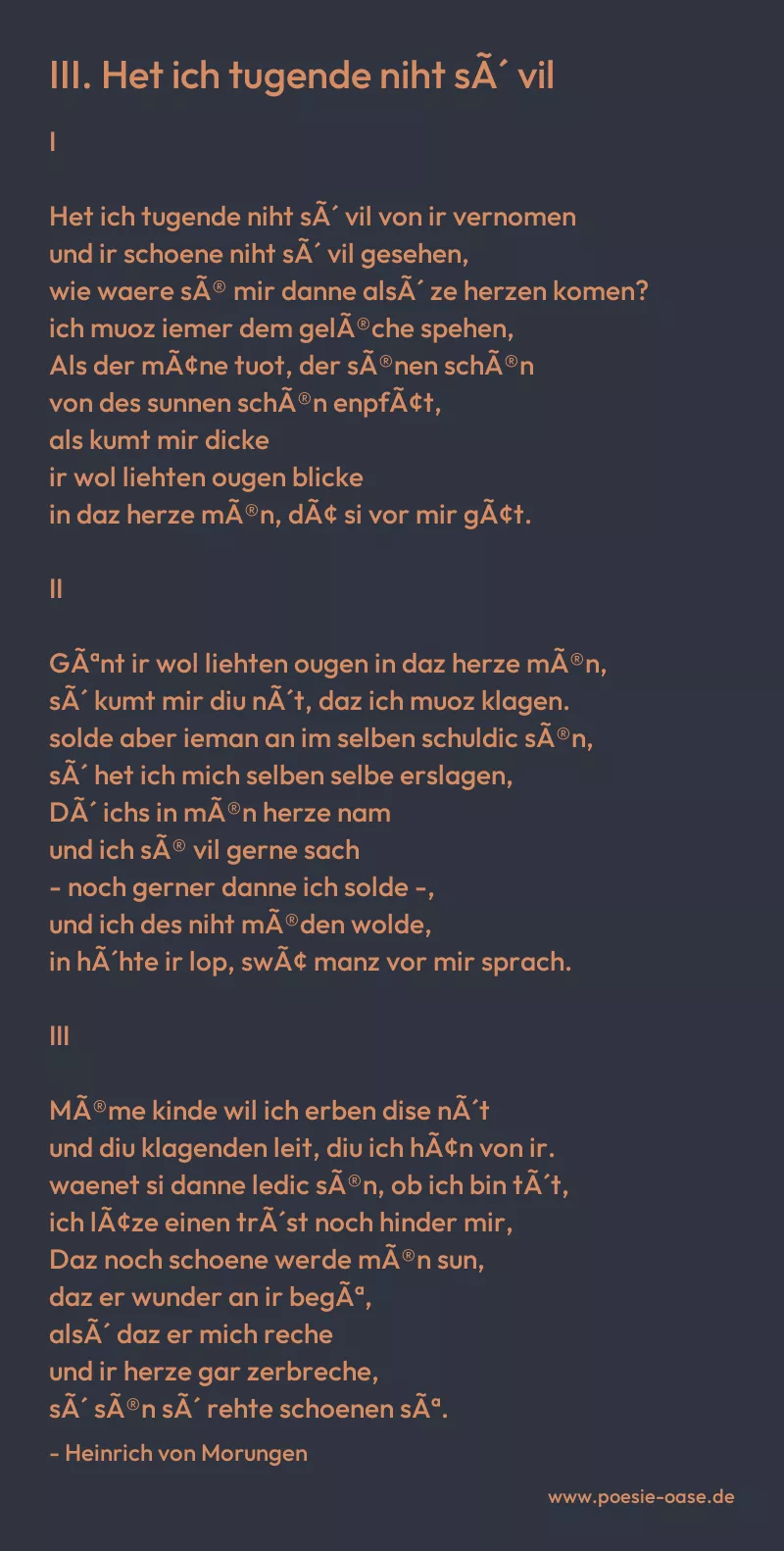
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „III. Het ich tugende niht sô vil“ von Heinrich von Morungen ist eine Minnelied, das von der unerwiderten Liebe des Sprechers zu einer geliebten Dame handelt. In drei Strophen entfaltet sich die Geschichte seiner Liebe, von der anfänglichen Bewunderung bis hin zur verzweifelten Hoffnung auf Rache durch seinen Sohn.
In der ersten Strophe drückt der Sprecher seine Faszination für die Dame aus. Seine Liebe basiert auf der Schönheit und den Tugenden, von denen er gehört hat und die er gesehen hat. Er vergleicht seine Reaktion mit dem Mond, der sein Licht von der Sonne empfängt – eine Metapher, die seine Abhängigkeit von der geliebten Person und seine Verehrung für sie verdeutlicht. Er betont die Macht ihres Blickes, der sein Herz berührt, sobald sie sich ihm nähert. Diese Strophe etabliert die Intensität seiner Gefühle und die Ursache seiner Liebe: die Schönheit und Tugend der Dame.
Die zweite Strophe beschreibt die Qualen, die die unerwiderte Liebe mit sich bringt. Der Sprecher beklagt sein Leid und die Not, die er durch die Liebe erfährt. Er hinterfragt sogar, ob er selbst Schuld an seinem Unglück trägt, und deutet auf eine gewisse Selbstzerstörung hin. Die Zeilen „ich muoz iemer dem gelîche spehen / Als der mâne tuot, der sînen schîn / von des sunnen schîn enpfât“ zeigen, dass die Liebe des Sprechers ein schmerzhaftes, fast obsessives Verlangen ist. Trotz der Schmerzen gesteht er, dass er die Schönheit der Dame „noch gerner danne ich solde“ sah und sich der Liebe nicht entziehen konnte.
Die letzte Strophe offenbart den Höhepunkt der Verzweiflung. Der Sprecher wünscht, dass sein Kind das gleiche Leid erben soll, das er durch die Liebe erfährt. Dieser Wunsch nach Rache ist ein Zeichen seiner tiefen Verletzlichkeit und des Unvermögens, mit der Situation umzugehen. Er hofft, dass sein Sohn die Dame ebenso sehr lieben und ihr Herz brechen wird, um ihn zu rächen. Dies ist ein drastischer Ausdruck der Verzweiflung und des Wunschs nach Wiedergutmachung, ein düsteres Ende für ein Liebeslied, das von Bewunderung und Sehnsucht beginnt. Das Gedicht endet also mit einer tragischen Note, indem es die Zerrissenheit und die zerstörerischen Auswirkungen unerwiderter Liebe offenbart.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.