Ich bin der reichste Mann der Welt! // Meine silber-
nen Yachten / schwimmen auf allen Meeren. // Gold-
ne Villen glitzern durch meine Wälder in Japan, / in
himmelhohen Alpenseeen spiegeln sich meine Schlös-
ser, / auf tausend Inseln hängen meine purpurnen Gär-
ten. // Ich beachte sie kaum. // An ihren aus Bronze
gewundenen Schlangengittern / geh ich vorbei, / über
meine Diamantgruben / lass ich die Lämmer grasen. //
Die Sonne scheint, / ein Vogel singt, / ich bücke
mich / und pflücke eine kleine Wiesenblume. // Und
plötzlich weiss ich: ich bin der ärmste Bettler! // Ein
Nichts ist meine ganze Herrlichkeit / vor diesem
Thautropfen, / der in der Sonne funkelt.
Ich bin der reichste Mann der Welt
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
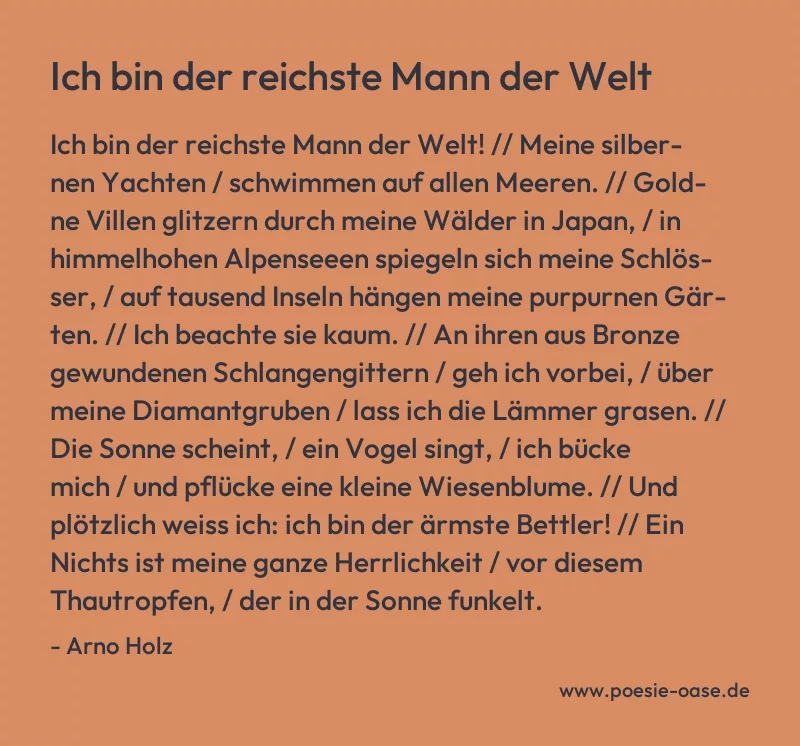
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich bin der reichste Mann der Welt“ von Arno Holz ist eine paradoxe Auseinandersetzung mit Reichtum und dem wahren Wert des Lebens. Der erste Teil des Gedichts strotzt vor protzigen Bildern von materiellem Überfluss: silberne Yachten, goldene Villen, Schlösser, purpurne Gärten. Der Sprecher positioniert sich als Inbegriff des Wohlstands, als jemand, der über unermesslichen Besitz verfügt. Die Aufzählung der Reichtümer dient nicht nur der Überhöhung, sondern auch der Entwertung. Der Sprecher „beachtet sie kaum“, geht an ihnen vorbei, lässt die Lämmer über seinen Diamantgruben grasen. Dies deutet bereits eine innere Leere an, eine Unfähigkeit, wirkliche Freude an seinem Besitz zu finden.
Die Wendung vollzieht sich abrupt und unerwartet. Die Beschreibung einer idyllischen Szene – die Sonne scheint, ein Vogel singt – wird zum Auslöser einer tiefgreifenden Erkenntnis. Die scheinbare Beiläufigkeit, mit der der Sprecher sich bückt und eine Wiesenblume pflückt, ist von entscheidender Bedeutung. Sie lenkt seinen Blick weg von den „silbernen Yachten“ und „goldenen Villen“ hin zur unaufdringlichen Schönheit der Natur. In diesem Moment der Einfachheit und der unmittelbaren Erfahrung der Welt erkennt er seine wahre Armut.
Die Gegenüberstellung von materiellem Reichtum und der Wertlosigkeit dieses Reichtums im Angesicht eines simplen Naturwunders bildet den Kern der Aussage. Die „ganze Herrlichkeit“ des Besitzes wird durch den „Thautropfen“ in der Sonne, der funkelt, in den Schatten gestellt. Der Thautropfen symbolisiert die Vergänglichkeit, die Unverfälschtheit und die unendliche Schönheit des Natürlichen. Im Gegensatz dazu steht der Reichtum, der als künstlich und vergänglich entlarvt wird. Der Sprecher, der sich zuvor als reichster Mann der Welt bezeichnete, identifiziert sich nun als „ärmster Bettler“.
Das Gedicht ist also eine Kritik am materialistischen Denken und eine Hommage an die Einfachheit und die Schönheit der Natur. Es zeigt, dass wahrer Reichtum nicht in Besitz, sondern in der Fähigkeit liegt, die kleinen, unscheinbaren Wunder des Lebens wahrzunehmen und zu schätzen. Die plötzliche Erkenntnis des Sprechers deutet auf eine tiefere Sehnsucht nach Erfüllung hin, die durch materiellen Wohlstand allein nicht gestillt werden kann. Die abschließenden Zeilen sind ein Plädoyer für eine Wertschätzung, die über das Sichtbare hinausgeht und die wahren Schätze des Lebens, wie etwa die flüchtige Schönheit eines Thautropfens, erfasst.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
