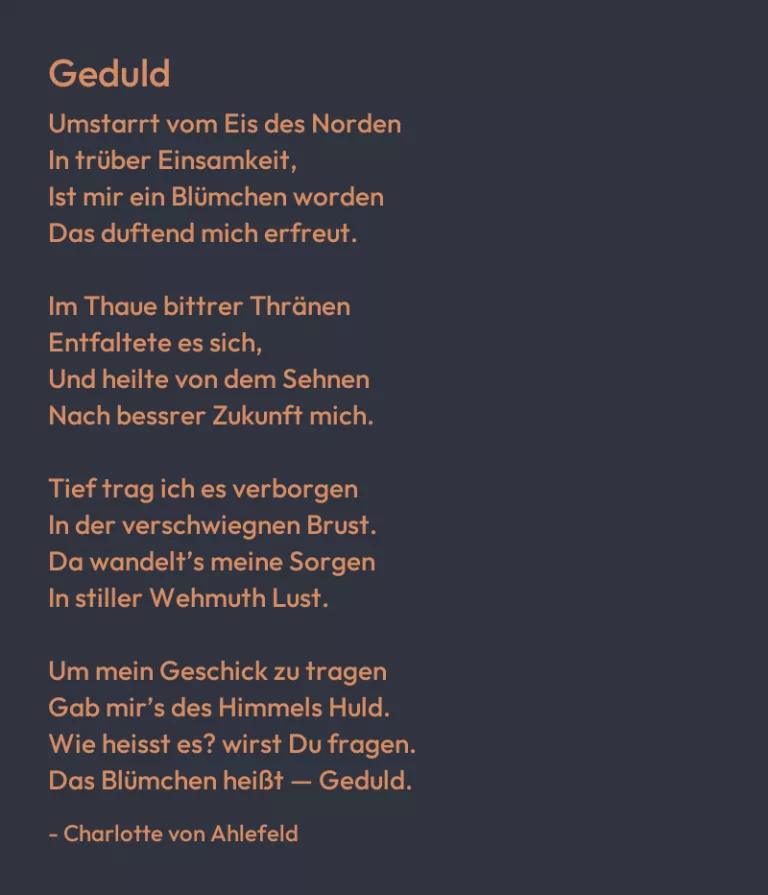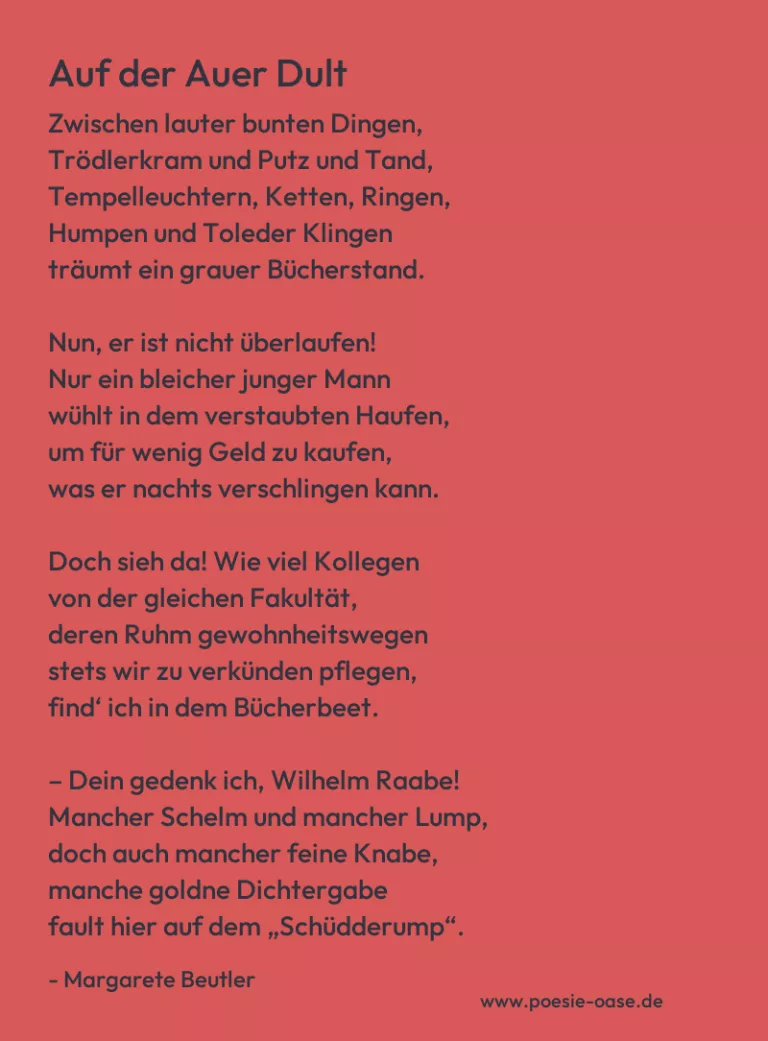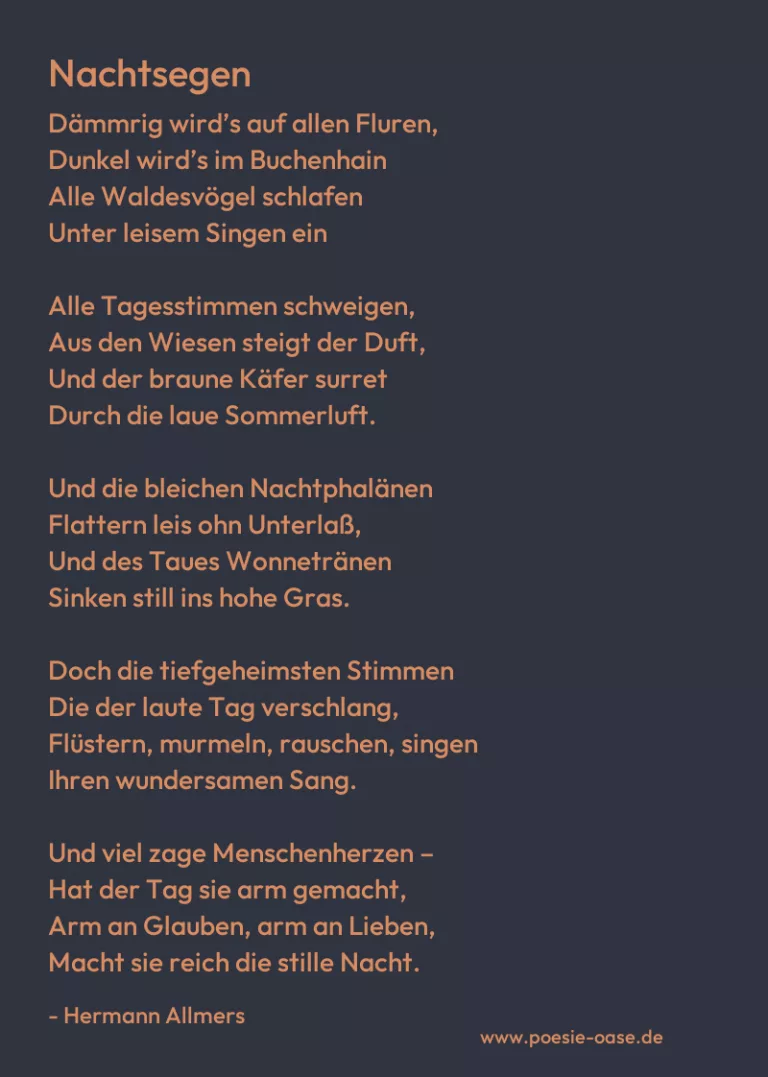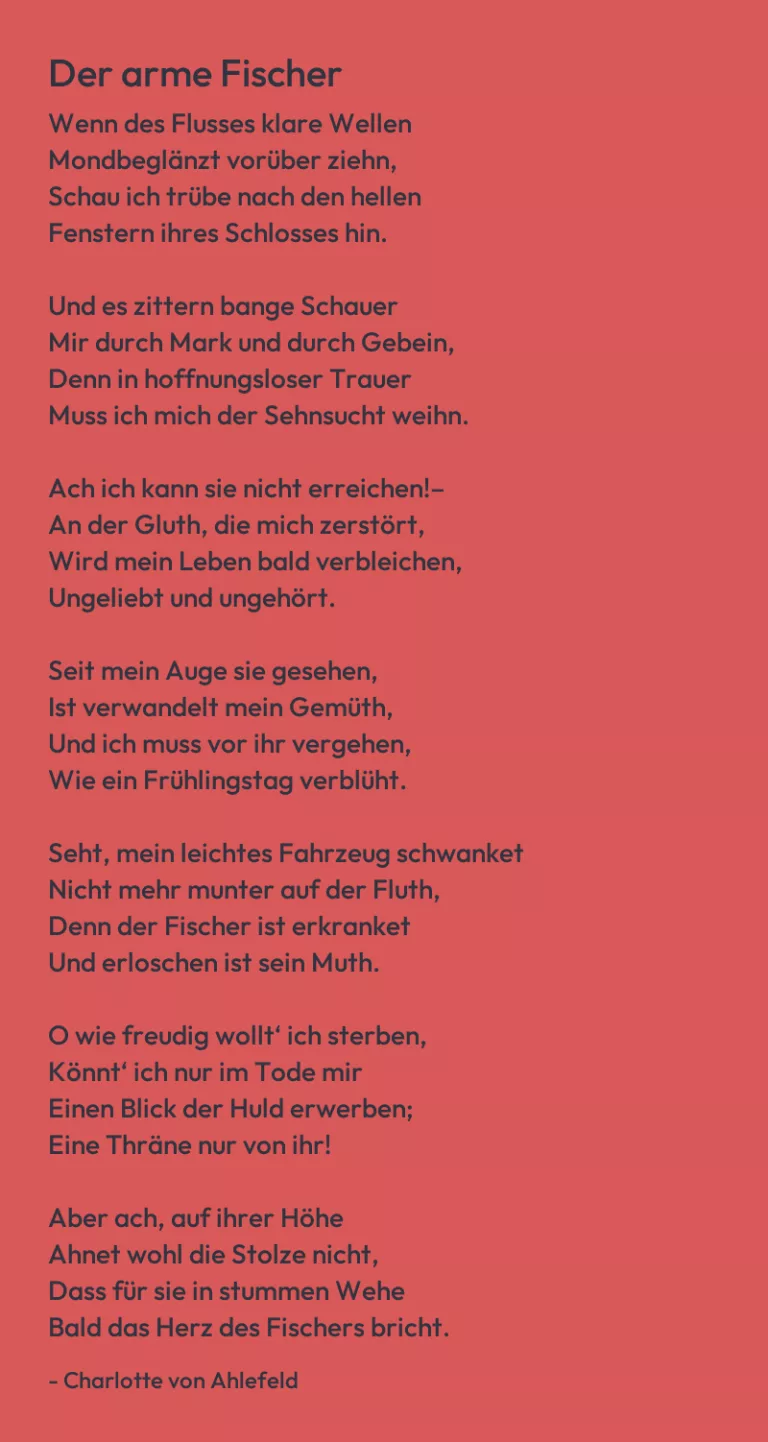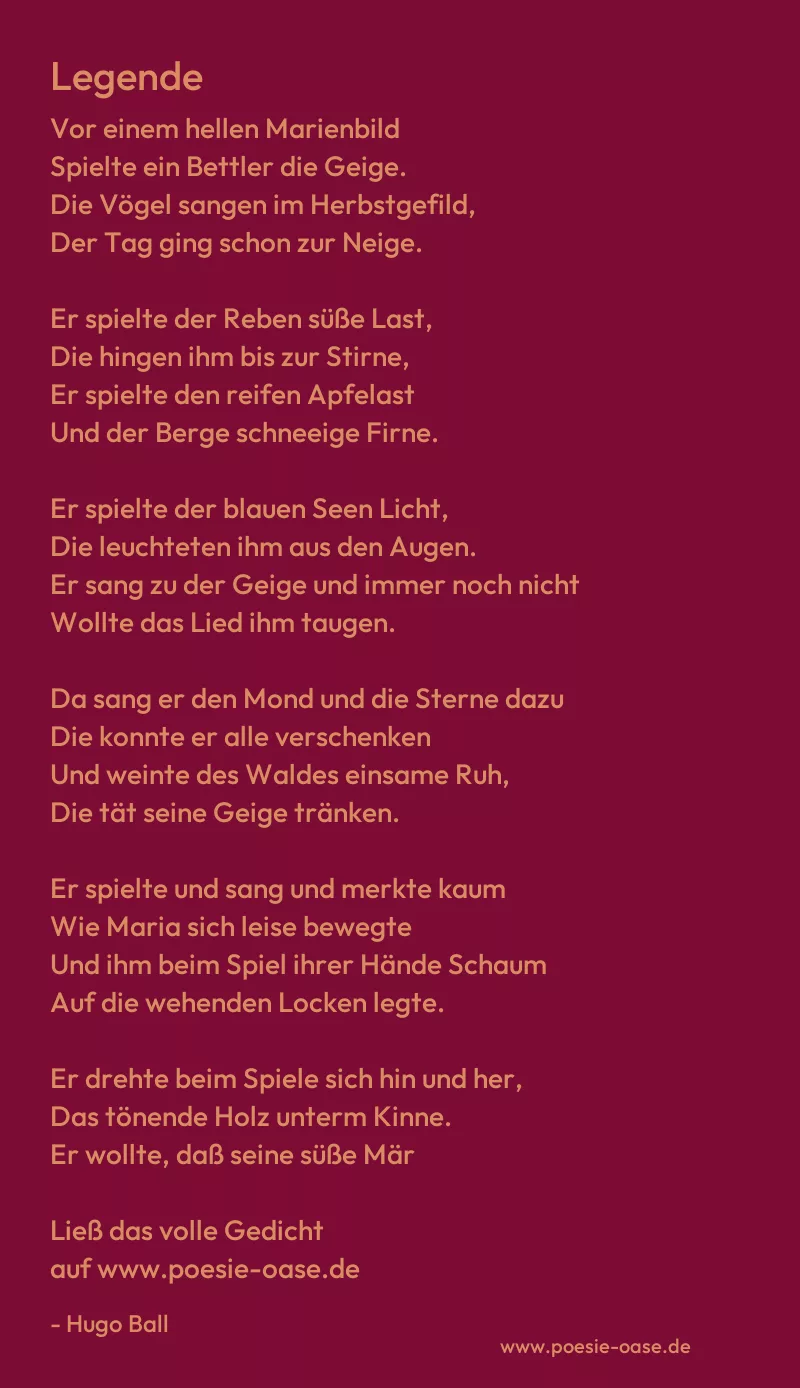Legende
Vor einem hellen Marienbild
Spielte ein Bettler die Geige.
Die Vögel sangen im Herbstgefild,
Der Tag ging schon zur Neige.
Er spielte der Reben süße Last,
Die hingen ihm bis zur Stirne,
Er spielte den reifen Apfelast
Und der Berge schneeige Firne.
Er spielte der blauen Seen Licht,
Die leuchteten ihm aus den Augen.
Er sang zu der Geige und immer noch nicht
Wollte das Lied ihm taugen.
Da sang er den Mond und die Sterne dazu
Die konnte er alle verschenken
Und weinte des Waldes einsame Ruh,
Die tät seine Geige tränken.
Er spielte und sang und merkte kaum
Wie Maria sich leise bewegte
Und ihm beim Spiel ihrer Hände Schaum
Auf die wehenden Locken legte.
Er drehte beim Spiele sich hin und her,
Das tönende Holz unterm Kinne.
Er wollte, daß seine süße Mär
In alle vier Winde zerrinne.
Da stieg die Madonna vom Sockel herab
Und folgte ihm auf seine Wege.
Die gingen bergauf und gingen bergab
Durch Gestrüpp und Dornengehege.
Er spielte noch, als schon der Hahn gekräht
Und manche Saite zersprungen.
Auf Dreien spielt er die Trinität
Auf zweien die Engelszungen.
Zuletzt war es nur noch das heimliche Lied
Vom eingeborenen Sohne.
Maria deckte den Mantel auf ihn
Darin schläft er zum ewigen Lohne.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
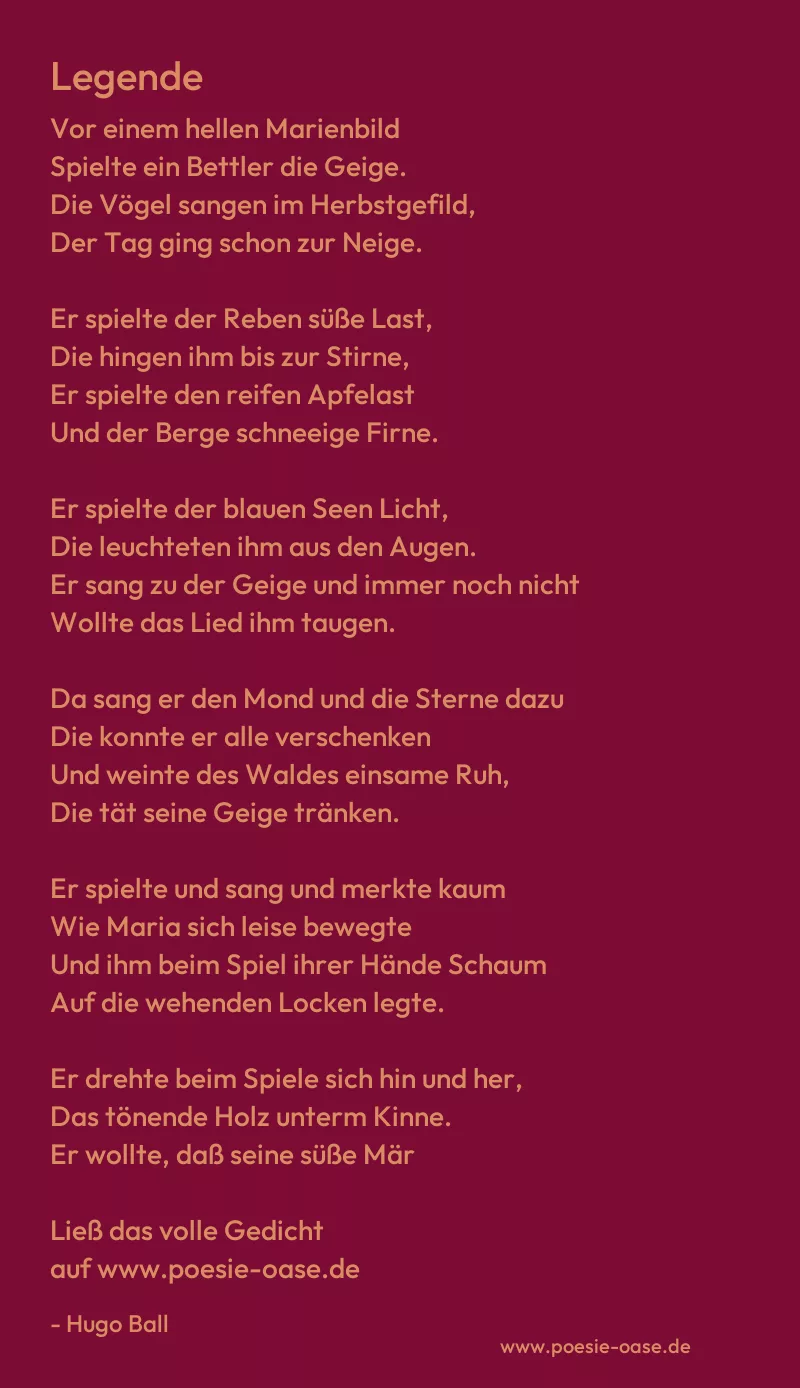
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Legende“ von Hugo Ball ist eine poetisch-mystische Erzählung, die in der Form einer Ballade das Wirken von Kunst, Hingabe und göttlicher Gnade thematisiert. Im Zentrum steht ein Bettler, der mit seiner Geige vor einem Marienbild spielt – eine Figur, die Armut, Demut und künstlerische Inspiration in sich vereint. Ball verbindet christliche Symbolik mit einer tiefen Spiritualität, die nicht auf Dogma, sondern auf innerer Bewegung und künstlerischem Ausdruck beruht.
In den ersten Strophen entfaltet sich eine Szene in spätherbstlicher Natur: Der Tag neigt sich dem Ende zu, die Welt steht im Zeichen des Vergehens, doch der Bettler bringt mit seiner Geige all das Schöne der Schöpfung zum Klingen – Reben, Äpfel, Schneeberge, Seen. Die Musik wird hier zur sinnlichen Übersetzung der Welt. Doch der Musiker ist nicht zufrieden: „immer noch nicht / Wollte das Lied ihm taugen“. Es ist eine Unruhe, ein Suchen spürbar – das Streben nach einem Lied, das die Welt nicht nur abbildet, sondern durchdringt.
Die Musik steigert sich zur Beschwörung: Der Bettler spielt und singt den Mond, die Sterne, die Einsamkeit des Waldes. Die Natur wird nicht nur dargestellt, sondern transformiert – sie wird verschenkt, beweint, durchdrungen. In diesem Moment der höchsten inneren Bewegung geschieht das Wunder: Die Madonna beginnt sich zu bewegen, legt ihre segnenden Hände auf den Musiker. Dies ist der Wendepunkt des Gedichts – das Transzendente antwortet auf die künstlerische Ekstase.
Die folgenden Strophen erzählen, wie die Madonna ihm folgt – ein Bild für göttliche Nähe, vielleicht sogar Erwählung. Der Musiker aber bleibt in seiner Bewegung, sein Spiel führt ihn durch Höhen und Tiefen, durch „Gestrüpp und Dornengehege“. Diese Bilder erinnern an das Pilgerhafte, Leidvolle menschlicher Existenz, aber auch an den Weg der Erlösung. Die Geige wird zum heiligen Werkzeug: Auf drei Saiten spielt er die „Trinität“, auf zweien die „Engelszungen“. Selbst im Verfall des Instruments bleibt der Klang – als innerstes, „heimliches Lied vom eingeborenen Sohne“.
Das Gedicht endet mit einer ruhigen Erlösung: Maria breitet ihren Mantel über ihn aus – ein traditionelles Marienbild für Schutz, Trost und Gnade. Der Musiker schläft „zum ewigen Lohne“, nicht als Strafe, sondern als Anerkennung seines Weges. Seine Kunst, seine Hingabe, sein Leiden haben ihn erlöst.
„Legende“ ist damit eine tief religiös gefärbte Dichtung, in der Kunst als Weg zu Gott erscheint. Hugo Ball, der selbst in mystischer Religiosität verankert war, verwebt hier christliche Motive mit expressionistischer Bildkraft und feiner Musikalität. Der Bettler wird zur Verkörperung des suchenden, schaffenden Menschen, der durch Schönheit und Leid zu einer höheren Wahrheit gelangt – und schließlich Aufnahme in das Göttliche findet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.