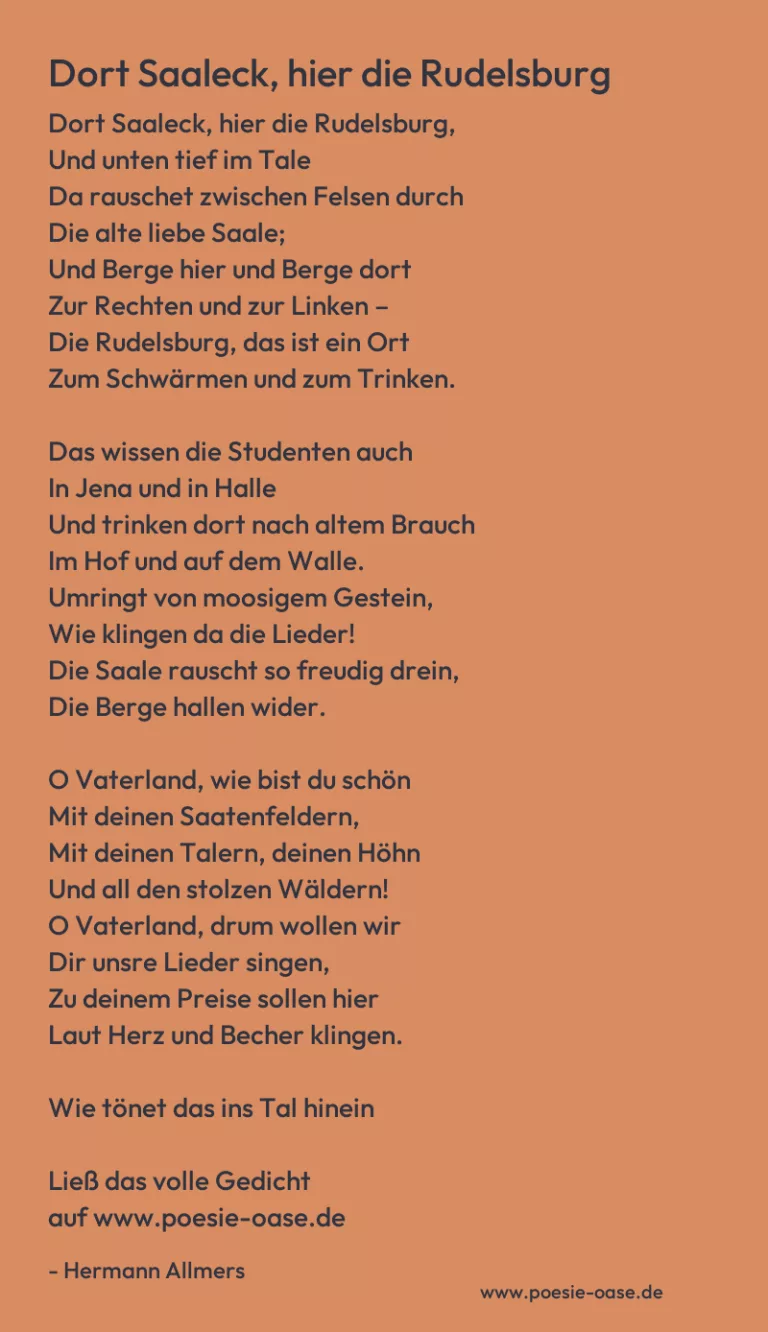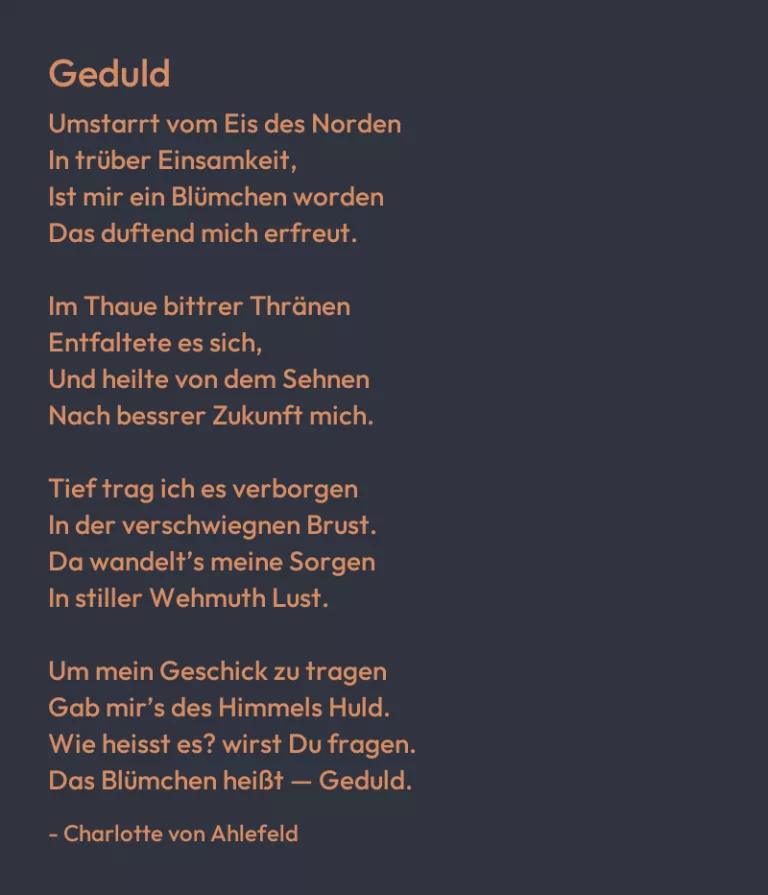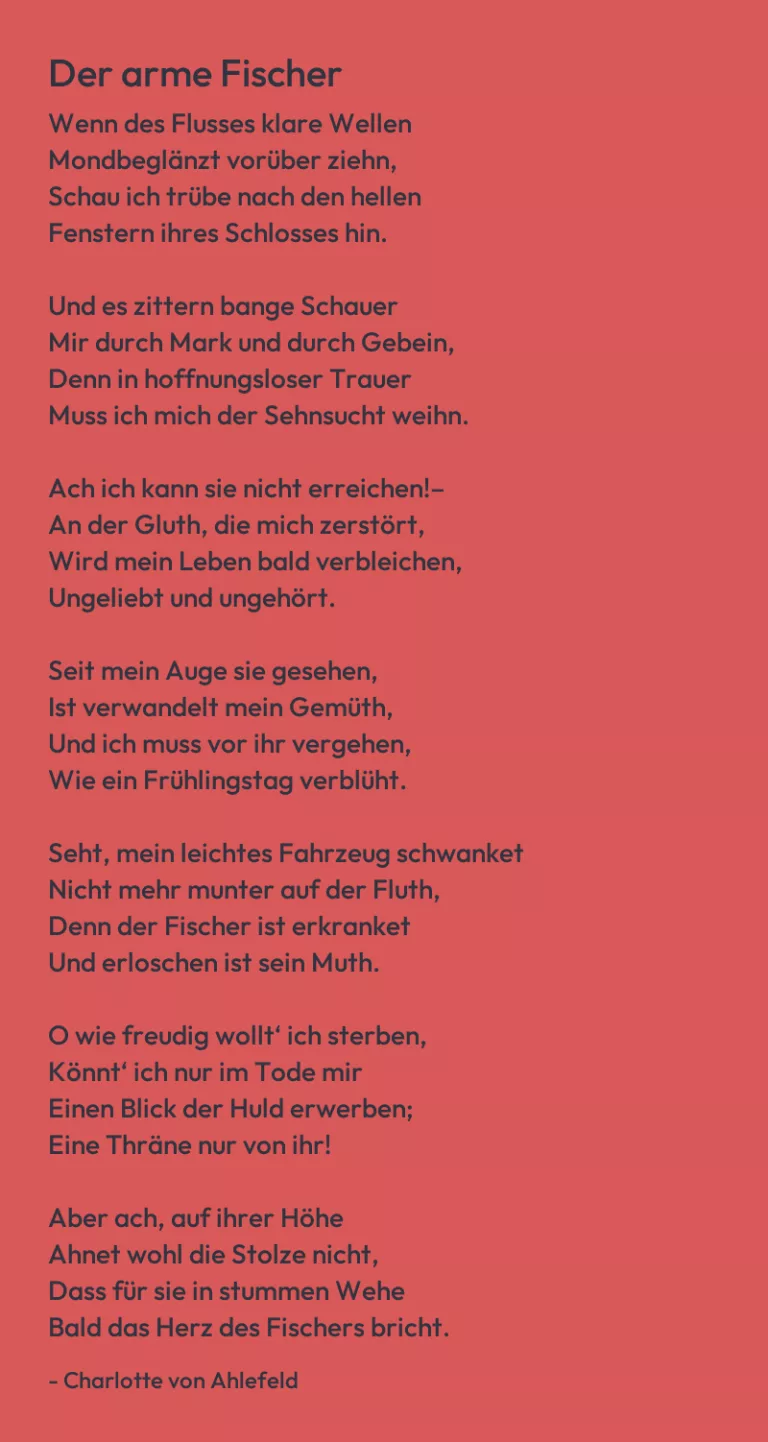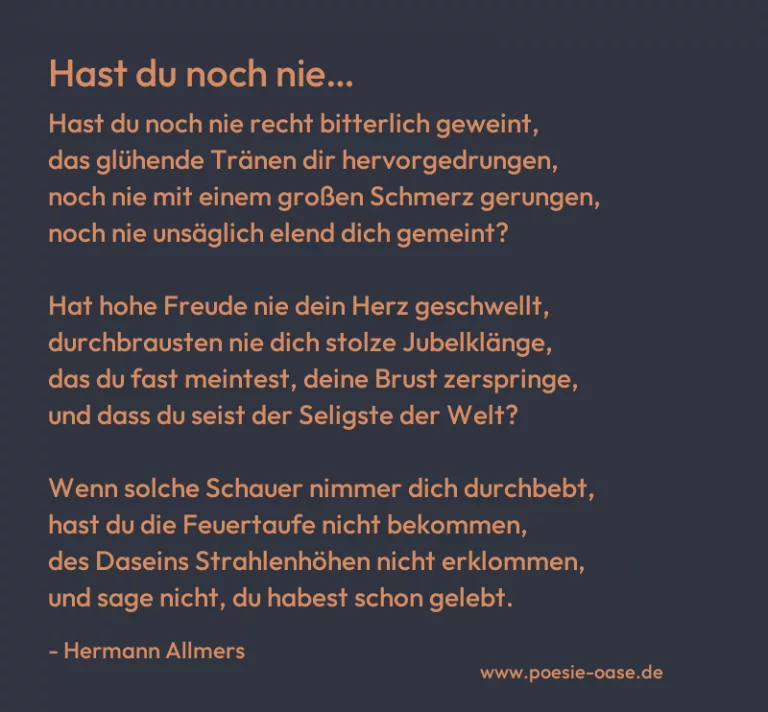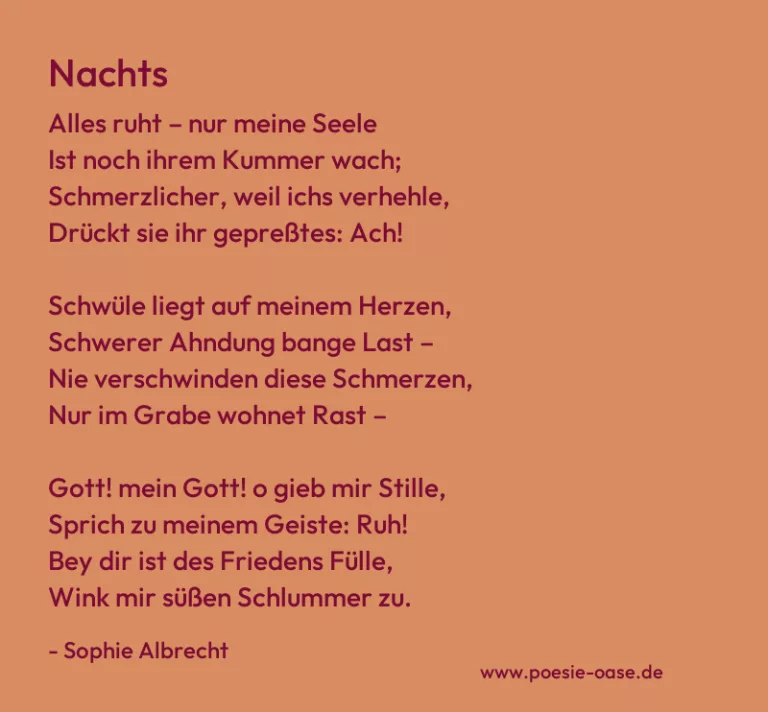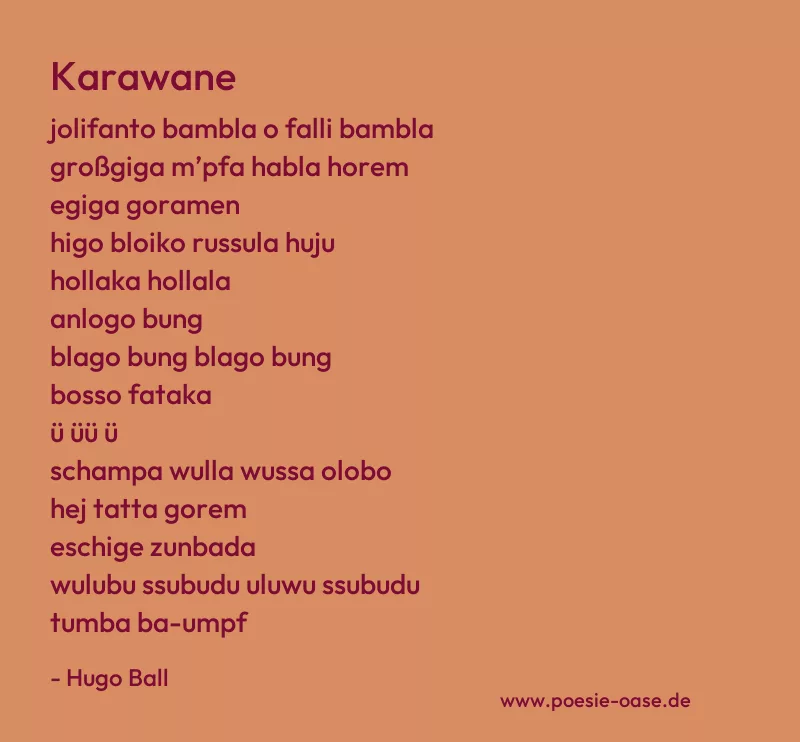Karawane
jolifanto bambla o falli bambla
großgiga m’pfa habla horem
egiga goramen
higo bloiko russula huju
hollaka hollala
anlogo bung
blago bung blago bung
bosso fataka
ü üü ü
schampa wulla wussa olobo
hej tatta gorem
eschige zunbada
wulubu ssubudu uluwu ssubudu
tumba ba-umpf
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
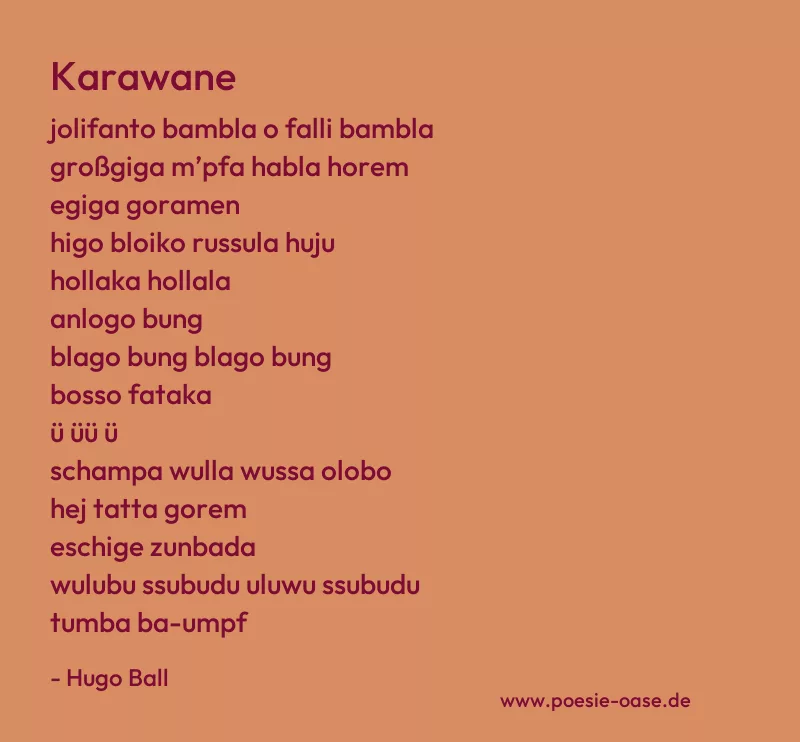
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Karawane“ von Hugo Ball ist ein klassisches Beispiel für die Lautpoesie des Dadaismus. Der Text besteht fast ausschließlich aus scheinbar willkürlichen und bedeutungslosen Silben, die keinen klaren sprachlichen Inhalt vermitteln. Diese Art der Poesie zielt darauf ab, den Klang der Wörter und die rhythmische Wirkung der Sprache zu betonen, anstatt konkrete Bedeutungen zu übermitteln. Der Dadaismus strebte nach einer Abkehr von traditionellen Kunstformen und versuchte, die Regeln der Sprache und der Logik zu durchbrechen.
Obwohl der Text keine klare Bedeutung hat, kann er als eine Art „Schrei“ oder Ausdruck von Freiheit und Chaos verstanden werden. Die scheinbar zufälligen Lautfolgen erzeugen eine visuelle und akustische Energie, die den Leser oder Zuhörer aus der gewohnten Sprachstruktur herausführt. Der wiederholte Einsatz von Lauten wie „blago bung“ und „wulubu ssubudu“ verstärkt den Rhythmus und den Klang, wodurch eine Art primitive, fast tranceartige Atmosphäre entsteht. Diese Lautmalerei lässt sich als Ausdruck des Irrationalen und des Unbewussten deuten, das der Dadaismus zu erforschen versuchte.
In seiner Abstraktion kann „Karawane“ auch als ein Kommentar auf die Entfremdung und den Verlust der Bedeutung in der modernen Welt verstanden werden. Die Sprache wird hier von ihren traditionellen Kommunikationsfunktionen befreit und zu einem Mittel, das nur noch den Klang und die emotionale Wirkung der Worte vermittelt. Der Dadaismus kritisierte die moderne Gesellschaft, die er als rational und mechanisch betrachtete, und versuchte, diese Rationalität mit einer „irrationalen“ Kunst zu untergraben. In diesem Kontext könnte „Karawane“ als ein radikaler Versuch interpretiert werden, die Begrenzungen und Zwänge der traditionellen Sprache zu überwinden.
Insgesamt ist „Karawane“ ein Beispiel für die dadaistische Kunstform, die sich der Bedeutung und Logik der Sprache entzieht, um stattdessen die ästhetischen und emotionalen Aspekte des Klangs und der Form zu betonen. Das Gedicht ist eine feierliche Zerstörung der traditionellen Sprachordnung und ein Aufruf zur Freiheit der Ausdrucksweise, der im Dadaismus seine volle Entfaltung fand.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.