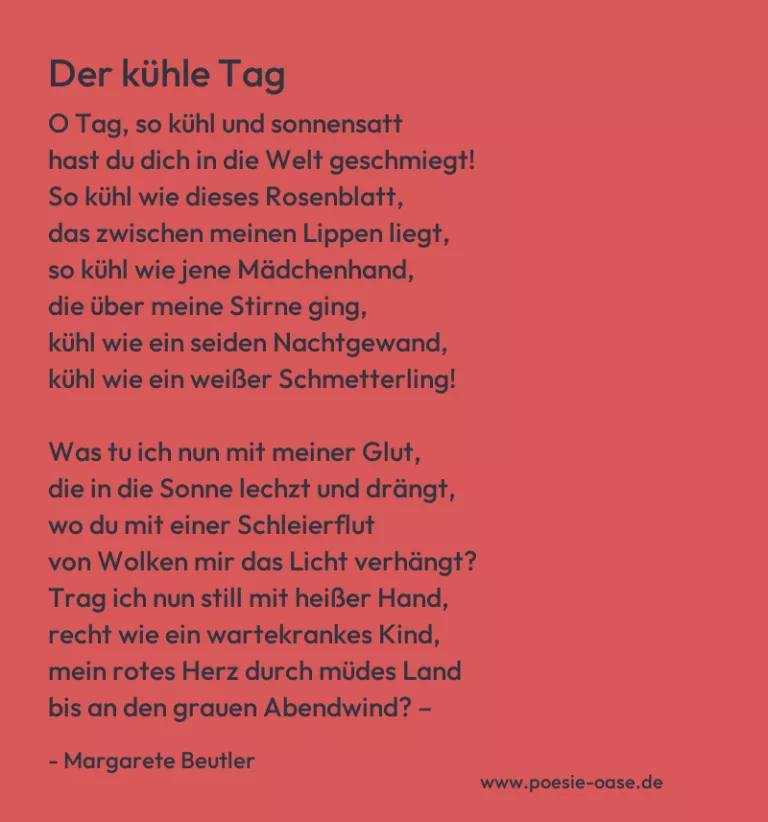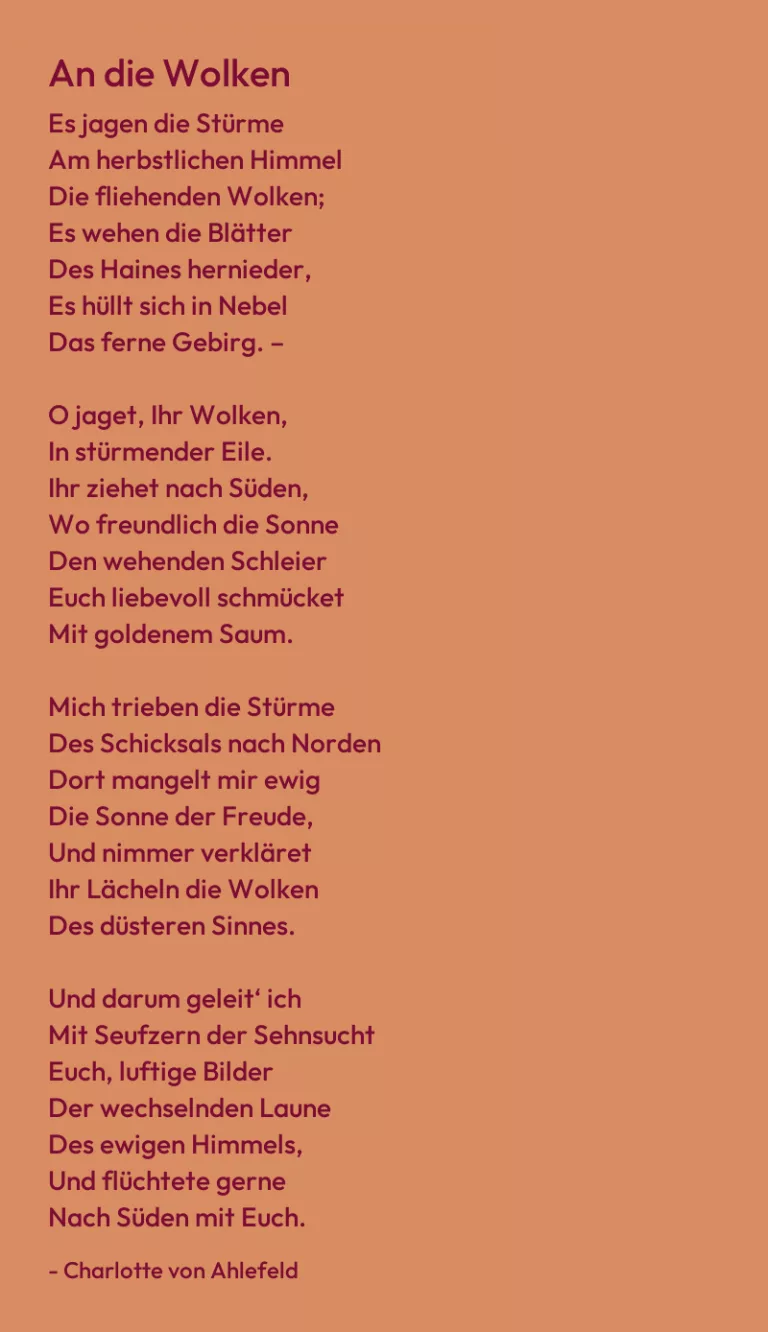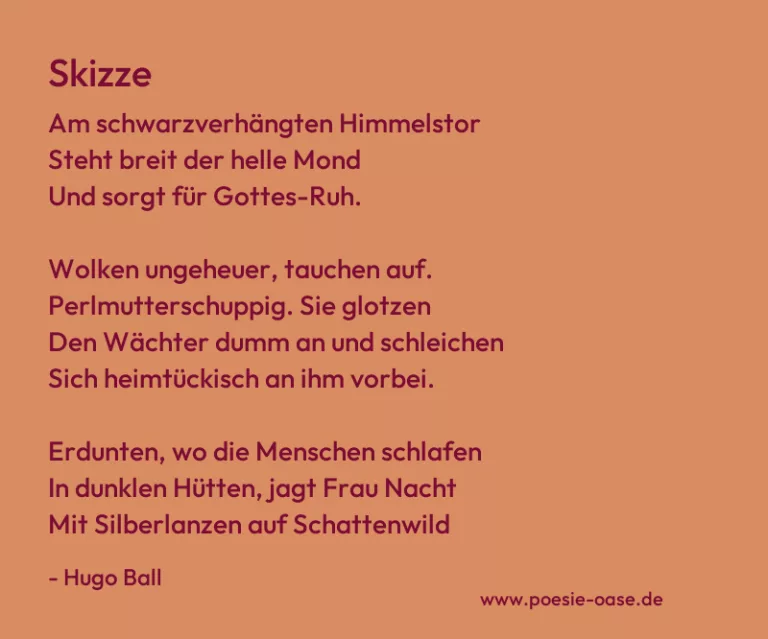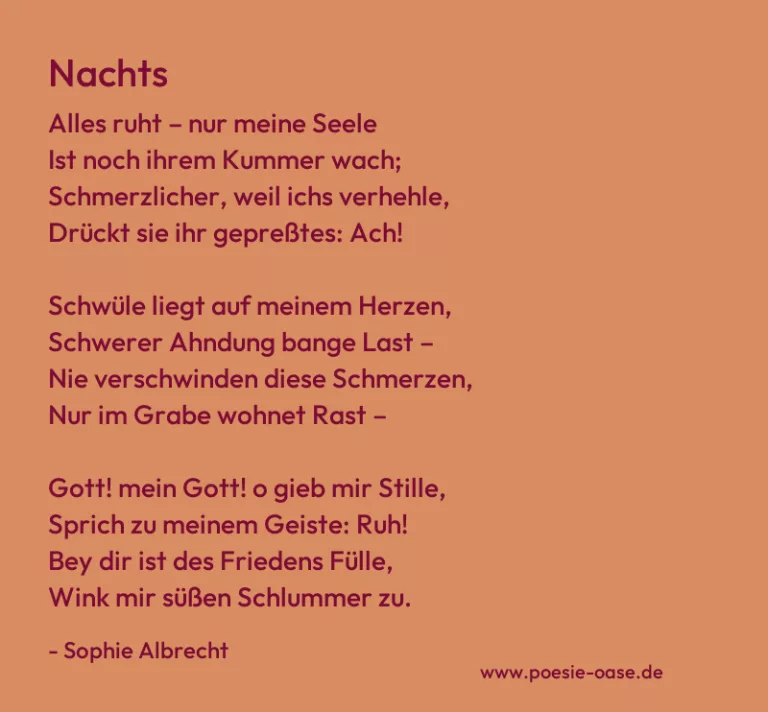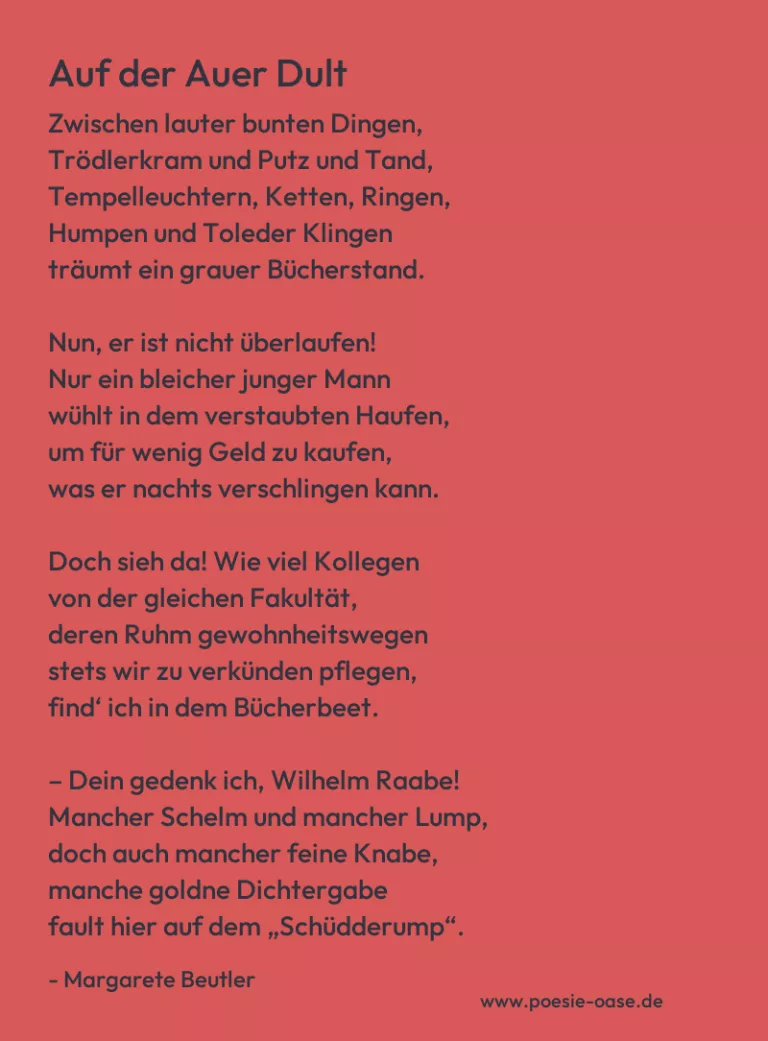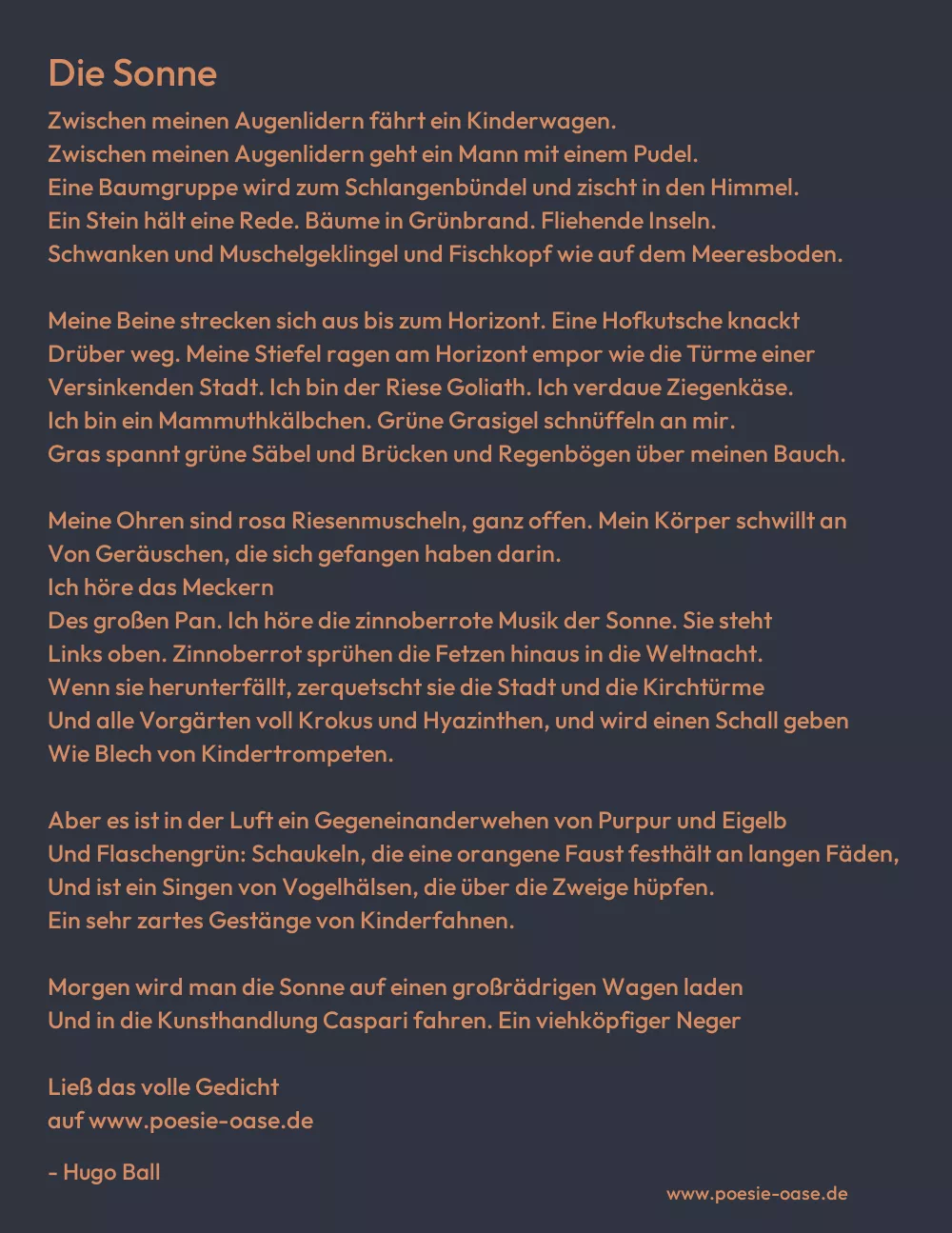Zwischen meinen Augenlidern fährt ein Kinderwagen.
Zwischen meinen Augenlidern geht ein Mann mit einem Pudel.
Eine Baumgruppe wird zum Schlangenbündel und zischt in den Himmel.
Ein Stein hält eine Rede. Bäume in Grünbrand. Fliehende Inseln.
Schwanken und Muschelgeklingel und Fischkopf wie auf dem Meeresboden.
Meine Beine strecken sich aus bis zum Horizont. Eine Hofkutsche knackt
Drüber weg. Meine Stiefel ragen am Horizont empor wie die Türme einer
Versinkenden Stadt. Ich bin der Riese Goliath. Ich verdaue Ziegenkäse.
Ich bin ein Mammuthkälbchen. Grüne Grasigel schnüffeln an mir.
Gras spannt grüne Säbel und Brücken und Regenbögen über meinen Bauch.
Meine Ohren sind rosa Riesenmuscheln, ganz offen. Mein Körper schwillt an
Von Geräuschen, die sich gefangen haben darin.
Ich höre das Meckern
Des großen Pan. Ich höre die zinnoberrote Musik der Sonne. Sie steht
Links oben. Zinnoberrot sprühen die Fetzen hinaus in die Weltnacht.
Wenn sie herunterfällt, zerquetscht sie die Stadt und die Kirchtürme
Und alle Vorgärten voll Krokus und Hyazinthen, und wird einen Schall geben
Wie Blech von Kindertrompeten.
Aber es ist in der Luft ein Gegeneinanderwehen von Purpur und Eigelb
Und Flaschengrün: Schaukeln, die eine orangene Faust festhält an langen Fäden,
Und ist ein Singen von Vogelhälsen, die über die Zweige hüpfen.
Ein sehr zartes Gestänge von Kinderfahnen.
Morgen wird man die Sonne auf einen großrädrigen Wagen laden
Und in die Kunsthandlung Caspari fahren. Ein viehköpfiger Neger
Mit wulstigein Nacken, Blähnase und breitem Schritt wird fünfzig weiß-
Juckende Esel halten, die vor den Wagen gespannt sind beim Pyramidenbau.
Eine Menge blutbunten Volks wird sich stauen:
Kindsbetterinnen und Ammen,
Kranke im Fahrstuhl, ein stelzender Kranich, zwei Veitstänzerinnen.
Ein Herr mit einer Ripsschleifenkrawatte und ein rotduftender Schutzmann.
Ich kann mich nicht halten: Ich bin voller Seligkeit. Die Fensterkreuze
Zerplatzen. Ein Kinderfräulein hängt bis zum Nabel aus einem Fenster heraus.
Ich kann mir nicht helfen: Die Dome zerplatzen mit Orgelfugen. Ich will
Eine neue Sonne schaffen. Ich will zwei gegeneinanderschlagen
Wie Zymbeln, und meiner Dame die Hand hinreichen. Wir werden entschweben
In einer violetten Sänfte über die Dächer euerer
Hellgelben Stadt wie Lampenschirme aus Seidenpapier im Zugwind.
Disclaimer – Historische Einordnung
Das Gedicht „Die Sonne“ von Hugo Ball entstand im frühen 20. Jahrhundert, einer Zeit, in der gesellschaftliche und sprachliche Konventionen noch stark von kolonialistischen und rassistischen Vorstellungen geprägt waren. Einzelne Begriffe und Formulierungen, die in diesem Text vorkommen, sind aus heutiger Sicht problematisch und werden heute zu Recht als diskriminierend und verletzend empfunden. Sie spiegeln jedoch die damalige Alltagssprache und den Zeitgeist wider und finden sich in vielen literarischen Werken dieser Epoche. Die Veröffentlichung und Interpretation des Gedichts erfolgt aus literaturhistorischen Gründen und in der Absicht, sich kritisch mit der Geschichte und den Veränderungen in Sprache und Gesellschaft auseinanderzusetzen. Die problematischen Ausdrücke werden nicht unkommentiert übernommen, sondern sollen Anlass zur Reflexion über den Wandel von Sprache und den Umgang mit diskriminierenden Inhalten bieten.