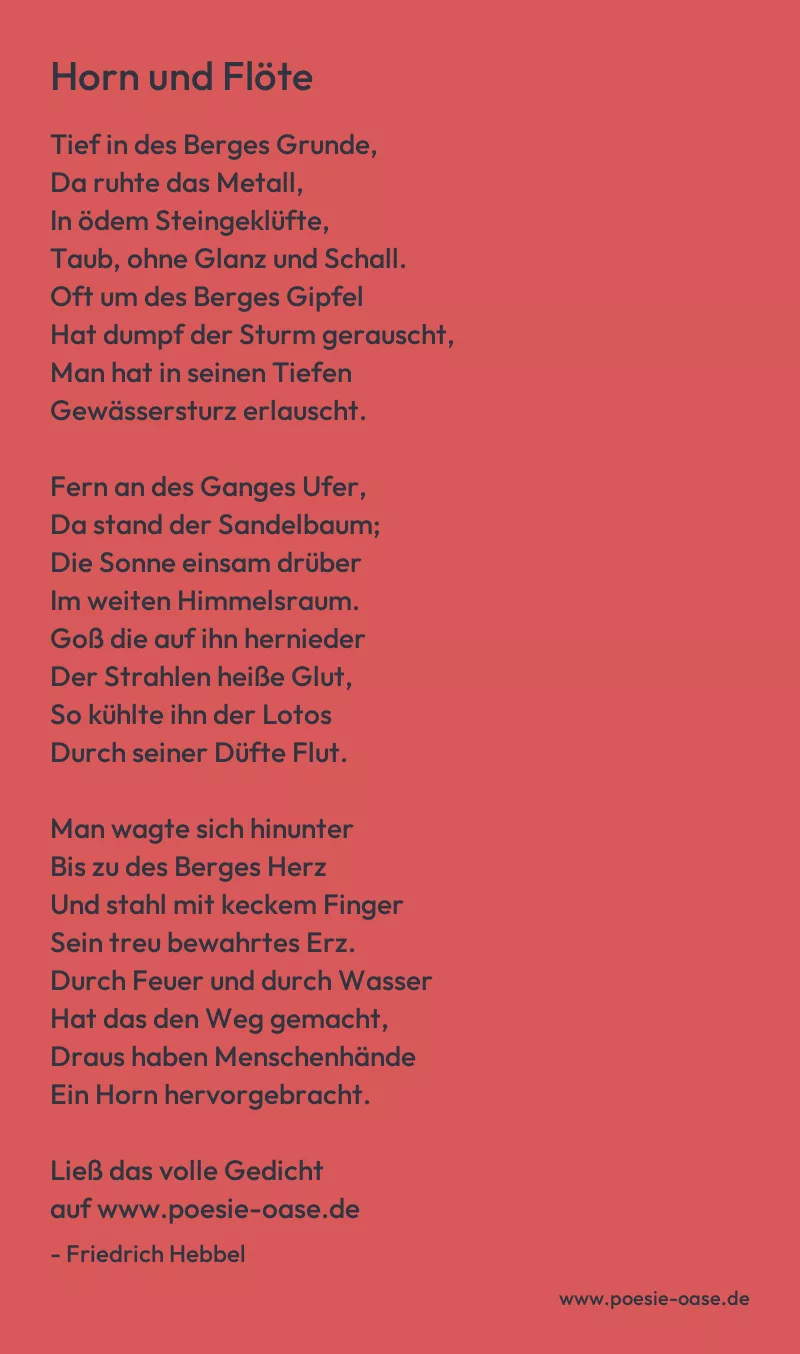Abenteuer & Reisen, Berge & Täler, Chaos, Einsamkeit, Feiern, Flüsse & Meere, Freude, Helden & Prinzessinnen, Legenden, Leidenschaft, Natur, Sommer, Wut
Horn und Flöte
Tief in des Berges Grunde,
Da ruhte das Metall,
In ödem Steingeklüfte,
Taub, ohne Glanz und Schall.
Oft um des Berges Gipfel
Hat dumpf der Sturm gerauscht,
Man hat in seinen Tiefen
Gewässersturz erlauscht.
Fern an des Ganges Ufer,
Da stand der Sandelbaum;
Die Sonne einsam drüber
Im weiten Himmelsraum.
Goß die auf ihn hernieder
Der Strahlen heiße Glut,
So kühlte ihn der Lotos
Durch seiner Düfte Flut.
Man wagte sich hinunter
Bis zu des Berges Herz
Und stahl mit keckem Finger
Sein treu bewahrtes Erz.
Durch Feuer und durch Wasser
Hat das den Weg gemacht,
Draus haben Menschenhände
Ein Horn hervorgebracht.
Es haben gift′ge Winde
Den edlen Baum entstellt,
Dann hat ein fleiß′ger Schiffer
Ihn ganz und gar gefällt.
Ihn übers Meer zu führen,
Hielt er ihn nicht zu schlecht,
Zur Flöte fand ein Meister
Drauf einen Zweig gerecht.
Nun bläsest du die Flöte
Und du das Horn zur Stund′,
Und Horn und Flöte machen
Mir manch Geheimnis kund.
Bald in des Berges Schoße
Vermeine ich zu sein,
Und bald, mich zu ergehen
In Indiens Sonnenschein.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
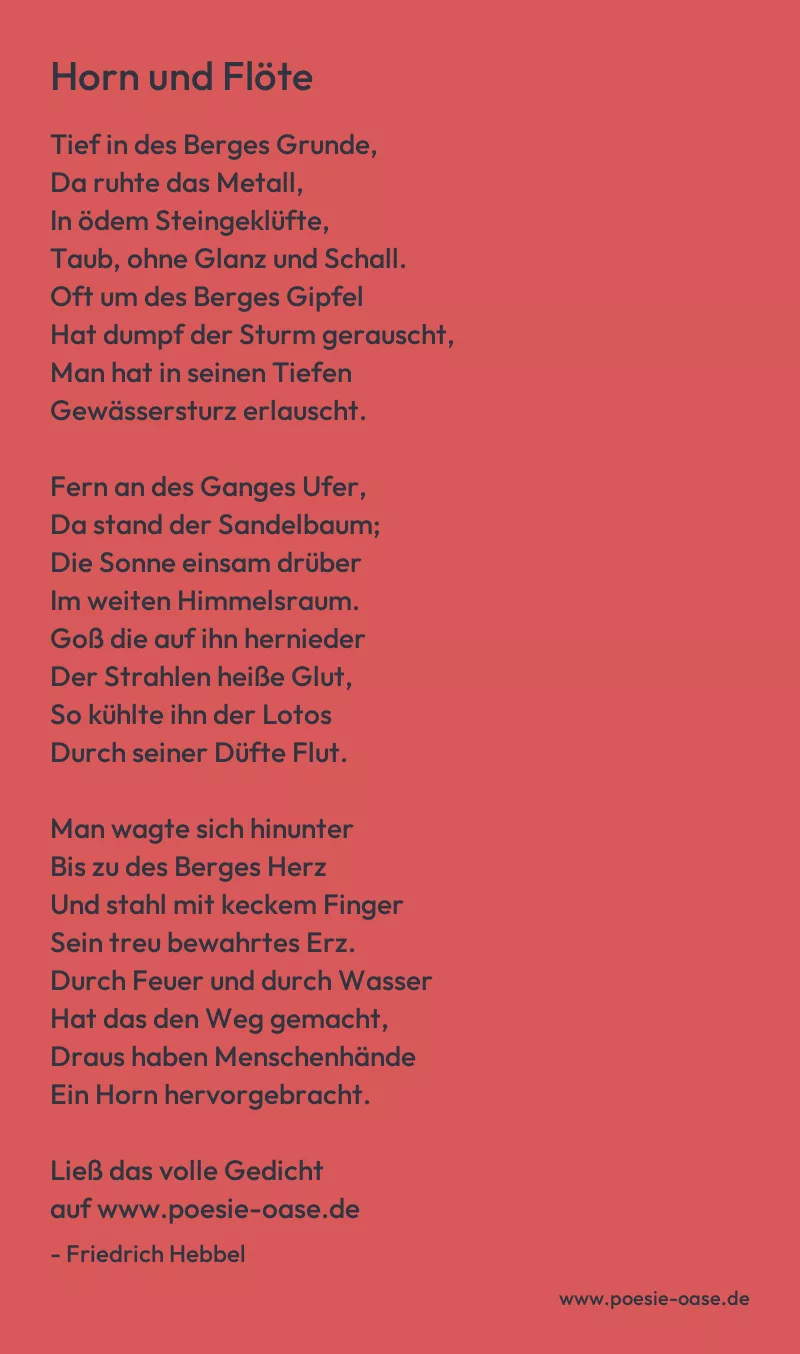
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Horn und Flöte“ von Friedrich Hebbel ist eine Metapher für die Transformation und die damit verbundene Erfahrung von Gegensätzen. Es erzählt in vier Strophen von der Entstehung von Horn und Flöte, die aus scheinbar unterschiedlichen Rohmaterialien – Erz und Sandelholz – gewonnen werden. Der erste Teil beschreibt das Erz im Inneren des Berges, still und ohne jeglichen Klang, sowie die Natur, die den Berg umgibt. Die zweite Strophe beschreibt den Sandelbaum am Ganges, der Hitze und kühle Düfte erfährt.
Der zweite Teil des Gedichts handelt von der Verarbeitung dieser Rohstoffe. Das Erz wird mit Gewalt aus dem Berg geholt, durch Feuer und Wasser geformt und schließlich zu einem Horn. Das Sandelholz, entstellt durch Winde und gefällt, wird durch einen Schiffer über das Meer transportiert und von einem Meister in eine Flöte verwandelt. Diese beiden Prozesse der Transformation sind von harter Arbeit und oft zerstörerischen Elementen geprägt, was die Notwendigkeit von Aufwand und Veränderung unterstreicht.
In der letzten Strophe werden die musikalischen Instrumente, Horn und Flöte, in den Mittelpunkt gerückt. Der Sprecher hört das Horn und die Flöte spielen und assoziiert damit unterschiedliche Bilder und Gefühle. Das Horn erinnert ihn an die Welt des Berges, an Tiefe und Stärke, während die Flöte ihn in die Welt Indiens entführt, in die Wärme und Sinnlichkeit der Natur.
Hebbel nutzt die Gegenüberstellung von Erz und Sandelholz sowie von Horn und Flöte, um die Dualität der menschlichen Erfahrung zu thematisieren. Das Gedicht deutet an, dass wir durch die Transformation und die Auseinandersetzung mit Gegensätzen – Stille und Lärm, Tiefe und Oberfläche, Kälte und Wärme – die Welt besser verstehen und eine reichere Erfahrung machen können. Die Musik wird so zum Medium, das verschiedene Welten und Erfahrungen miteinander verbindet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.