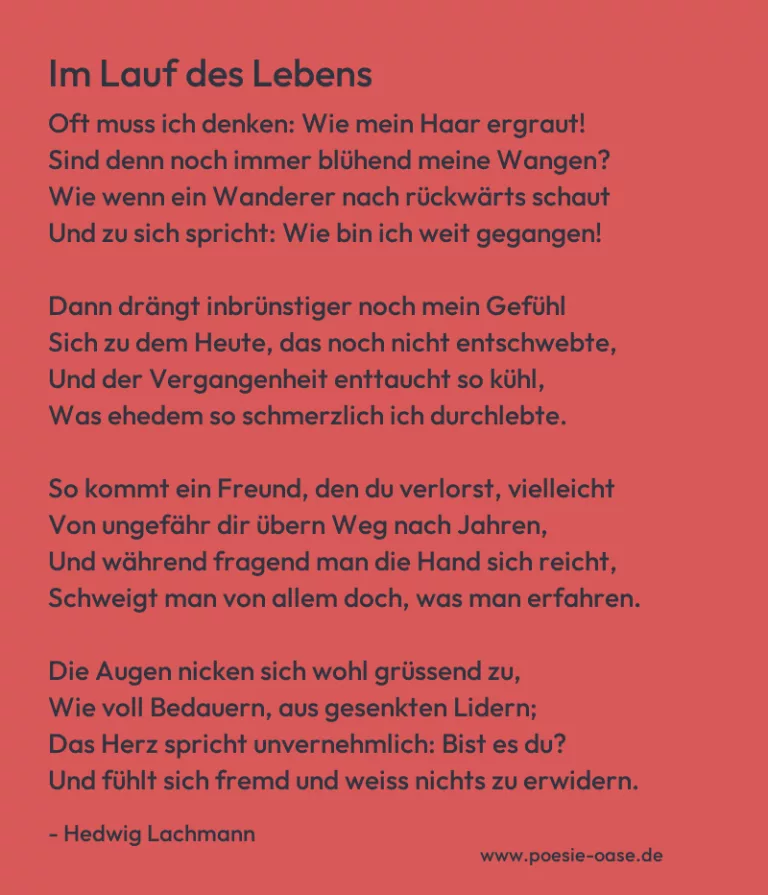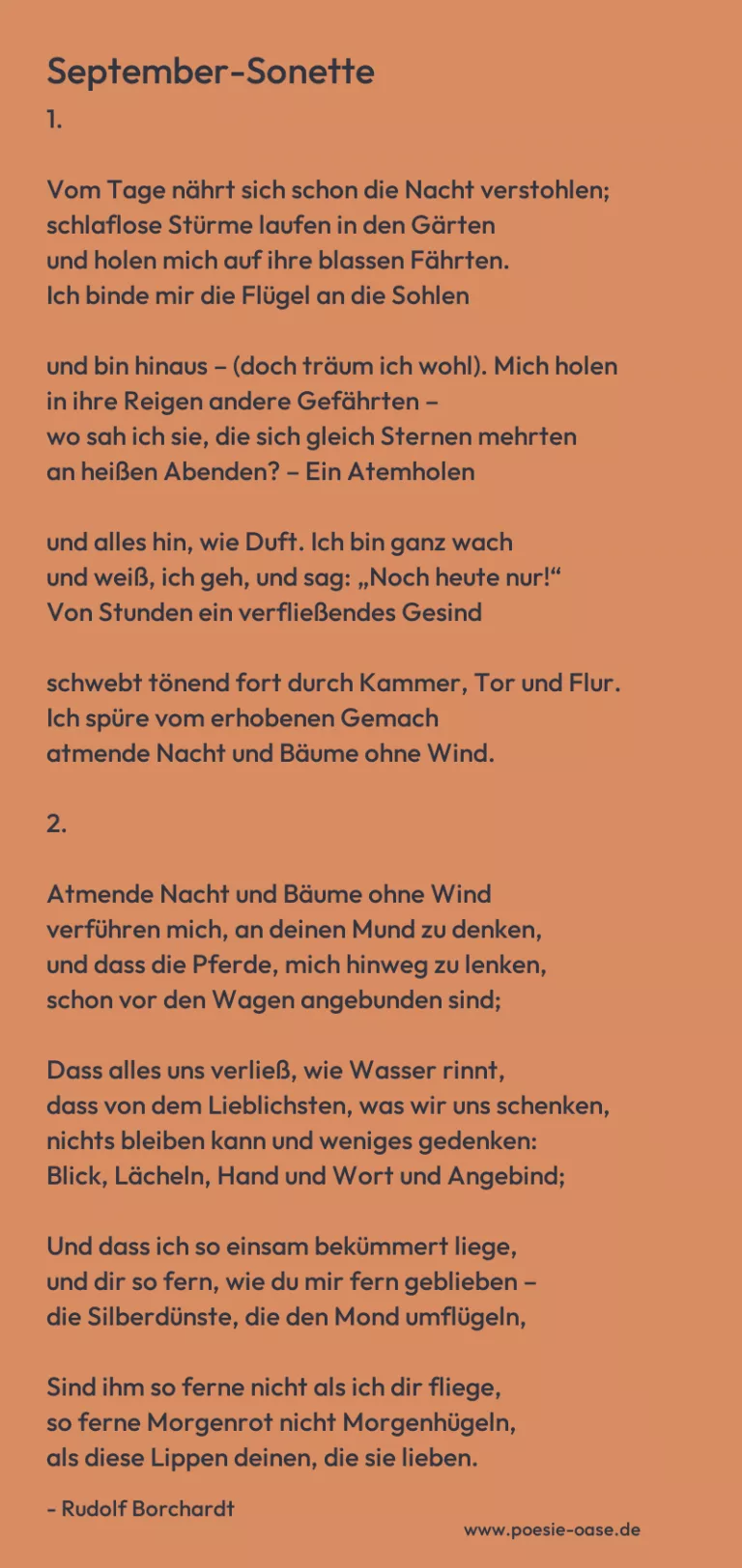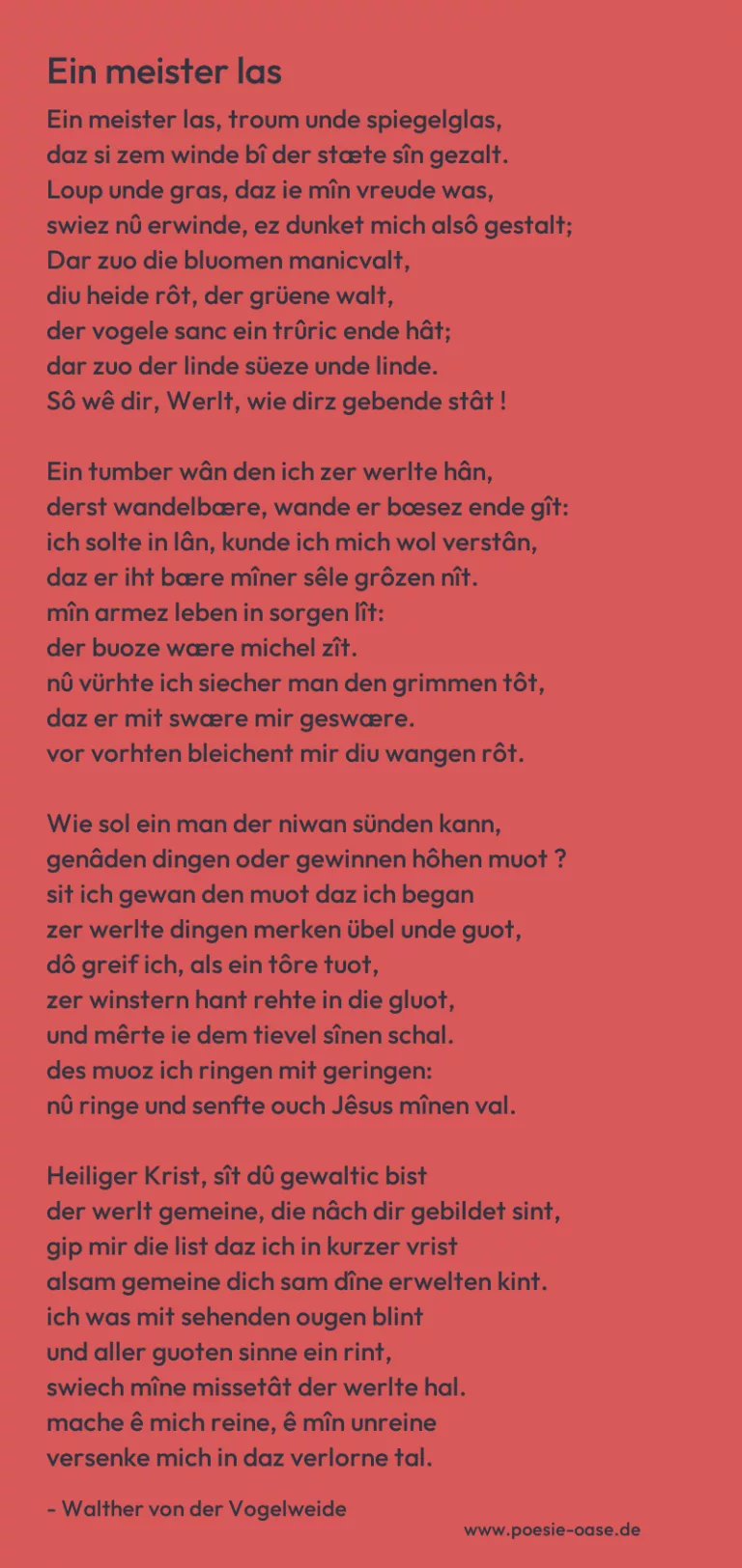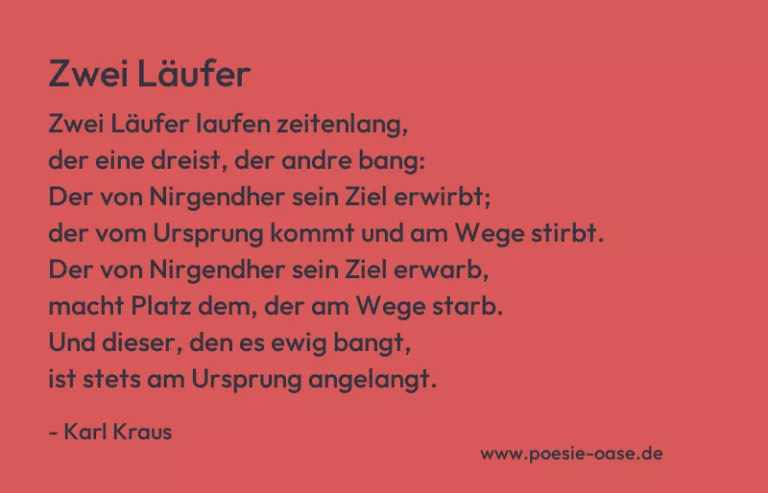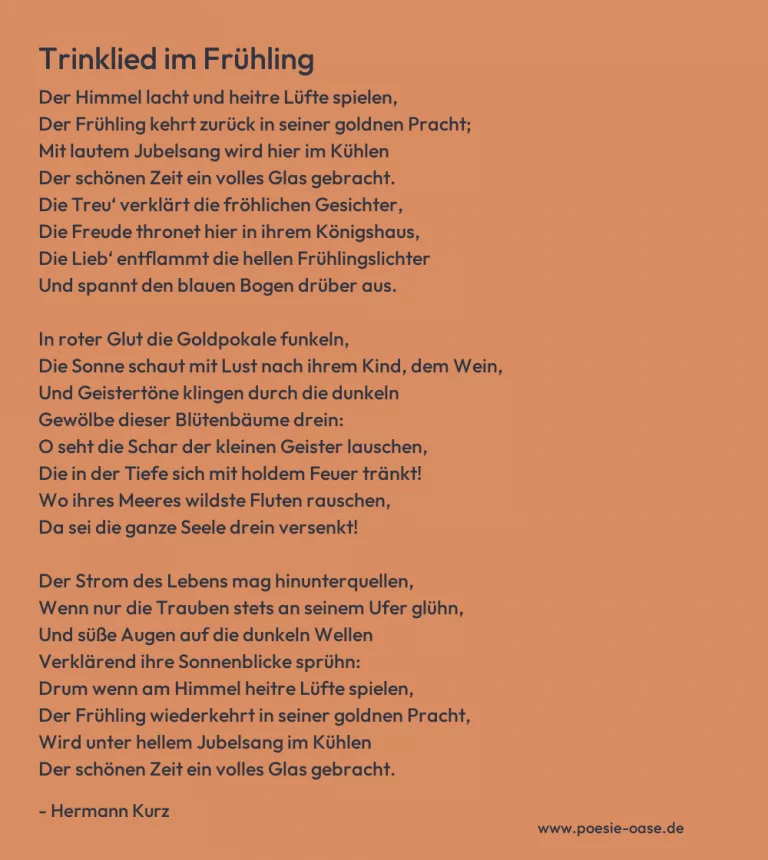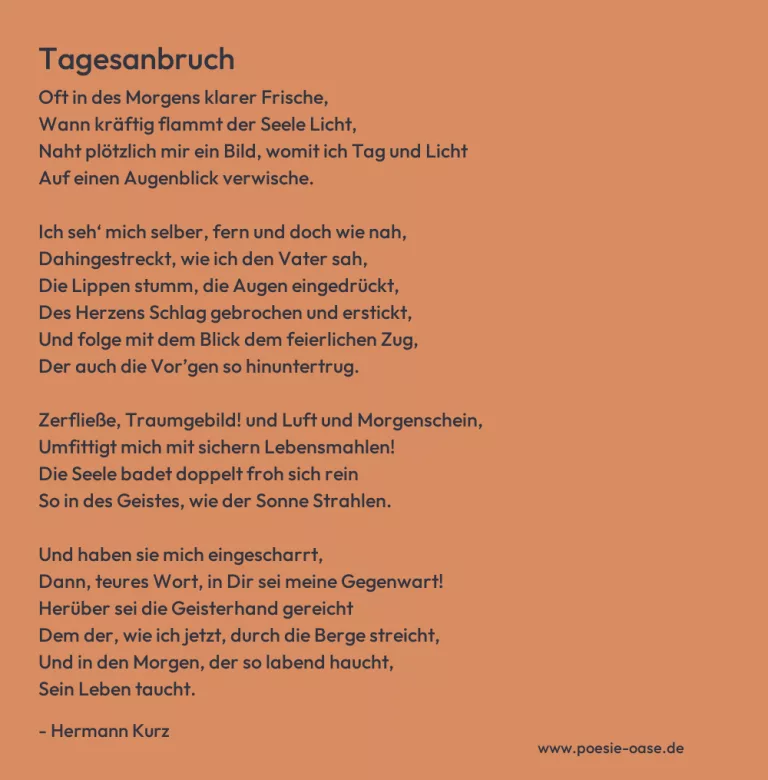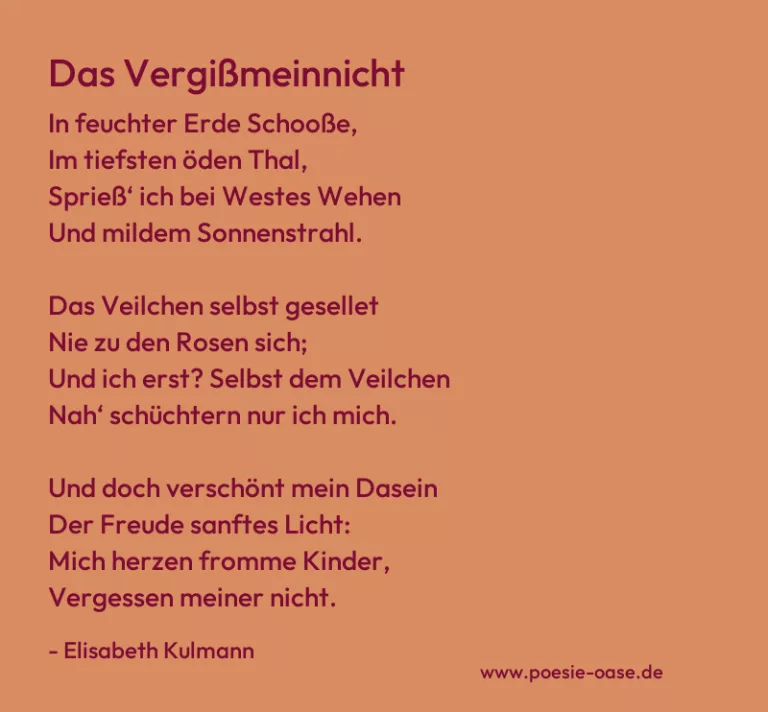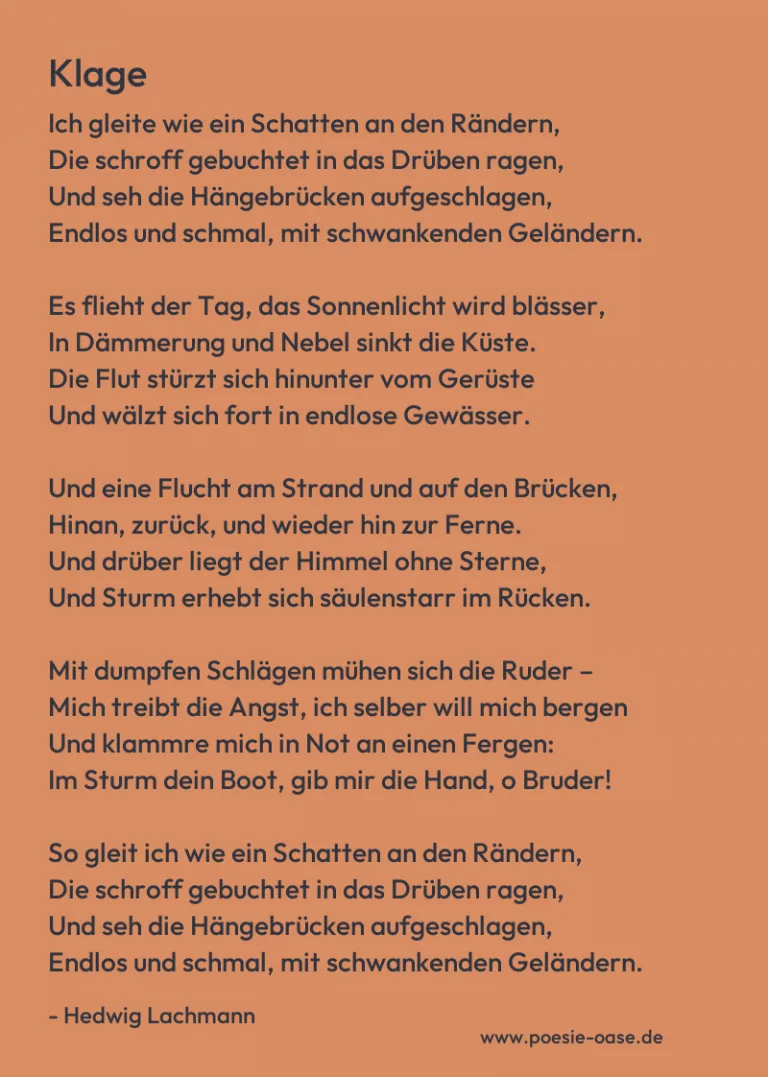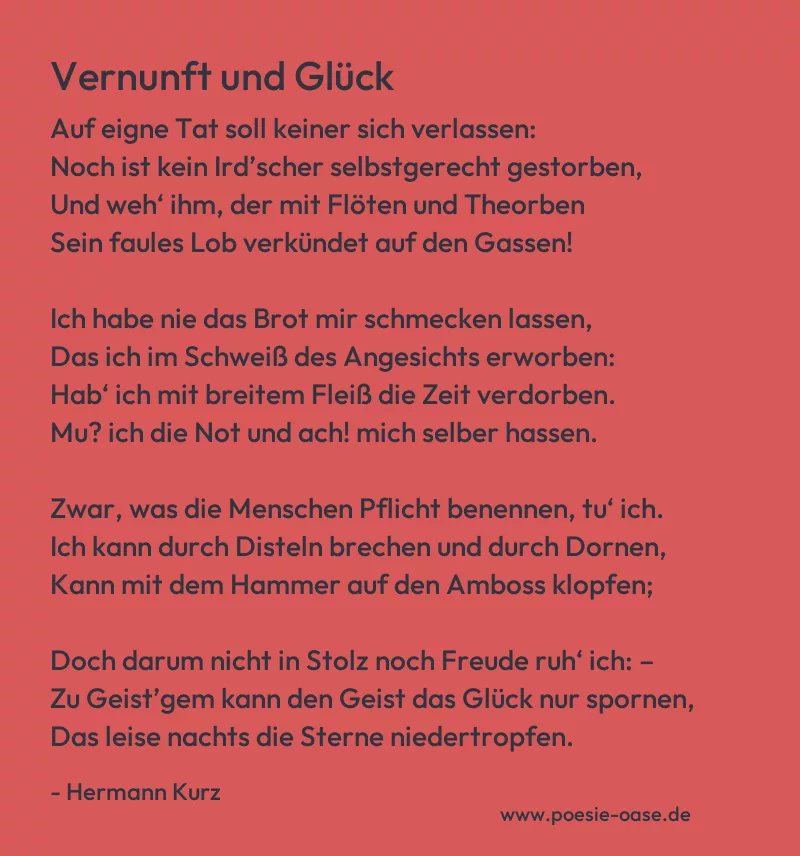Vernunft und Glück
Auf eigne Tat soll keiner sich verlassen:
Noch ist kein Ird’scher selbstgerecht gestorben,
Und weh‘ ihm, der mit Flöten und Theorben
Sein faules Lob verkündet auf den Gassen!
Ich habe nie das Brot mir schmecken lassen,
Das ich im Schweiß des Angesichts erworben:
Hab‘ ich mit breitem Fleiß die Zeit verdorben.
Mu? ich die Not und ach! mich selber hassen.
Zwar, was die Menschen Pflicht benennen, tu‘ ich.
Ich kann durch Disteln brechen und durch Dornen,
Kann mit dem Hammer auf den Amboss klopfen;
Doch darum nicht in Stolz noch Freude ruh‘ ich: –
Zu Geist’gem kann den Geist das Glück nur spornen,
Das leise nachts die Sterne niedertropfen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
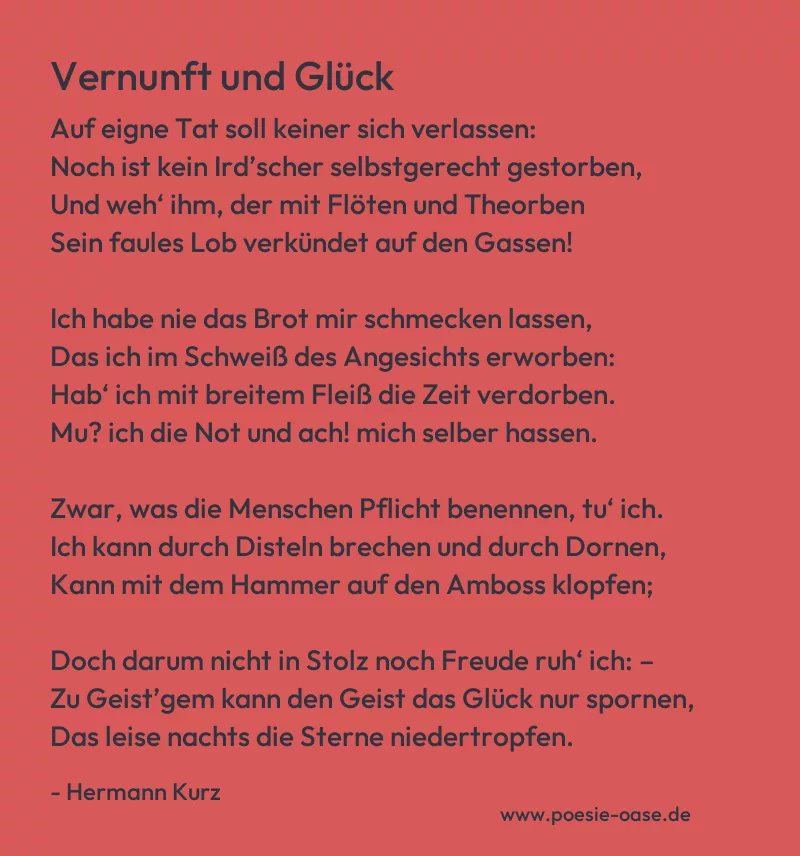
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vernunft und Glück“ von Hermann Kurz thematisiert die Dualität von Arbeit, Pflicht und dem Streben nach innerem Glück. Zu Beginn warnt der Sprecher davor, sich ausschließlich auf eigene Kräfte und Taten zu verlassen, und hebt hervor, dass noch niemand „selbstgerecht“ gestorben ist – eine Anspielung darauf, dass keine menschliche Leistung vollkommen und unfehlbar ist. Der „faule Lob“ und die Flöten auf den „Gassen“ symbolisieren oberflächliche Anerkennung und die Täuschung, dass äußere Erfolge wahrhaftiges Glück bringen können.
Der Sprecher beschreibt dann seine eigene harte Arbeit, die ihm jedoch kein echtes Wohlgefühl oder Zufriedenheit bringt. „Nie das Brot“ habe er sich „schmecken lassen“, das er „im Schweiß des Angesichts erworben“ habe, was auf das Gefühl hinweist, trotz seiner Anstrengungen nie die wahre Freude des Lebens zu erfahren. Durch „breiten Fleiß“ habe er „die Zeit verdorben“, was auf eine Lebenserfahrung hinweist, in der Mühe und Pflichtbewusstsein keine Erfüllung bringen. Der Sprecher ist mit seinem Schicksal unzufrieden und muss „die Not“ und „sich selber hassen“, was seine innere Zerrissenheit verdeutlicht.
In der dritten Strophe erklärt der Sprecher, dass er zwar die „Pflichten“ der Menschen erfülle und „durch Disteln und Dornen“ gehe, was auf eine ständige Konfrontation mit Schwierigkeiten hinweist. Doch trotz dieser Ausdauer findet er keine wahre Freude oder Erhebung im Leben. Die Anerkennung der Pflicht und des Erfolges durch Anstrengung wird nicht zur Quelle des Glücks.
Abschließend kommt der Sprecher zu der Erkenntnis, dass wahres „Glück“ nur durch den „Geist“ erlangt werden kann, der vom „Glück“ in Form von „leisen Sternen“ nachts „niedertropft“. Diese Metapher deutet darauf hin, dass Glück nicht durch äußere Arbeit und Mühe zu erreichen ist, sondern vielmehr ein Zustand innerer Erhebung und Spiritualität ist, der leise und unerwartet in das Leben tritt. Das Gedicht stellt also fest, dass Glück und wahres Erkennen des Lebens nicht durch Fleiß oder äußerliche Leistung zu erreichen sind, sondern durch das innere, geistige Wachstum und das Vertrauen in eine höhere, sanfte Kraft.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.