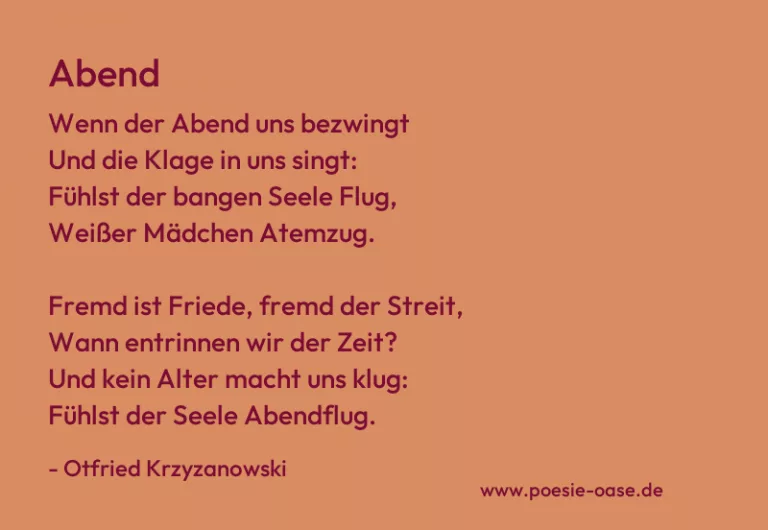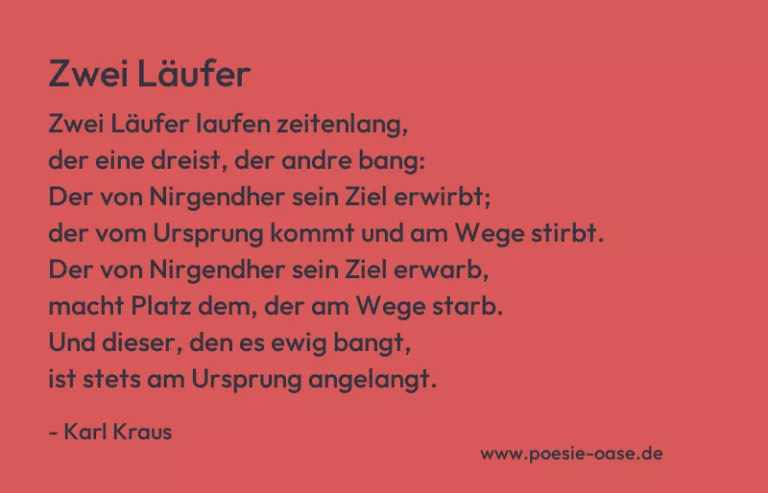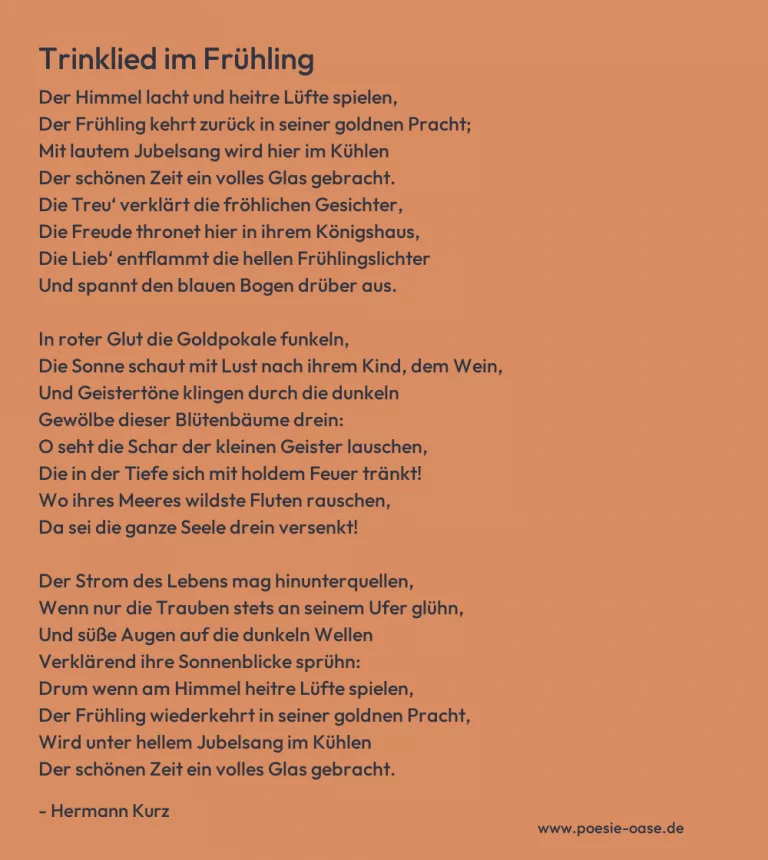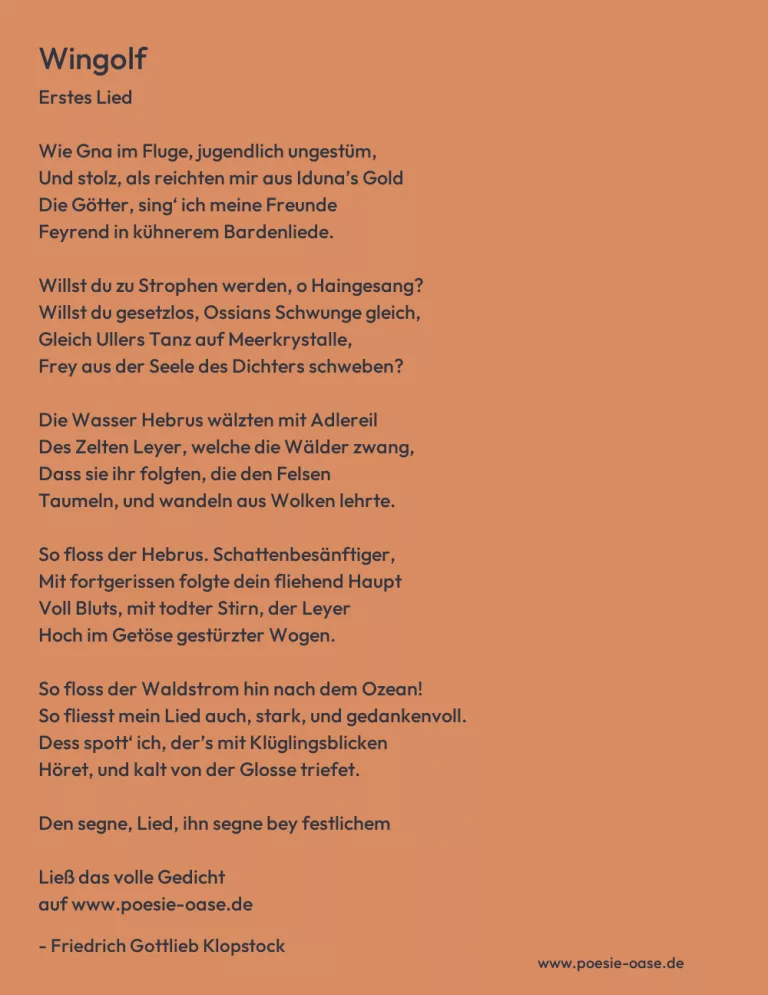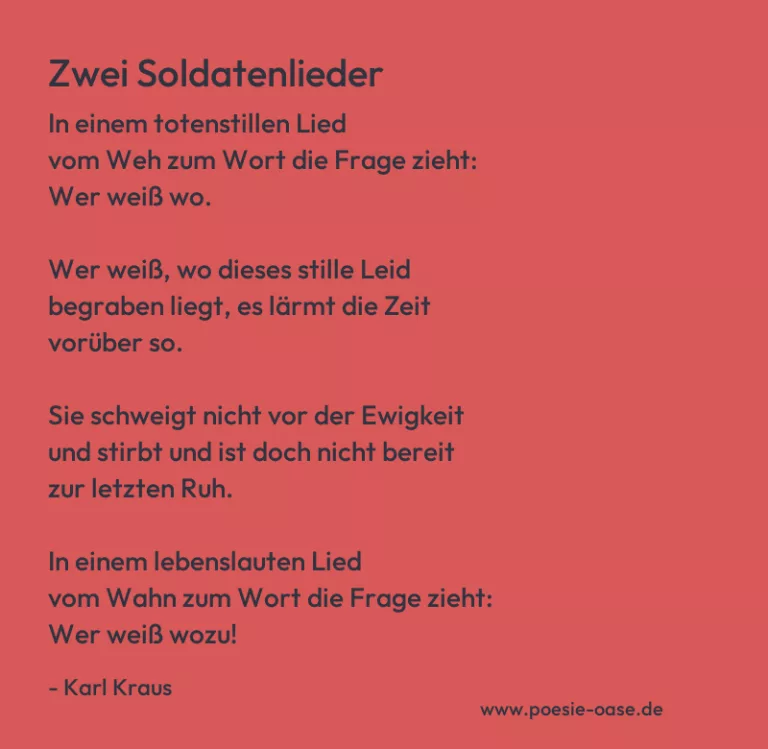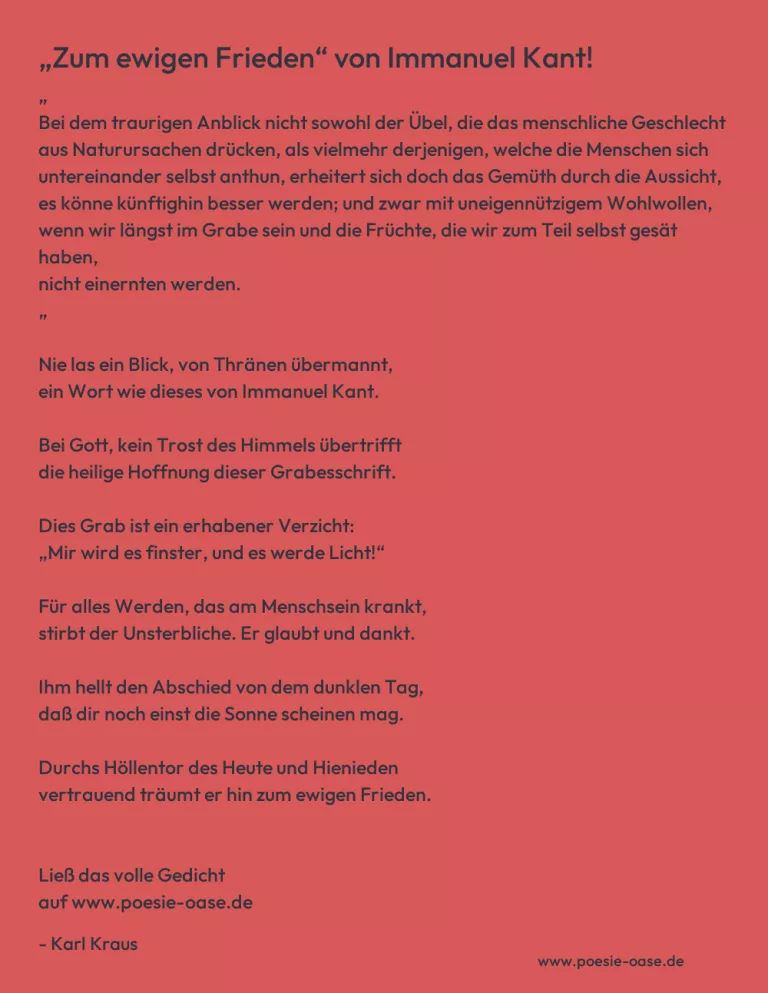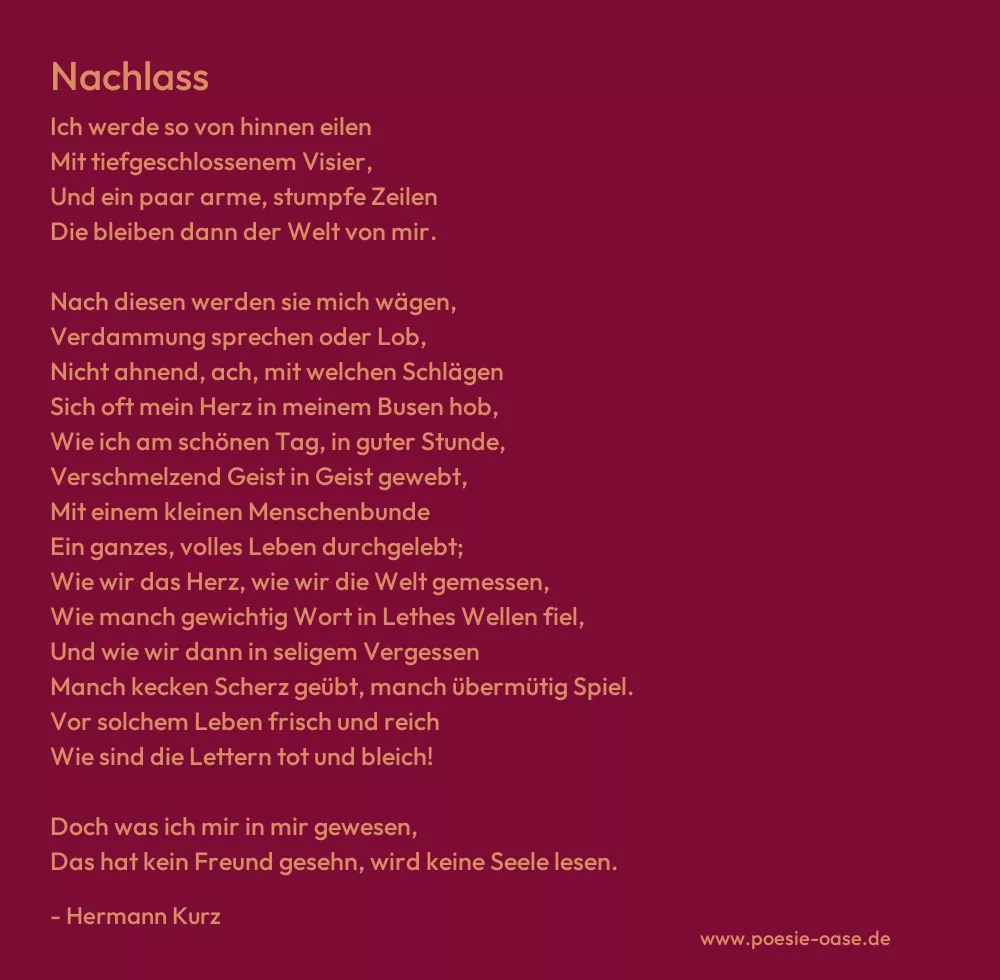Nachlass
Ich werde so von hinnen eilen
Mit tiefgeschlossenem Visier,
Und ein paar arme, stumpfe Zeilen
Die bleiben dann der Welt von mir.
Nach diesen werden sie mich wägen,
Verdammung sprechen oder Lob,
Nicht ahnend, ach, mit welchen Schlägen
Sich oft mein Herz in meinem Busen hob,
Wie ich am schönen Tag, in guter Stunde,
Verschmelzend Geist in Geist gewebt,
Mit einem kleinen Menschenbunde
Ein ganzes, volles Leben durchgelebt;
Wie wir das Herz, wie wir die Welt gemessen,
Wie manch gewichtig Wort in Lethes Wellen fiel,
Und wie wir dann in seligem Vergessen
Manch kecken Scherz geübt, manch übermütig Spiel.
Vor solchem Leben frisch und reich
Wie sind die Lettern tot und bleich!
Doch was ich mir in mir gewesen,
Das hat kein Freund gesehn, wird keine Seele lesen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
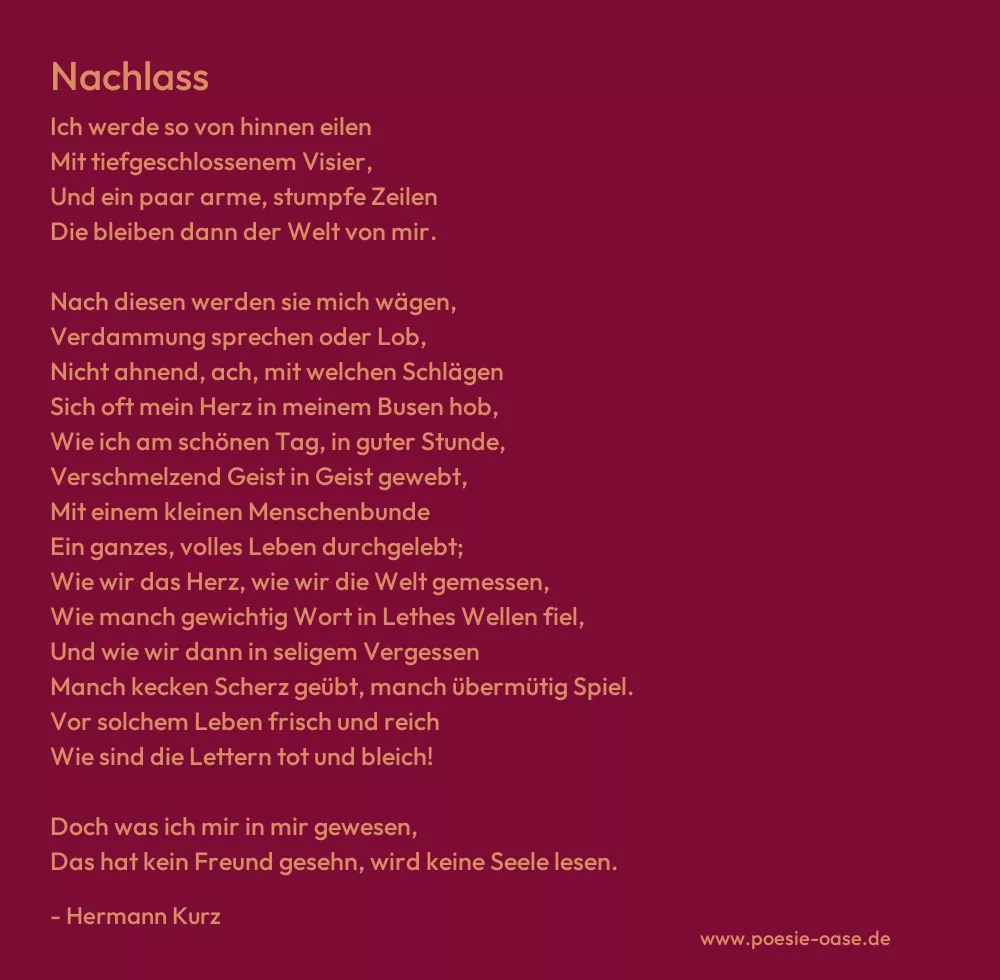
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Nachlass“ von Hermann Kurz ist eine eindrucksvolle Reflexion über das Leben, das Erbe und die Bedeutung von Erinnerungen. Die erste Strophe beschreibt den Erzähler, der „mit tiefgeschlossenem Visier“ von der Welt Abschied nimmt. Das „Visier“ könnte symbolisch für eine gewisse Zurückhaltung oder das Verbergen der wahren Gefühle und Gedanken des Erzählers stehen. Die „armen, stumpfen Zeilen“, die von ihm bleiben, zeigen eine gewisse Enttäuschung darüber, dass das, was er der Welt hinterlässt, nur unvollständige und vielleicht unzureichende Ausdrucksformen seiner selbst sind. Diese Worte reichen nicht aus, um das wahre Leben und die innere Welt des Erzählers zu vermitteln.
In der zweiten Strophe geht der Erzähler auf die Bewertung seines Lebens durch andere ein. „Nach diesen werden sie mich wägen“ – er wird durch seine schriftlichen Hinterlassenschaften beurteilt, aber diese Bewertung wird ihm nicht gerecht. Die „Schläge“, die sein Herz erlebte, und die tiefen emotionalen Momente, die er durchlebte, bleiben für andere unsichtbar. Diese innere Welt, die sich in den „Wellen“ seiner eigenen Erfahrungen und Gedanken bewegt, kann von anderen nicht erfasst werden. Der Erzähler beschreibt die Freude und Erfüllung, die er in „guten Stunden“ erlebte, wenn er sich „mit einem kleinen Menschenbunde“ verbunden fühlte, wenn er „Geist in Geist“ verschmolz und das Leben in vollen Zügen lebte. Diese Momente bleiben jedoch der Außenwelt verborgen und unzugänglich.
Der Gedichtsträger hebt hervor, dass es im Leben „gewebte“ Momente des Glücks und des geistigen Austauschs gibt, die nicht in Worte gefasst und nicht in einem „Nachlass“ festgehalten werden können. Er spricht von der „Messung der Welt“ und dem „Vergessen“, das durch den lebendigen Austausch von Gedanken und Emotionen zwischen Menschen entsteht. In den „Lethes Wellen“ – eine Anspielung auf den Fluss der Vergessenheit aus der griechischen Mythologie – fallen die bedeutungsvollen Worte, die jedoch im endlosen Strom der Zeit und des Vergessens versinken.
Die letzte Strophe zieht dann einen scharfen Kontrast zwischen dem „reichen und frischen“ Leben des Erzählers und der „bleichen“ und „tot“ wirkenden Sprache, die von ihm hinterlassen wird. In der Erinnerung lebt das Leben weiter, doch das, was in „Lettern“ niedergeschrieben wird, erscheint unlebendig und unvollständig. Es ist der Unterschied zwischen einem gelebten Leben, das von Emotionen, Erfahrungen und Momenten geprägt ist, und dem, was in schriftlicher Form überliefert bleibt – etwas, das nicht dieselbe Lebendigkeit und Tiefe hat. Schließlich kommt der Erzähler zu der Erkenntnis, dass „kein Freund“ und „keine Seele“ das wahre Wesen dessen sehen konnte, was er in seinem Inneren war. Seine wahre Identität und die tiefsten Empfindungen bleiben in sich selbst verborgen.
Das Gedicht ist eine melancholische und tiefgründige Betrachtung des menschlichen Lebens und seiner Vergänglichkeit. Es thematisiert das Unvermögen, das wahre Leben und die Tiefe der menschlichen Erfahrung in Worte zu fassen und lässt die Differenz zwischen der inneren Welt eines Menschen und der äußeren Wahrnehmung von ihm durch andere aufscheinen. Der Erzähler hinterlässt ein Erbe, das unvollständig ist und das wahre Wesen seiner Existenz nicht wiedergibt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.