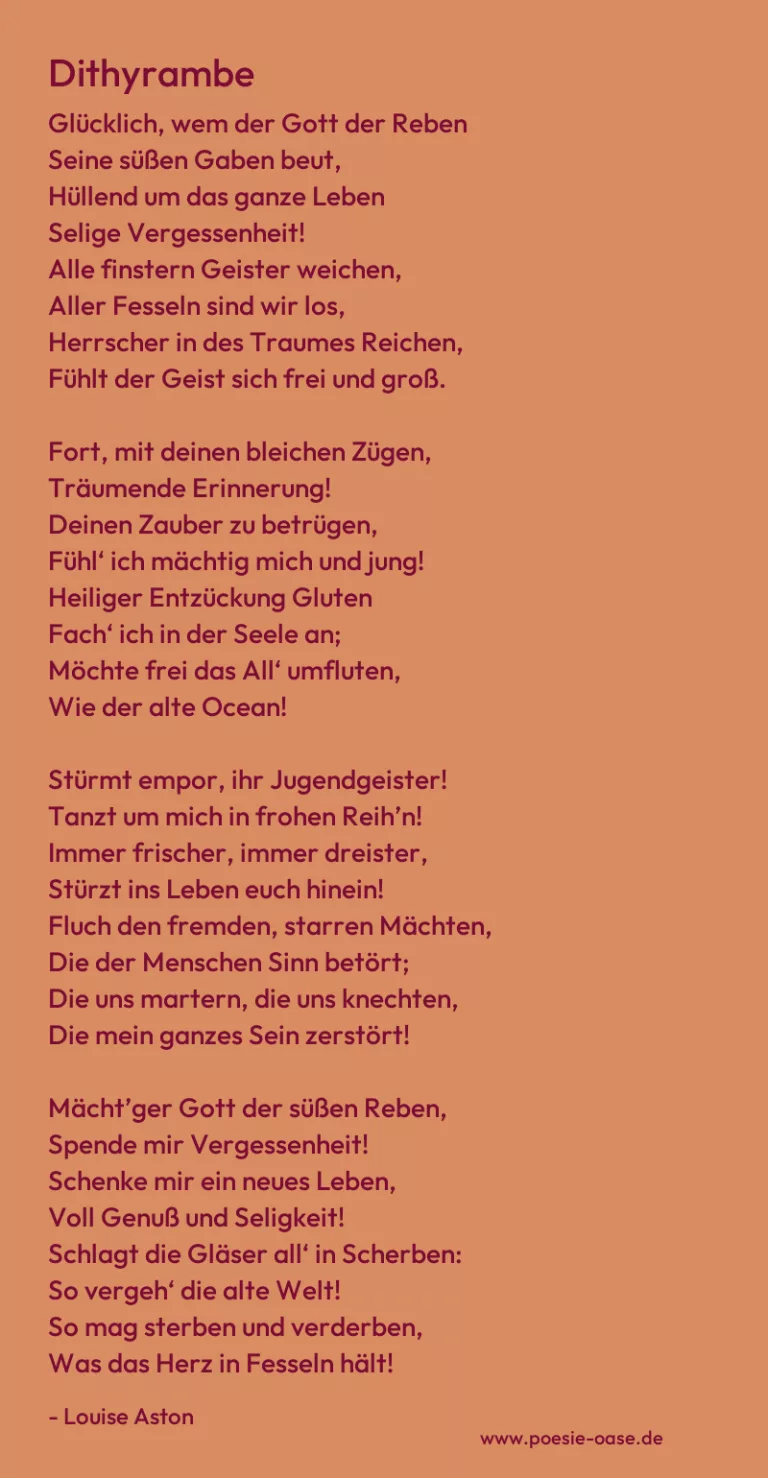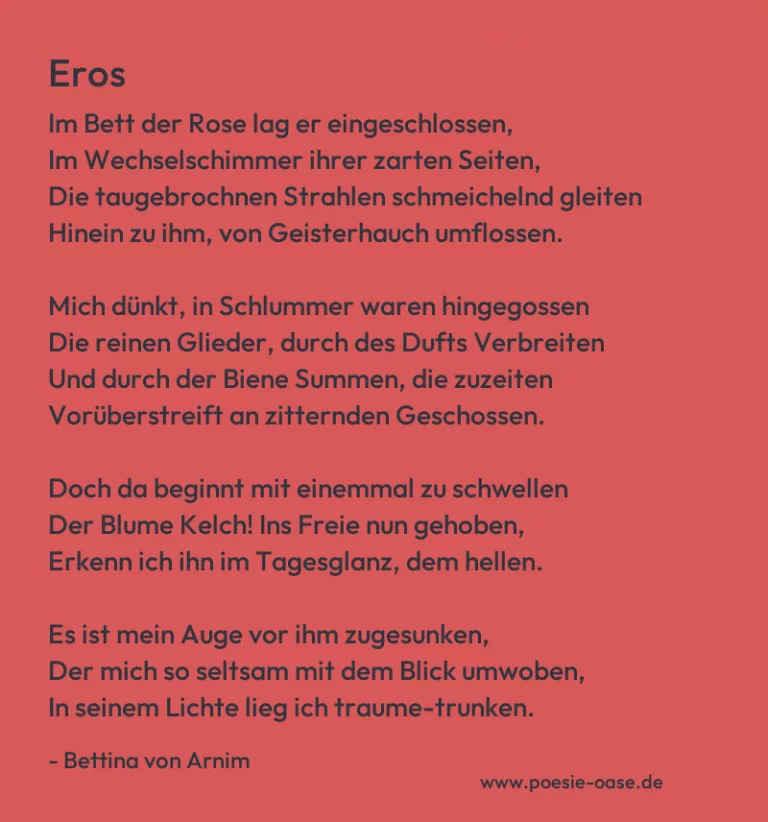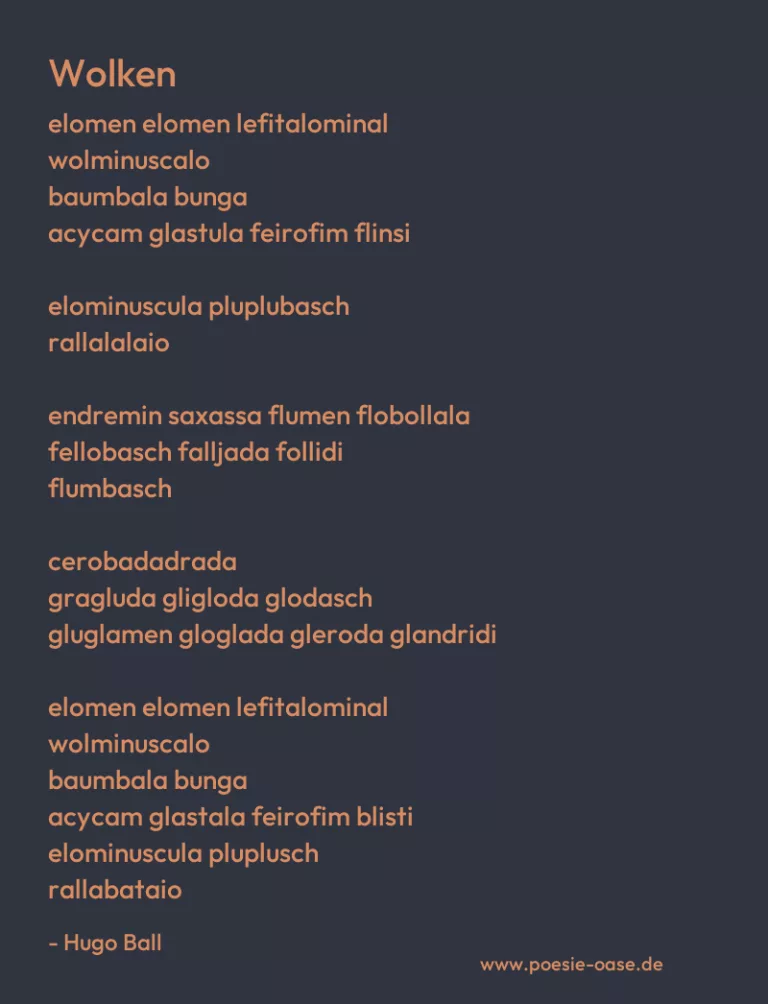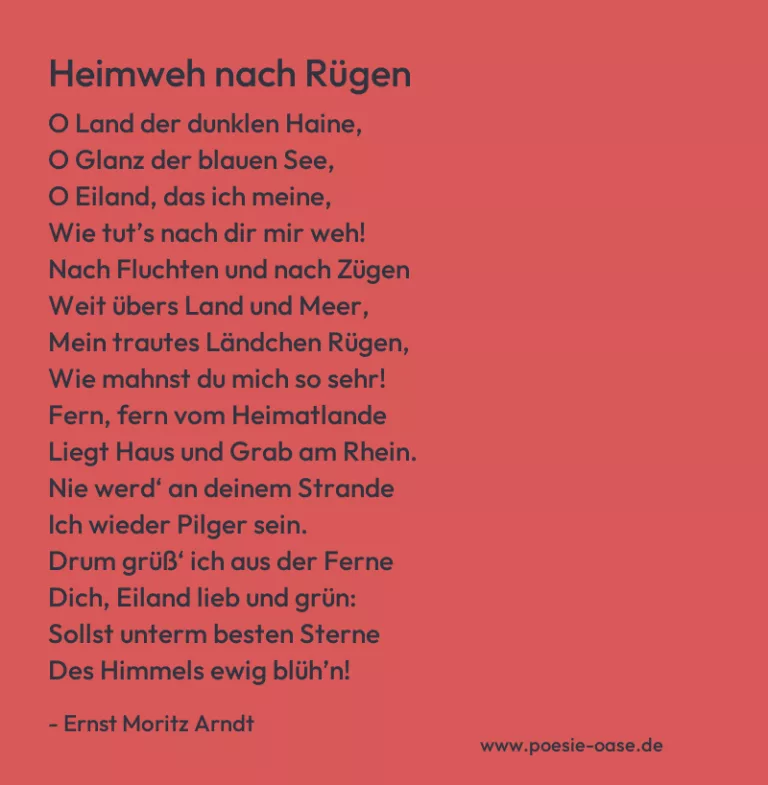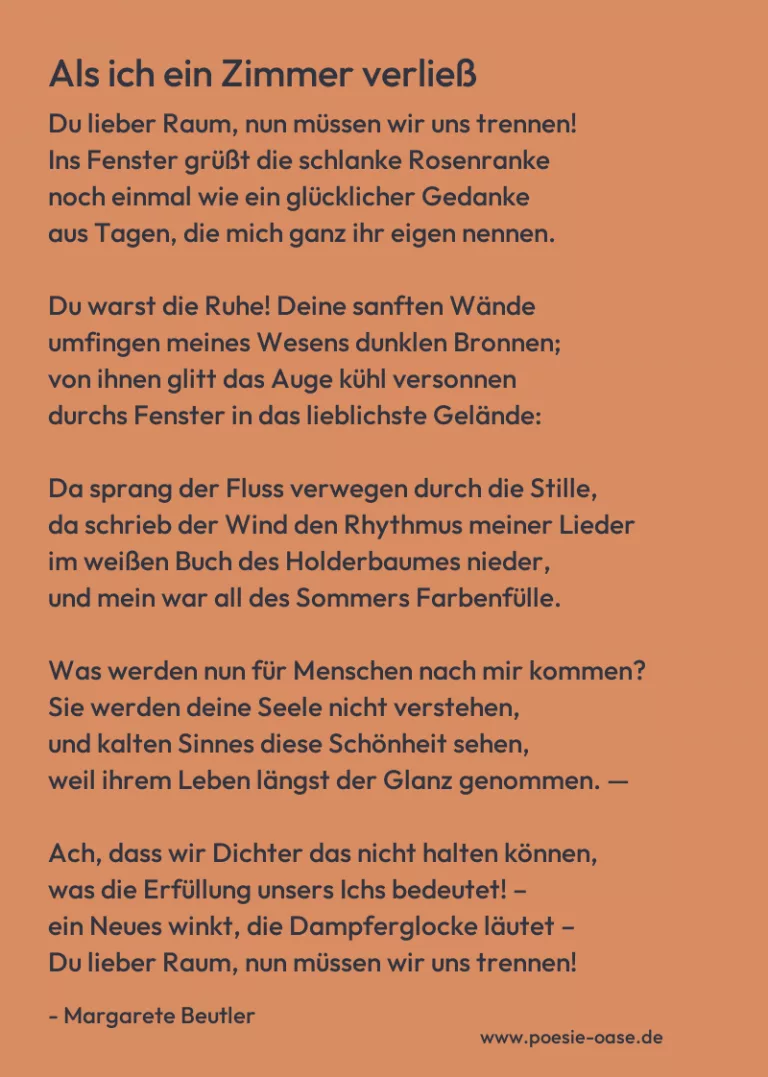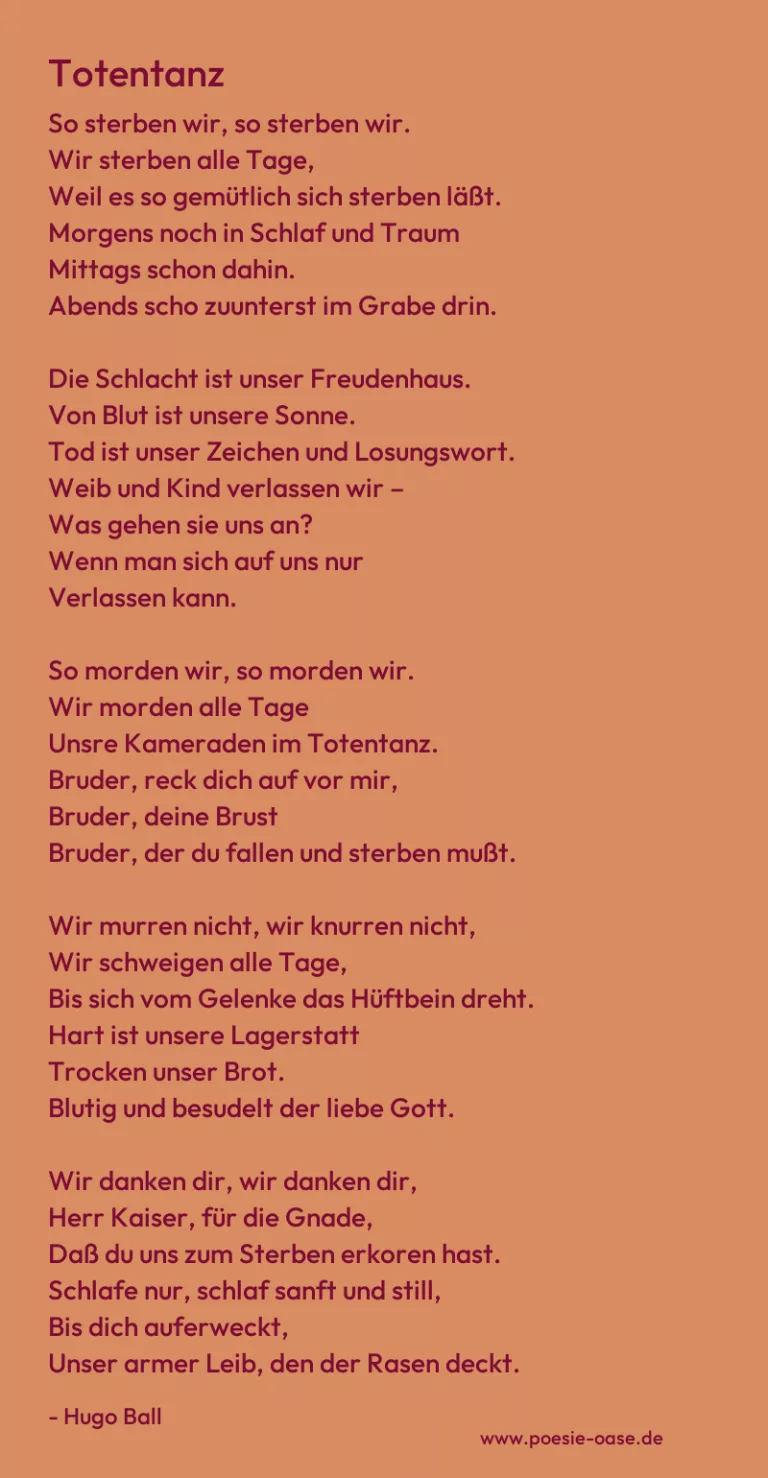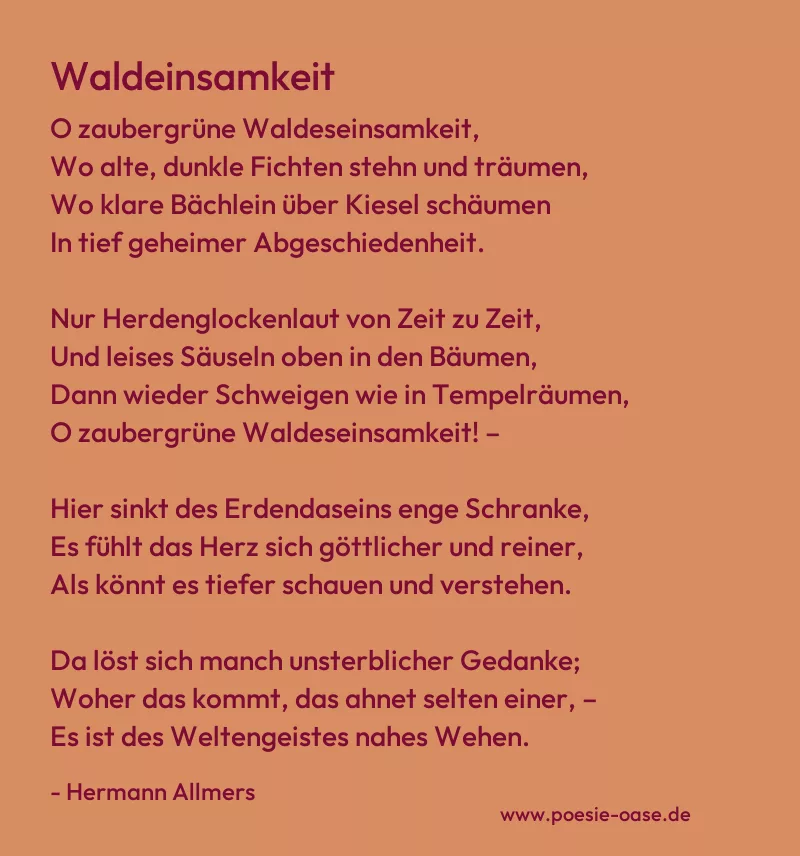Waldeinsamkeit
O zaubergrüne Waldeseinsamkeit,
Wo alte, dunkle Fichten stehn und träumen,
Wo klare Bächlein über Kiesel schäumen
In tief geheimer Abgeschiedenheit.
Nur Herdenglockenlaut von Zeit zu Zeit,
Und leises Säuseln oben in den Bäumen,
Dann wieder Schweigen wie in Tempelräumen,
O zaubergrüne Waldeseinsamkeit! –
Hier sinkt des Erdendaseins enge Schranke,
Es fühlt das Herz sich göttlicher und reiner,
Als könnt es tiefer schauen und verstehen.
Da löst sich manch unsterblicher Gedanke;
Woher das kommt, das ahnet selten einer, –
Es ist des Weltengeistes nahes Wehen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
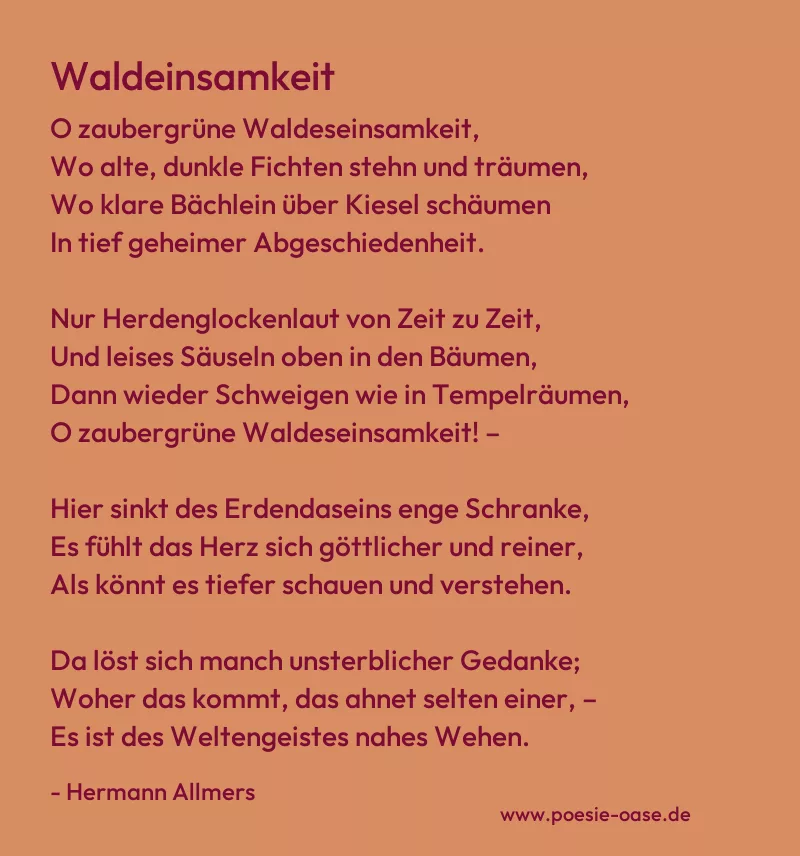
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Waldeinsamkeit“ von Hermann Allmers fängt die mystische und spirituelle Erfahrung ein, die der Mensch in der Abgeschiedenheit des Waldes erleben kann. In der ersten Strophe wird die „zaubergrüne Waldeseinsamkeit“ als ein Ort der Ruhe und inneren Einkehr beschrieben, wo „alte, dunkle Fichten“ stehen und „träumen“. Diese Bäume symbolisieren die Weisheit und das Geheimnis der Natur, die in der Stille des Waldes lebendig wird. Die „klaren Bächlein“, die über „Kiesel schäumen“, verstärken das Bild einer ungestörten und ursprünglichen Welt, die im Einklang mit sich selbst ist. Die Abgeschiedenheit des Waldes wird als ein Zustand der ungestörten und geheimen Ruhe beschrieben.
In der zweiten Strophe wird das Gefühl der Einsamkeit und des friedlichen Rückzugs weiter betont. Nur die „Herdenglocken“ und das „Säuseln der Bäume“ unterbrechen das sonstige Schweigen des Waldes, das mit der Stille eines „Tempelraums“ verglichen wird. Diese religiöse Metapher unterstreicht die Ehrfurcht, die der Wald in seiner unberührten Form hervorruft. Das wiederholte „O zaubergrüne Waldeseinsamkeit!“ drückt eine tiefe Sehnsucht nach diesem Ort der Abgeschiedenheit aus, der wie ein Heiligtum wirkt und eine Quelle der spirituellen Erhebung ist.
In der dritten Strophe schildert der Sprecher, wie der Wald die „enge Schranke“ des Erdendaseins auflöst. Das Herz des Sprechers fühlt sich „göttlicher und reiner“, als ob es durch die Waldeseinsamkeit zu einer tieferen Erkenntnis und einem klareren Verständnis des Lebens gelangt. Der Wald wird hier als ein Ort beschrieben, der dem menschlichen Geist ermöglicht, über das Alltägliche hinauszuschauen und zu verstehen. Die Erwähnung der „unsterblichen Gedanken“ verweist auf eine metaphysische Dimension, die den Wald als einen Raum der Erleuchtung und geistigen Klarheit darstellt.
Die letzte Zeile, „Es ist des Weltengeistes nahes Wehen“, bringt den Höhepunkt der spirituellen Erfahrung im Wald zum Ausdruck. Der „Weltengeist“ verweist auf eine universelle, göttliche Kraft, die in der Stille des Waldes spürbar wird. Der Gedanke, dass dieser Geist „nah“ ist, verstärkt das Gefühl einer unmittelbaren Verbindung zu einer höheren Wahrheit. Der Wald wird so zum Symbol für die Quelle der Erkenntnis und der Verbindung zu einem größeren, übernatürlichen Wissen. Das Gedicht drückt die Idee aus, dass wahre Weisheit und spirituelle Klarheit oft in der Stille und Abgeschiedenheit der Natur gefunden werden können.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.