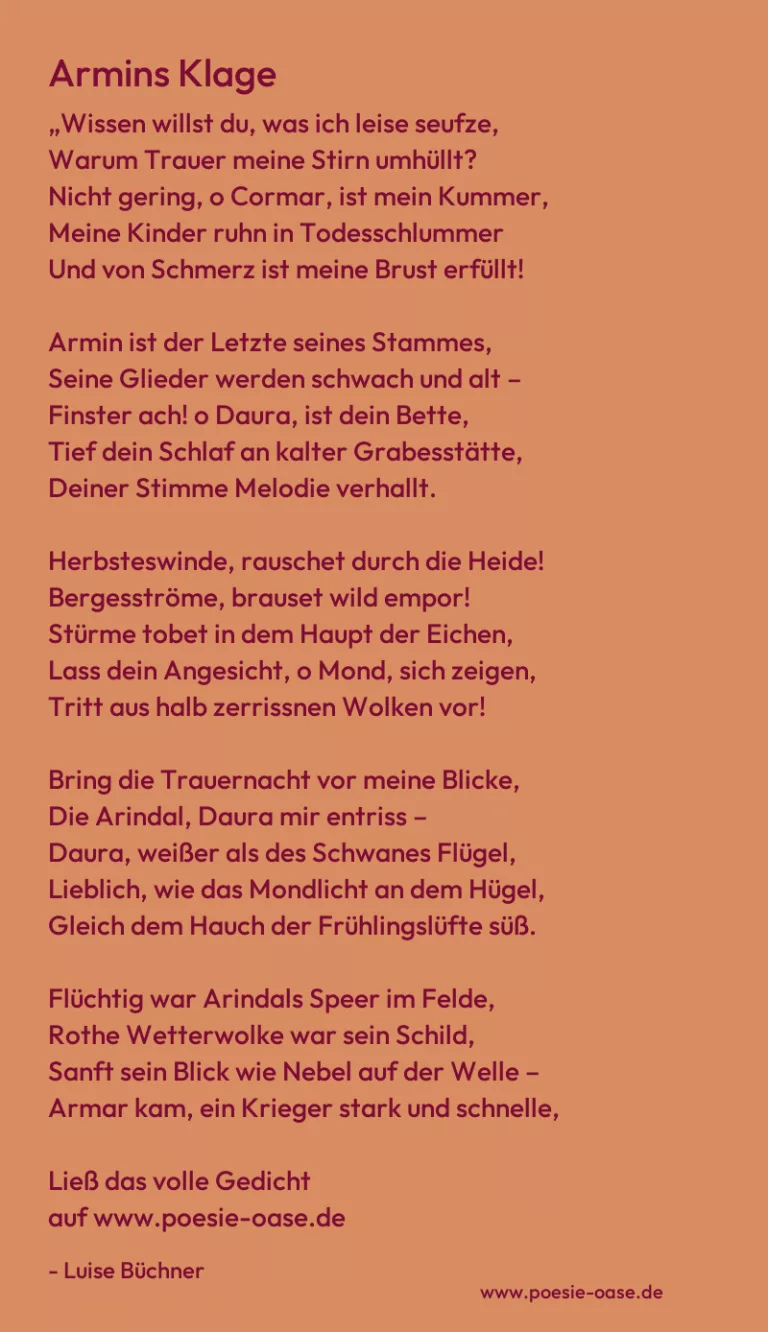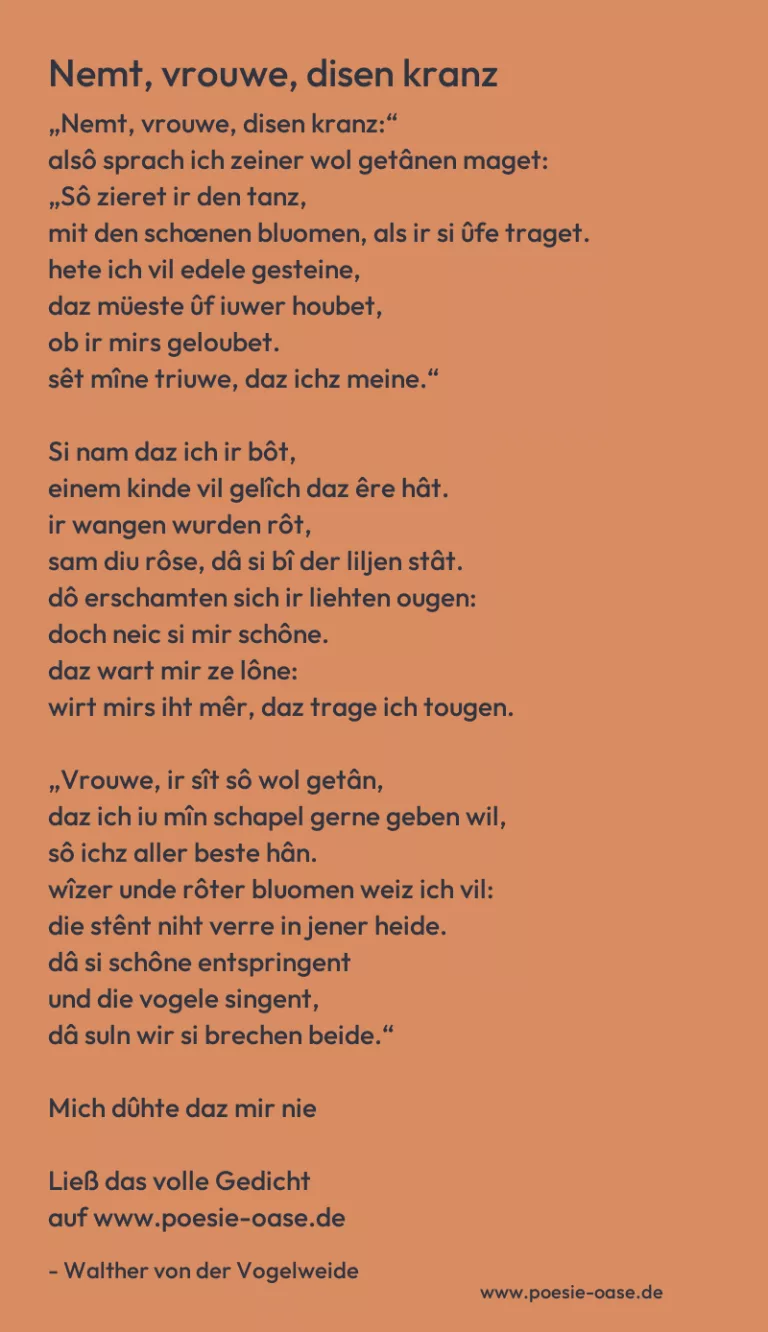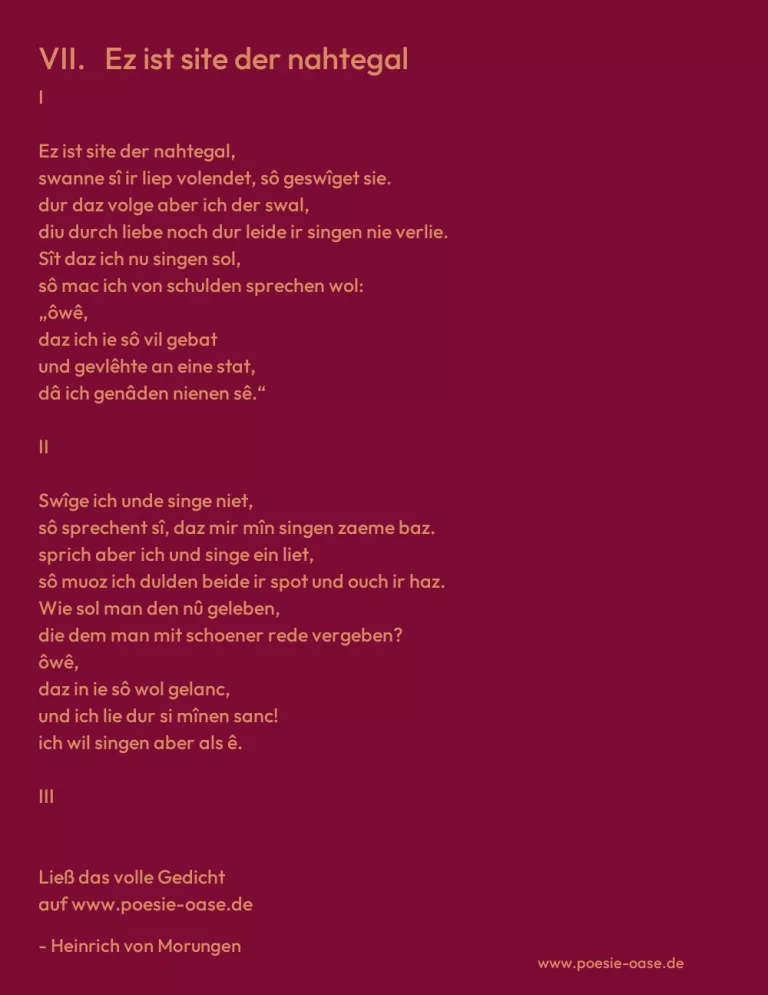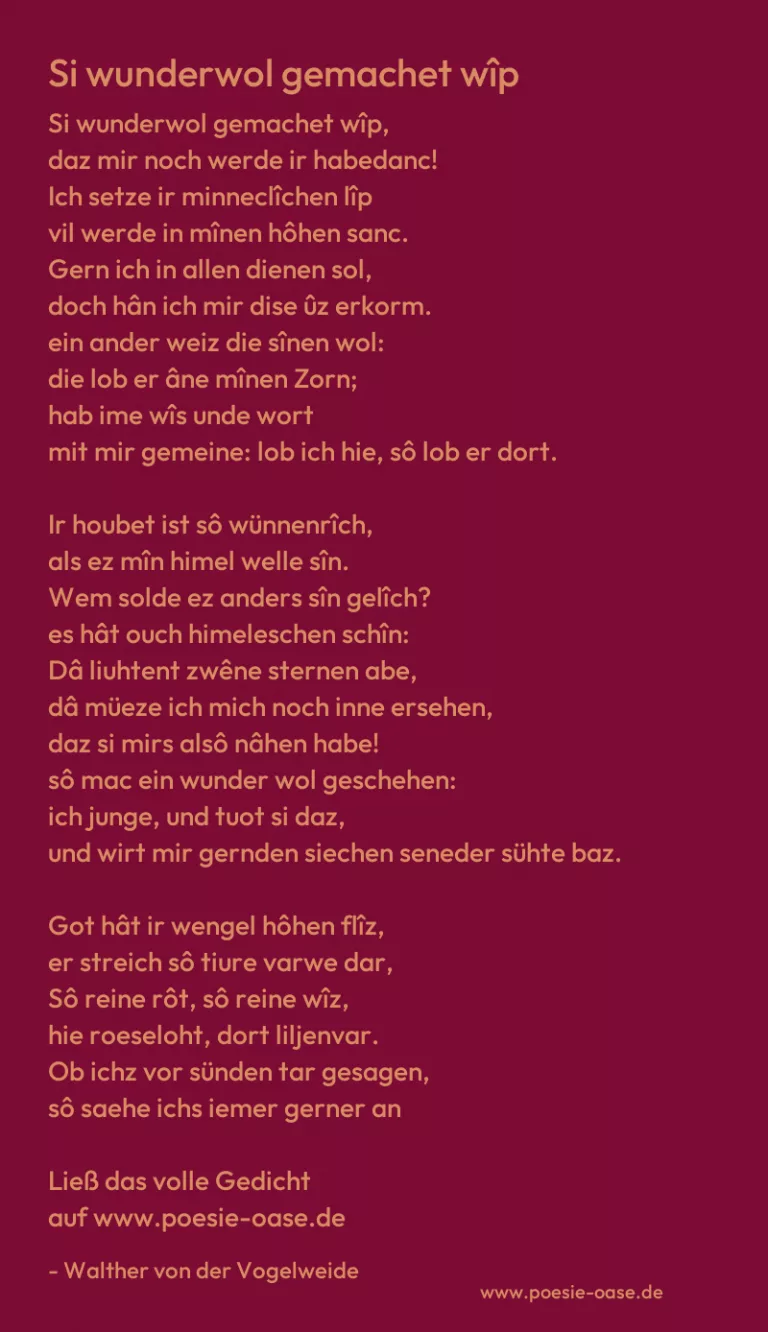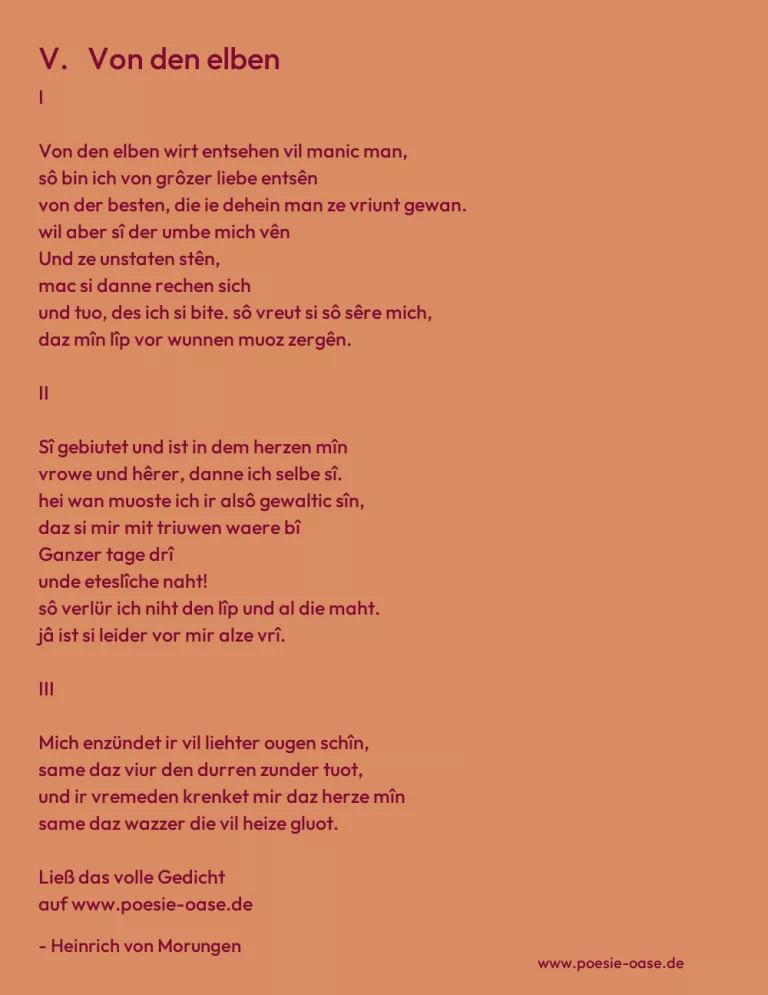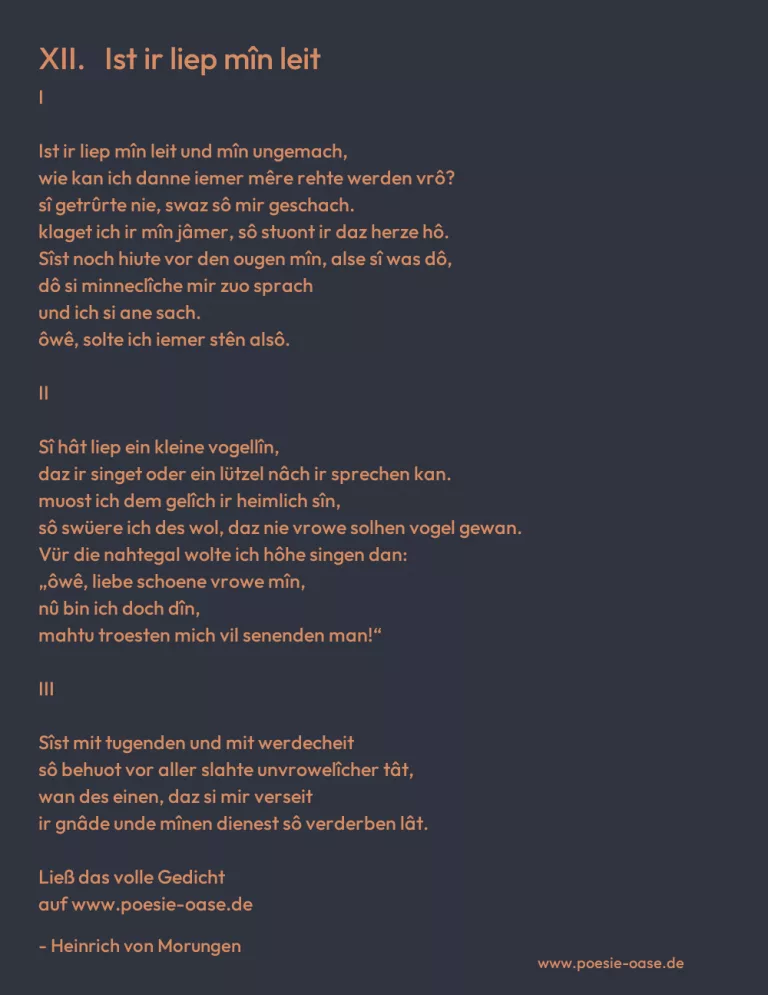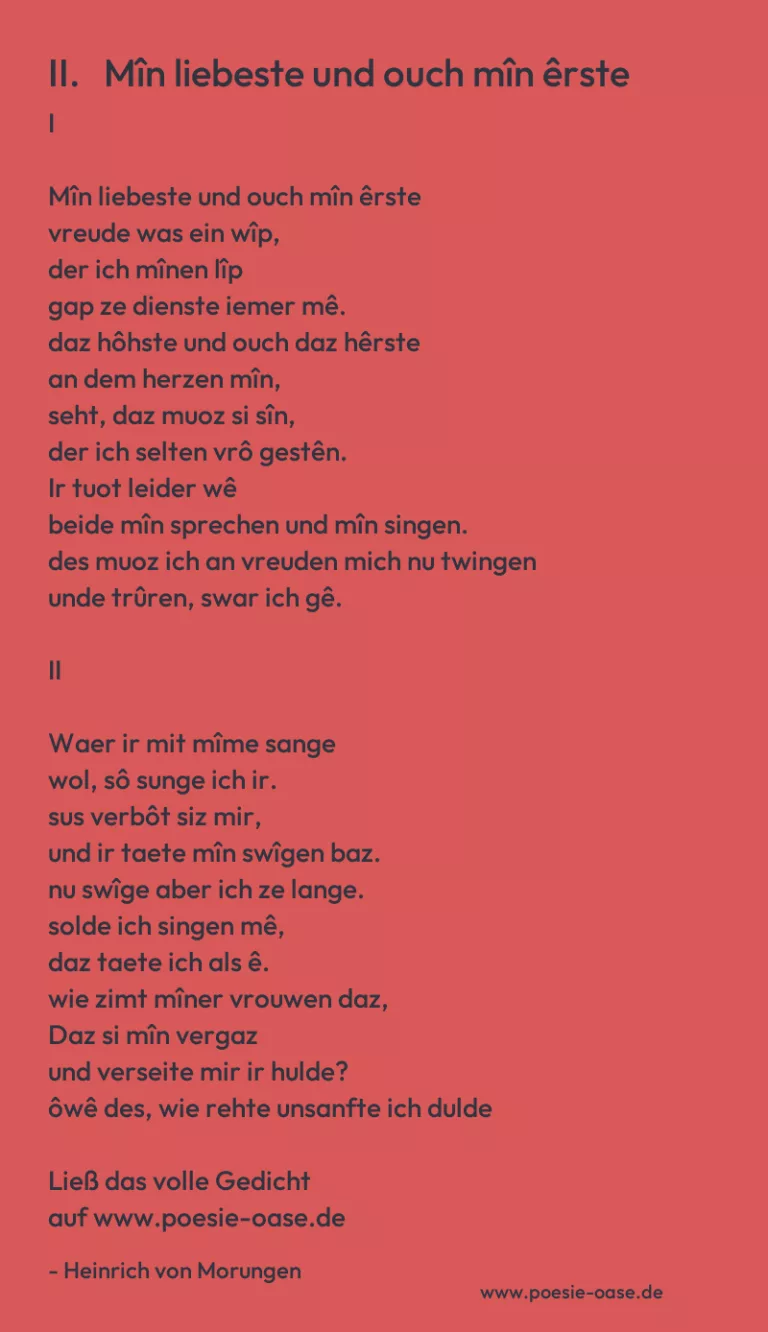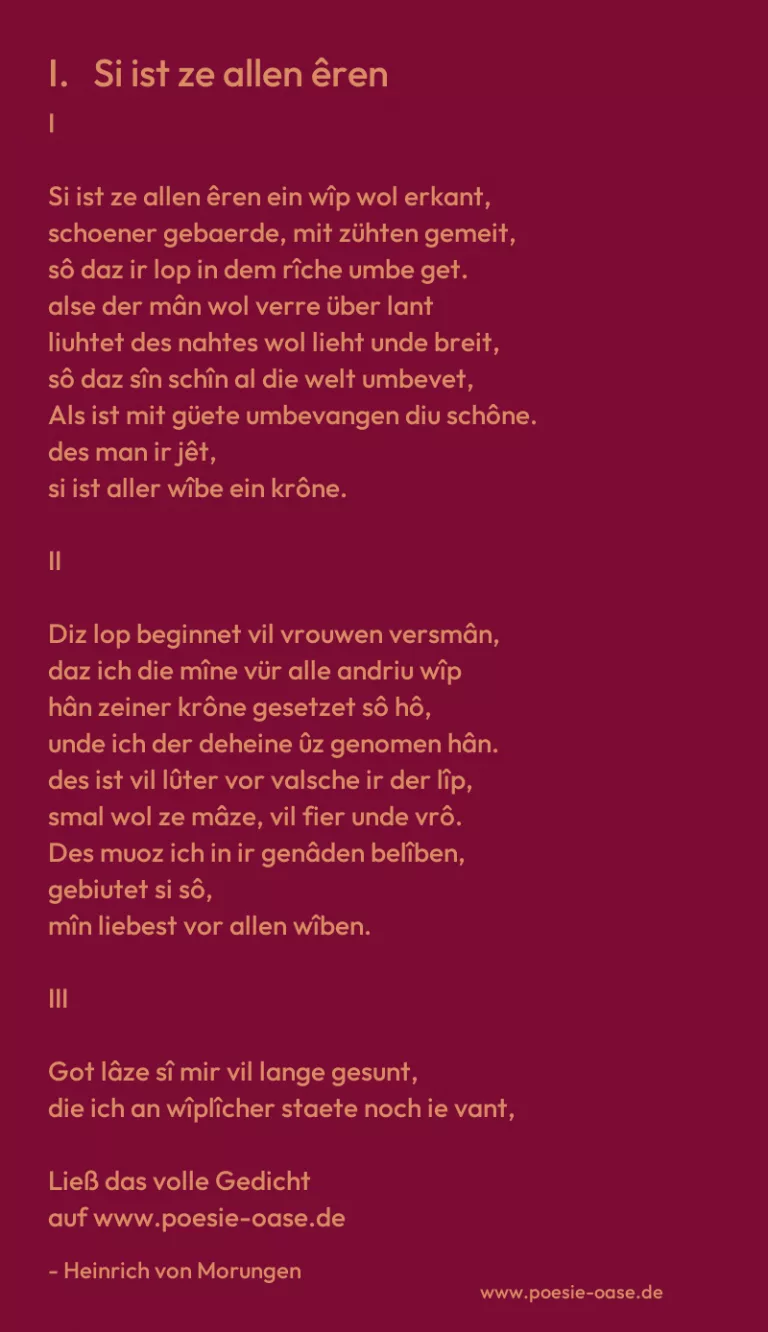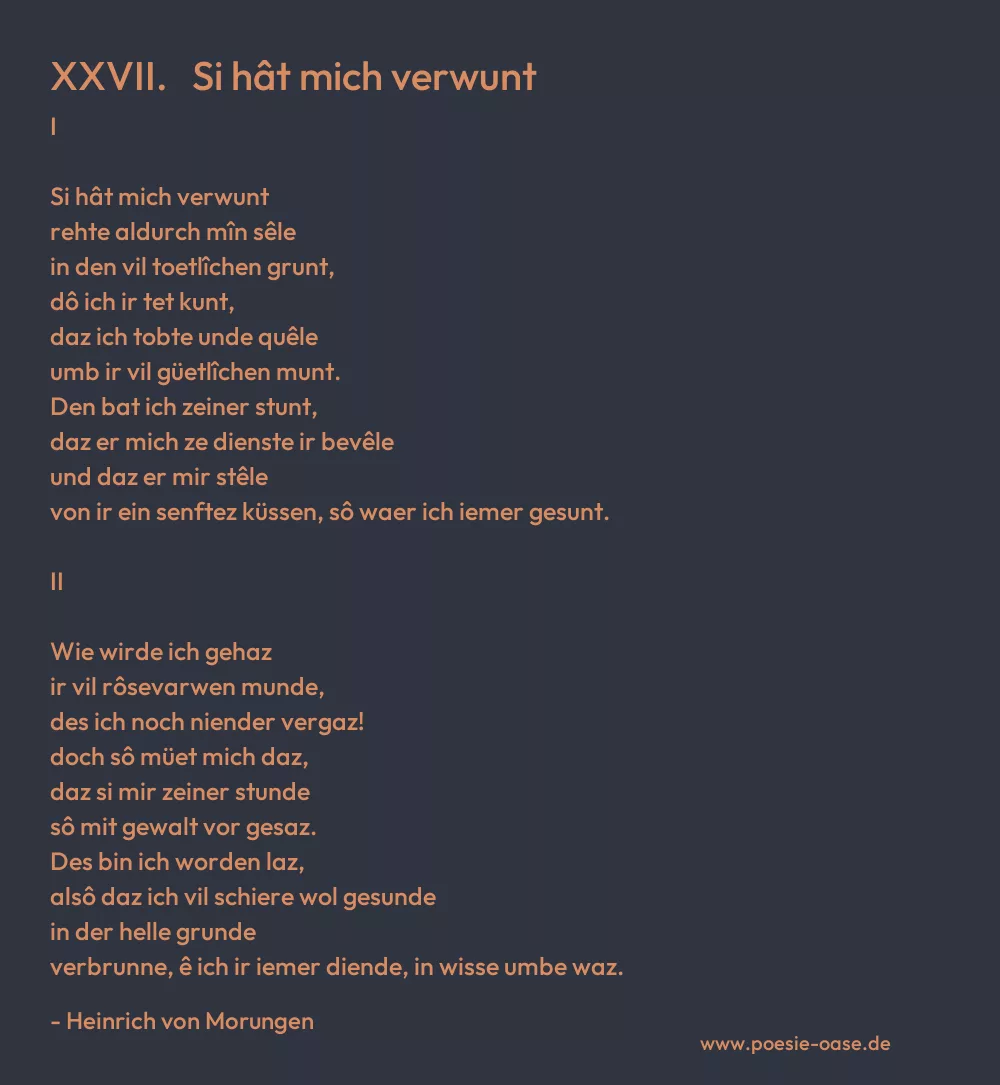XXVII. Si hât mich verwunt
I
Si hât mich verwunt
rehte aldurch mîn sêle
in den vil toetlîchen grunt,
dô ich ir tet kunt,
daz ich tobte unde quêle
umb ir vil güetlîchen munt.
Den bat ich zeiner stunt,
daz er mich ze dienste ir bevêle
und daz er mir stêle
von ir ein senftez küssen, sô waer ich iemer gesunt.
II
Wie wirde ich gehaz
ir vil rôsevarwen munde,
des ich noch niender vergaz!
doch sô müet mich daz,
daz si mir zeiner stunde
sô mit gewalt vor gesaz.
Des bin ich worden laz,
alsô daz ich vil schiere wol gesunde
in der helle grunde
verbrunne, ê ich ir iemer diende, in wisse umbe waz.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
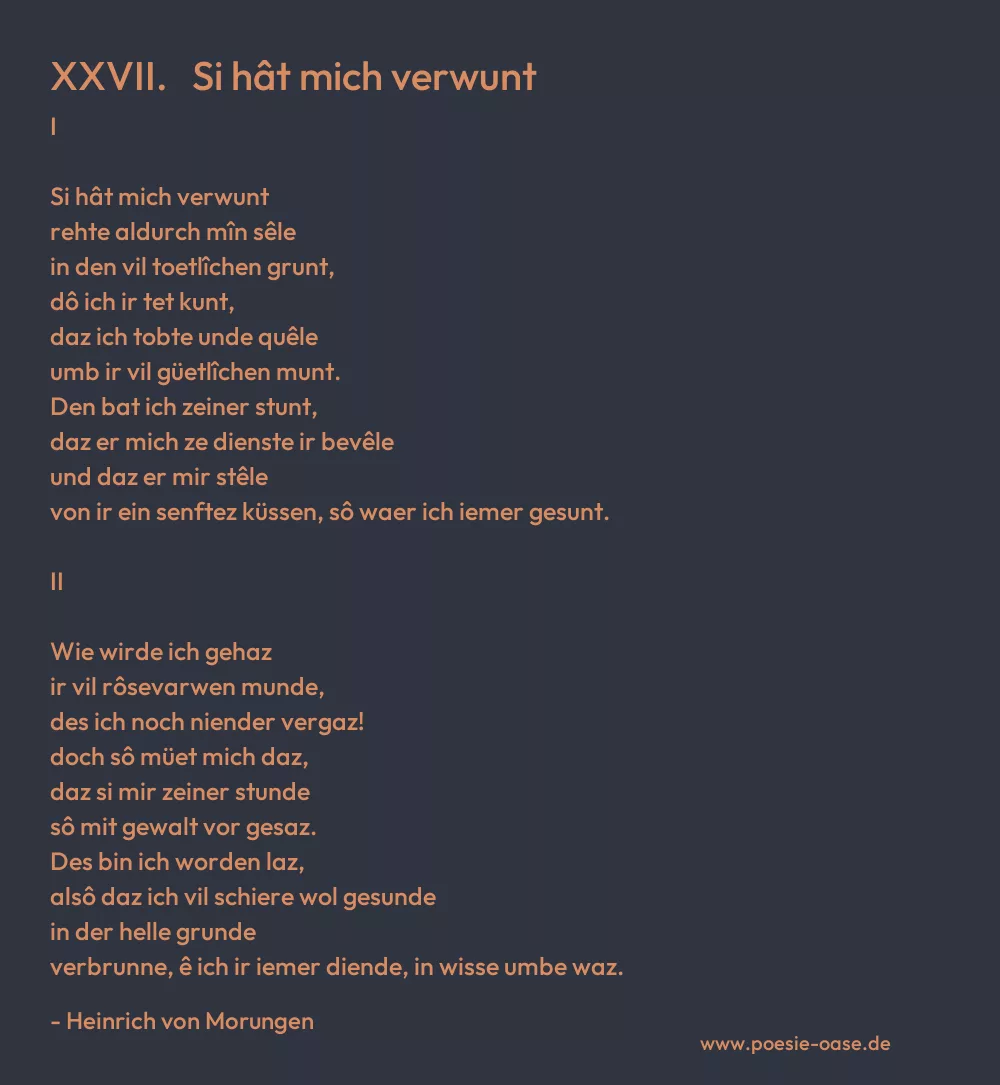
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Si hât mich verwunt“ von Heinrich von Morungen ist eine eindrückliche Klage über die zerstörerische Macht unerwiderter Liebe. In leidenschaftlicher Sprache beschreibt das lyrische Ich, wie tief es durch den Anblick und die Zurückweisung der Geliebten verwundet wurde – nicht körperlich, sondern in der „sêle“, also im innersten Wesen. Dabei wird die Liebe als tödlich und zugleich heilend imaginiert.
Bereits in der ersten Strophe wird deutlich, dass der Ursprung des Schmerzes im begehrten, aber unerreichbaren „güetlîchen munt“ liegt – dem schönen, freundlichen Mund der Geliebten. Die Bitte um ein „senftez küssen“, ein zartes Küssen, bleibt unerfüllt, obwohl das Ich gerade darin die einzige Möglichkeit zur Heilung sieht. Die Verwundung wird nicht als Wunde am Körper, sondern als tiefer Seelenschmerz beschrieben, der in den „toetlîchen grunt“ reicht – einen tödlichen Abgrund.
In der zweiten Strophe intensiviert sich die Klage. Das lyrische Ich betont, dass es den „rôsevarwen munde“ – also den rosig gefärbten Mund der Geliebten – nie vergessen hat. Dennoch fühlt es sich durch ihre Zurückweisung so tief verletzt, dass es den Zustand des Lebens beinahe verlässt. Die drastische Aussage, dass es lieber in der „helle grunde verbrunne“ (in der Hölle verbrennen) wolle, als nie ihrer Liebe zu dienen, verdeutlicht die völlige Hingabe und Verzweiflung.
Die antithetischen Kräfte von Begehren und Verzicht, Hoffnung und Schmerz prägen das Gedicht. Der Kuss wird zur Chiffre für Erfüllung, ja für Erlösung, während die Abweisung durch die Geliebte zur Quelle tödlichen Leidens wird. Dennoch bleibt das Ich in seiner Liebe treu und leidensbereit, was dem Text seine typische minnedienstliche Tiefe verleiht.
Heinrich von Morungen bringt hier auf besonders konzentrierte Weise die existenzielle Dimension der höfischen Liebe zum Ausdruck: eine Liebe, die das ganze Wesen beansprucht, aber selten erfüllt wird – und gerade dadurch in ihrer Intensität überhöht erscheint.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.