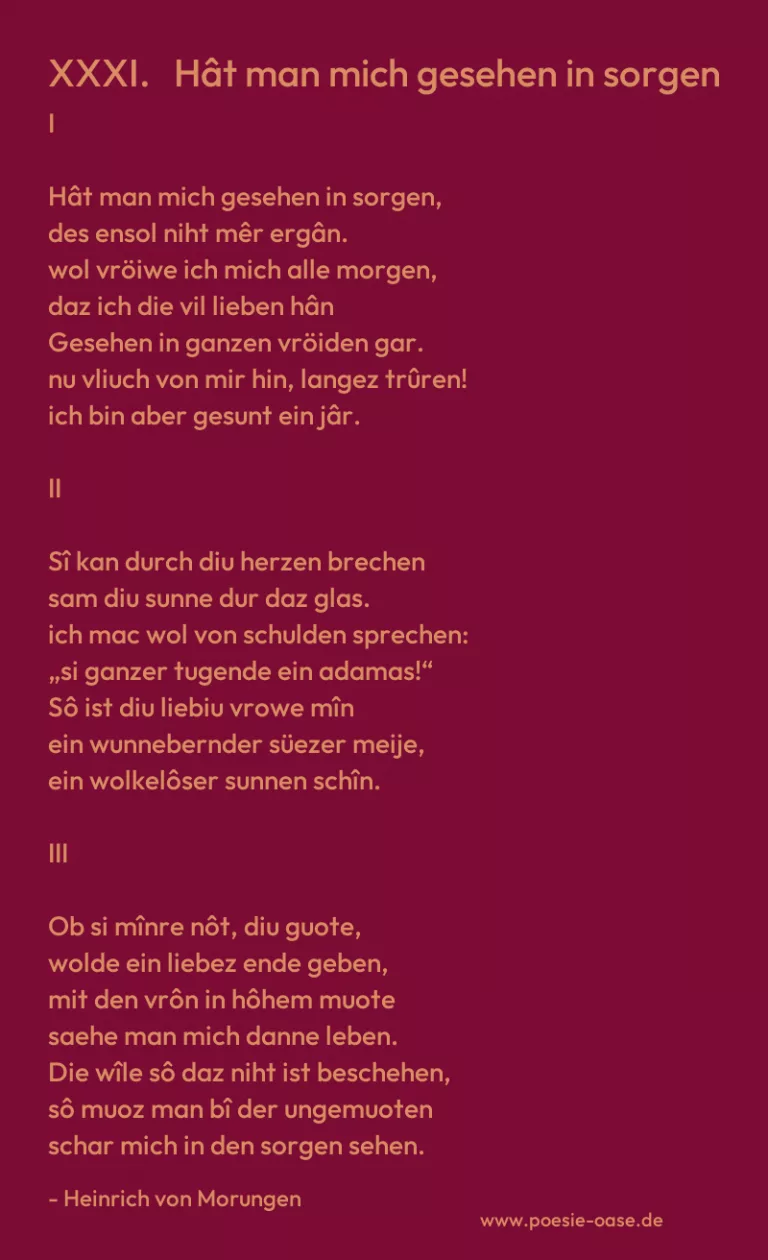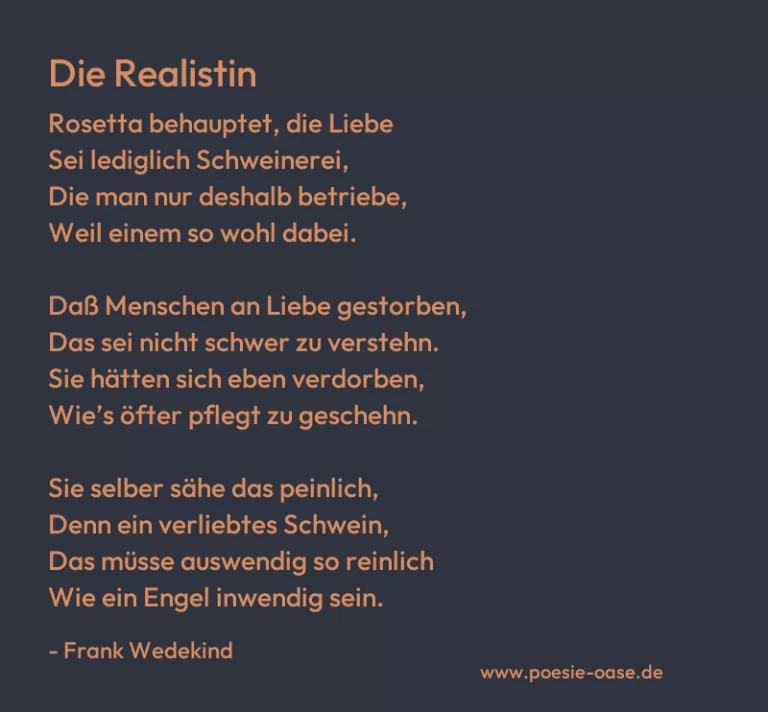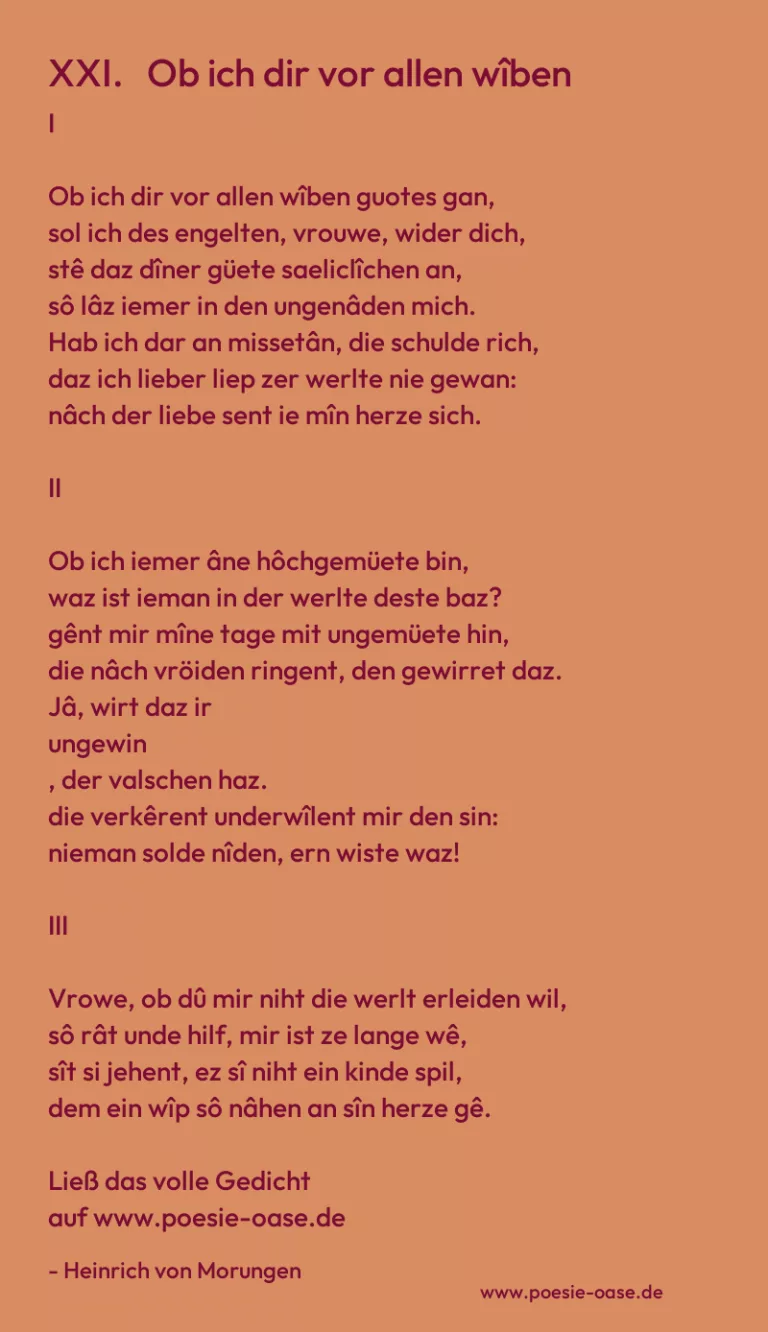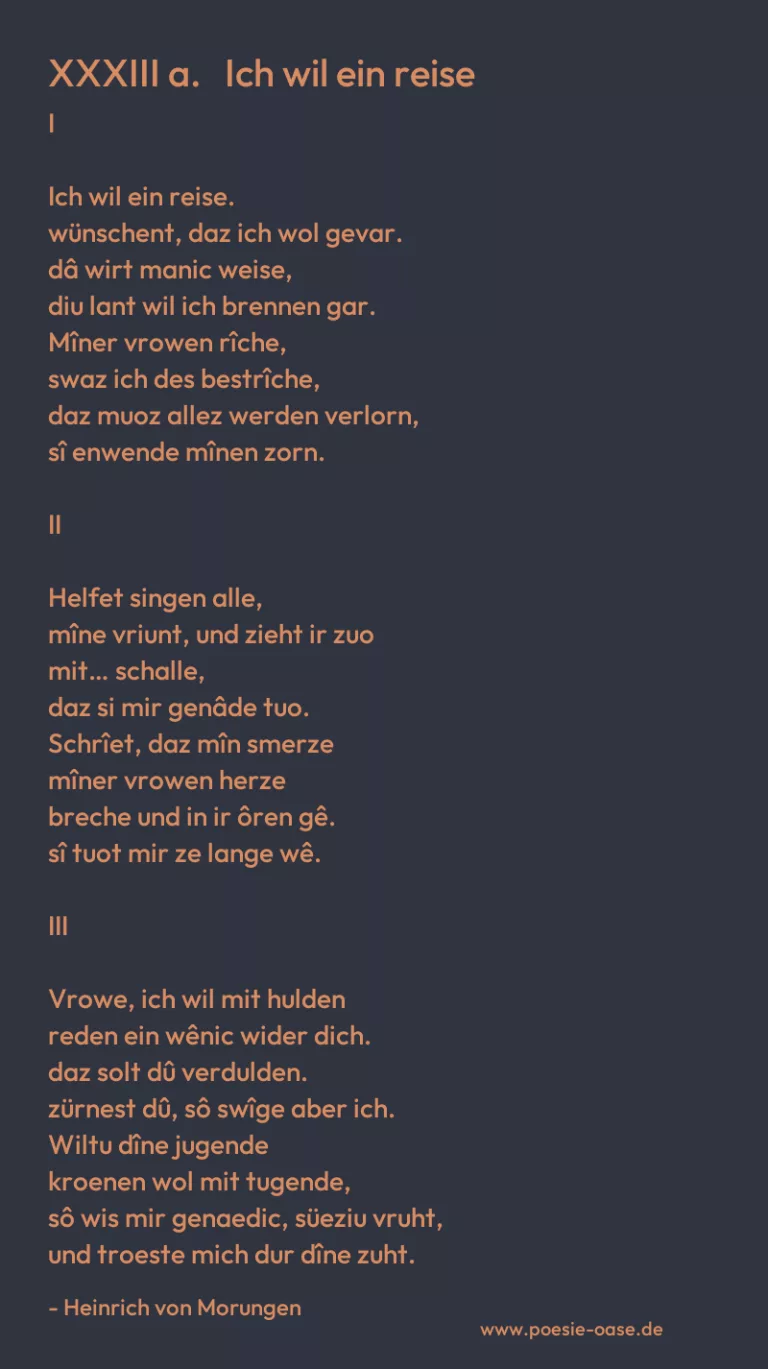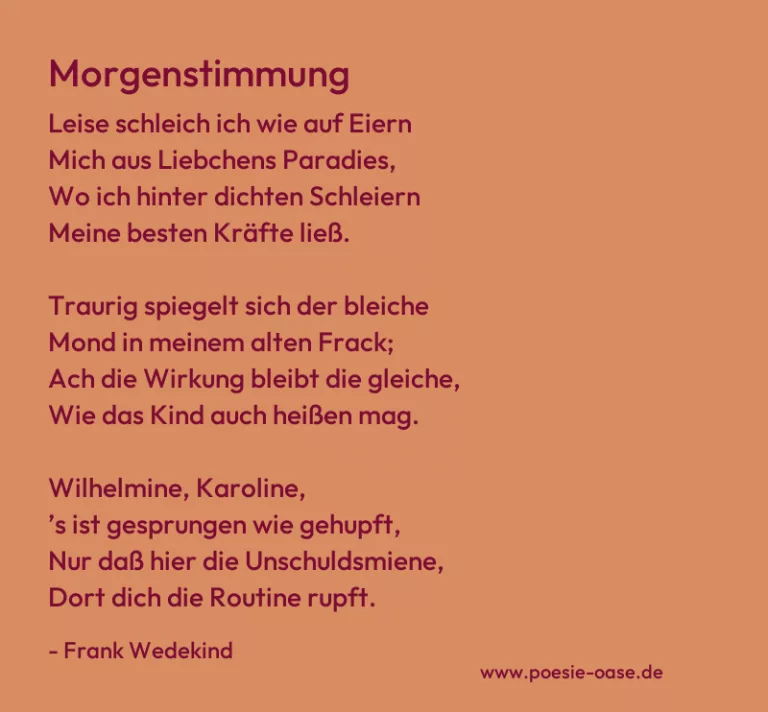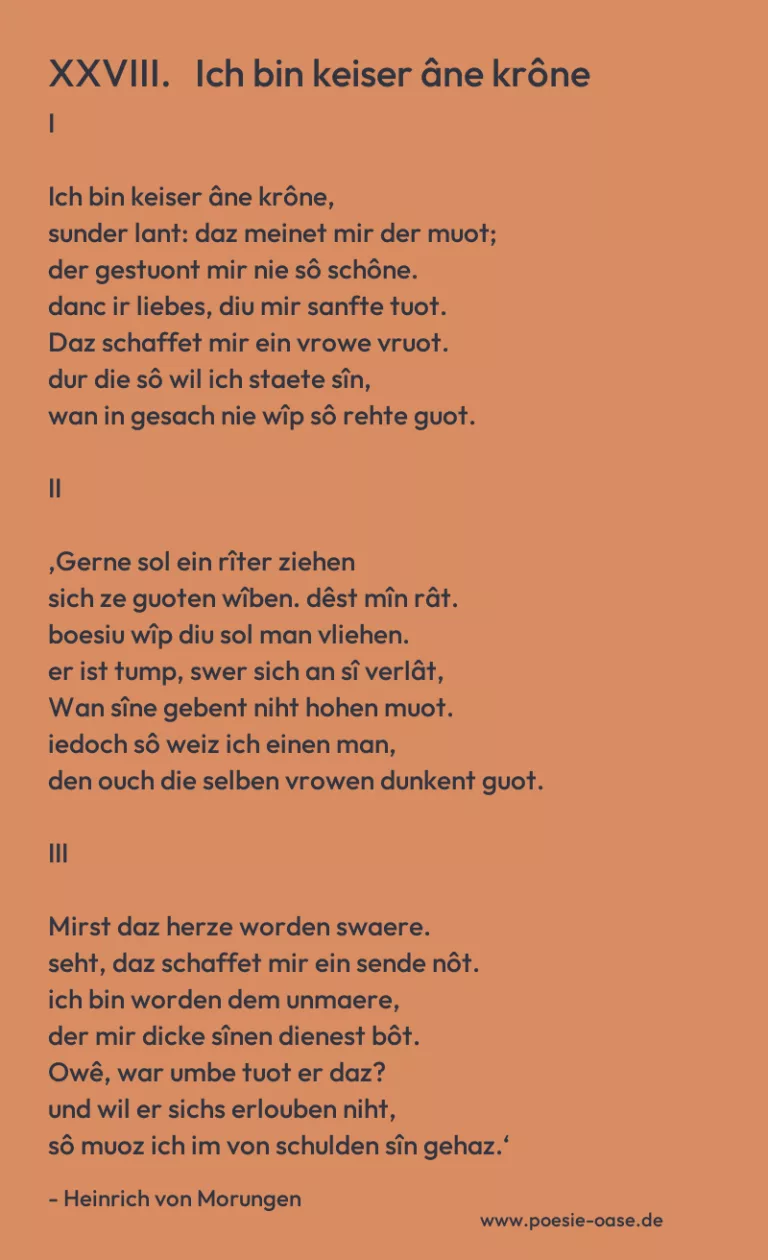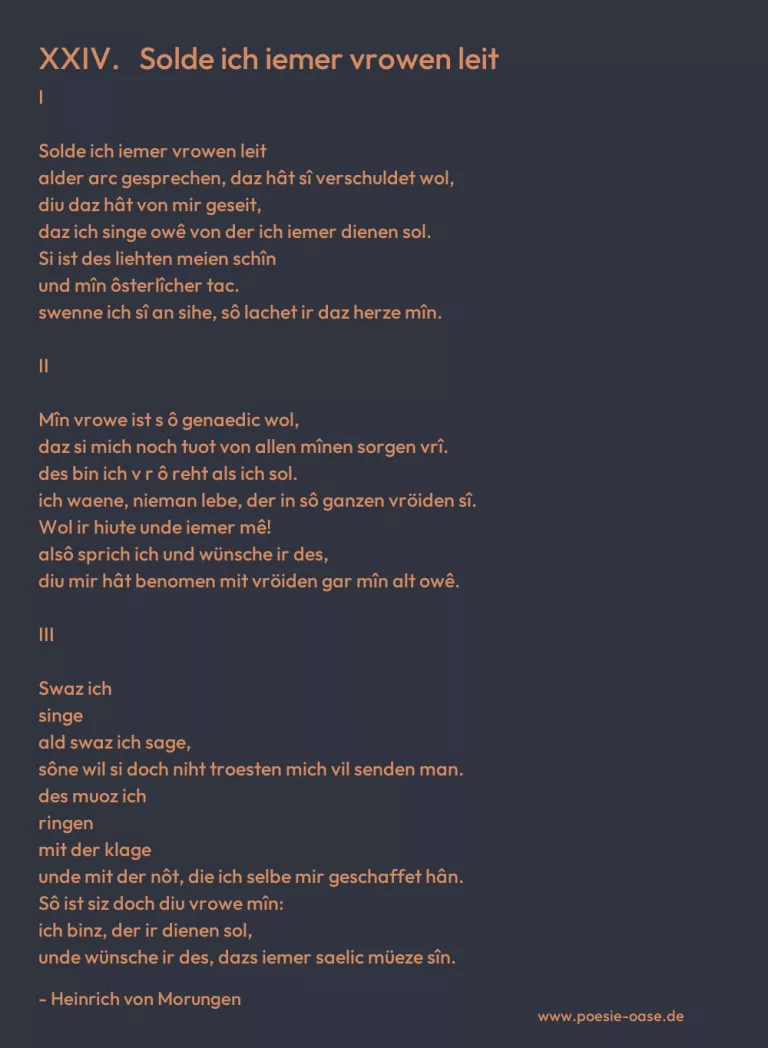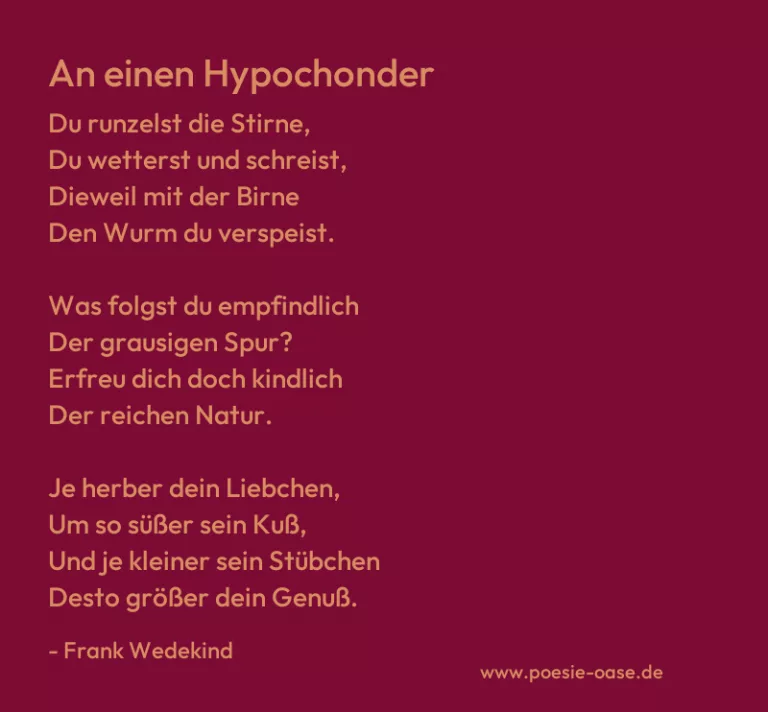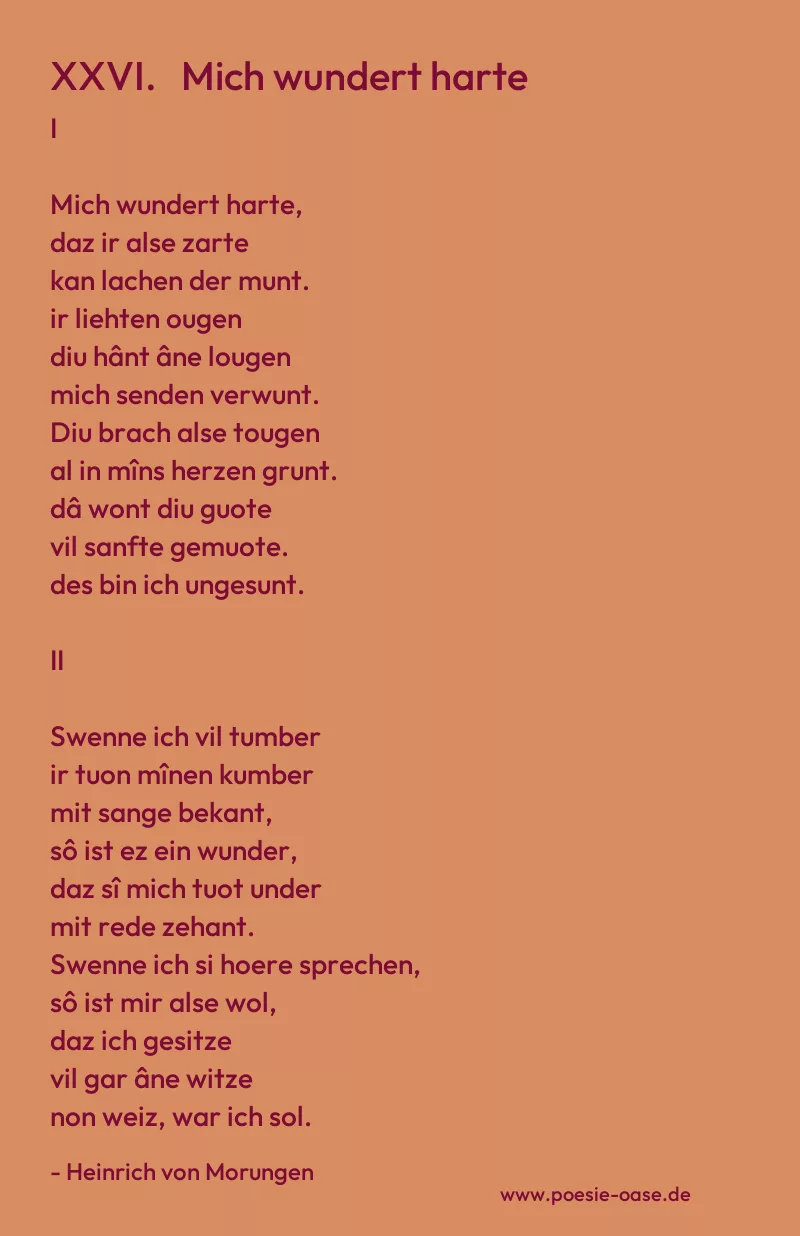XXVI. Mich wundert harte
I
Mich wundert harte,
daz ir alse zarte
kan lachen der munt.
ir liehten ougen
diu hânt âne lougen
mich senden verwunt.
Diu brach alse tougen
al in mîns herzen grunt.
dâ wont diu guote
vil sanfte gemuote.
des bin ich ungesunt.
II
Swenne ich vil tumber
ir tuon mînen kumber
mit sange bekant,
sô ist ez ein wunder,
daz sî mich tuot under
mit rede zehant.
Swenne ich si hoere sprechen,
sô ist mir alse wol,
daz ich gesitze
vil gar âne witze
non weiz, war ich sol.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
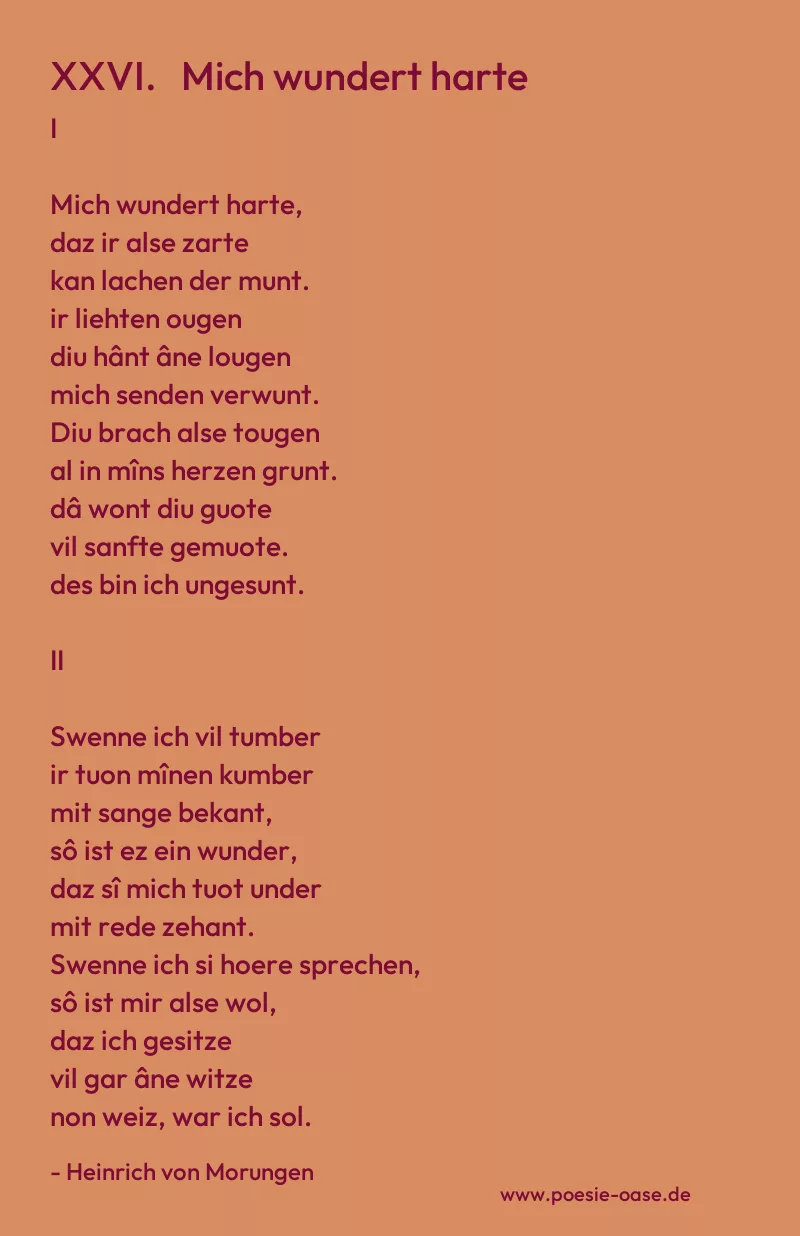
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Mich wundert harte“ von Heinrich von Morungen beschreibt die überwältigende Wirkung der Geliebten auf das lyrische Ich in einer zarten, fast staunenden Tonlage. Es handelt sich um eine Darstellung der Minne, die sich ganz auf das sinnliche Erleben konzentriert: den Blick, das Lächeln, die Stimme der Frau – und wie diese Eindrücke das Ich völlig aus der Fassung bringen.
In der ersten Strophe zeigt sich das lyrische Ich tief verwundert darüber, wie etwas so Zartes und Schönes wie der Mund der Geliebten „kan lachen“, also lachen kann. Die Augen, die „âne lougen“, also ohne Lüge, ihn verwunden, treffen ihn direkt im Herzen. Besonders auffällig ist die Bildlichkeit: Der Pfeil des Blickes durchdringt heimlich den „grunt“ seines Herzens. Ihre Wirkung auf ihn ist so stark, dass er krank („ungesunt“) ist – nicht körperlich, sondern aus Liebessehnsucht. Die Geliebte wird zum Ursprung seiner inneren Unruhe.
Die zweite Strophe beschreibt das Unvermögen des Sprechers, seine Gefühle angemessen auszudrücken. Wenn er seinen „Kumber“ (Liebeskummer) im Gesang offenbart, ist er wie ein „tumbe[r]“ – also naiver oder einfacher Mensch. Noch bevor er sich erklären kann, wird er durch die Rede der Geliebten „unter“ getan, also sprachlich und emotional übertroffen. Allein ihr Sprechen erfüllt ihn mit solcher Freude, dass er sich wie benommen fühlt und nicht mehr weiß, „war ich sol“ – wo er hingehört. Die Geliebte stiftet also nicht nur Verwirrung, sondern entzieht ihm Orientierung und Selbstgewissheit.
In beiden Strophen dominiert das Motiv der völligen Überwältigung durch äußere Schönheit und innere Güte. Die Liebe zeigt sich nicht als geregelter höfischer Dienst, sondern als unmittelbares, fast kindlich erstauntes Erleben. Morungen gelingt es, in einfacher, klangvoller Sprache eine tiefe emotionale Wirkung zu erzeugen: Staunen, Verwirrung, Hingabe. Die Liebe wird hier nicht durch große Gesten, sondern durch kleine Sinneseindrücke beschrieben – gerade dadurch wirkt sie umso eindrucksvoller.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.