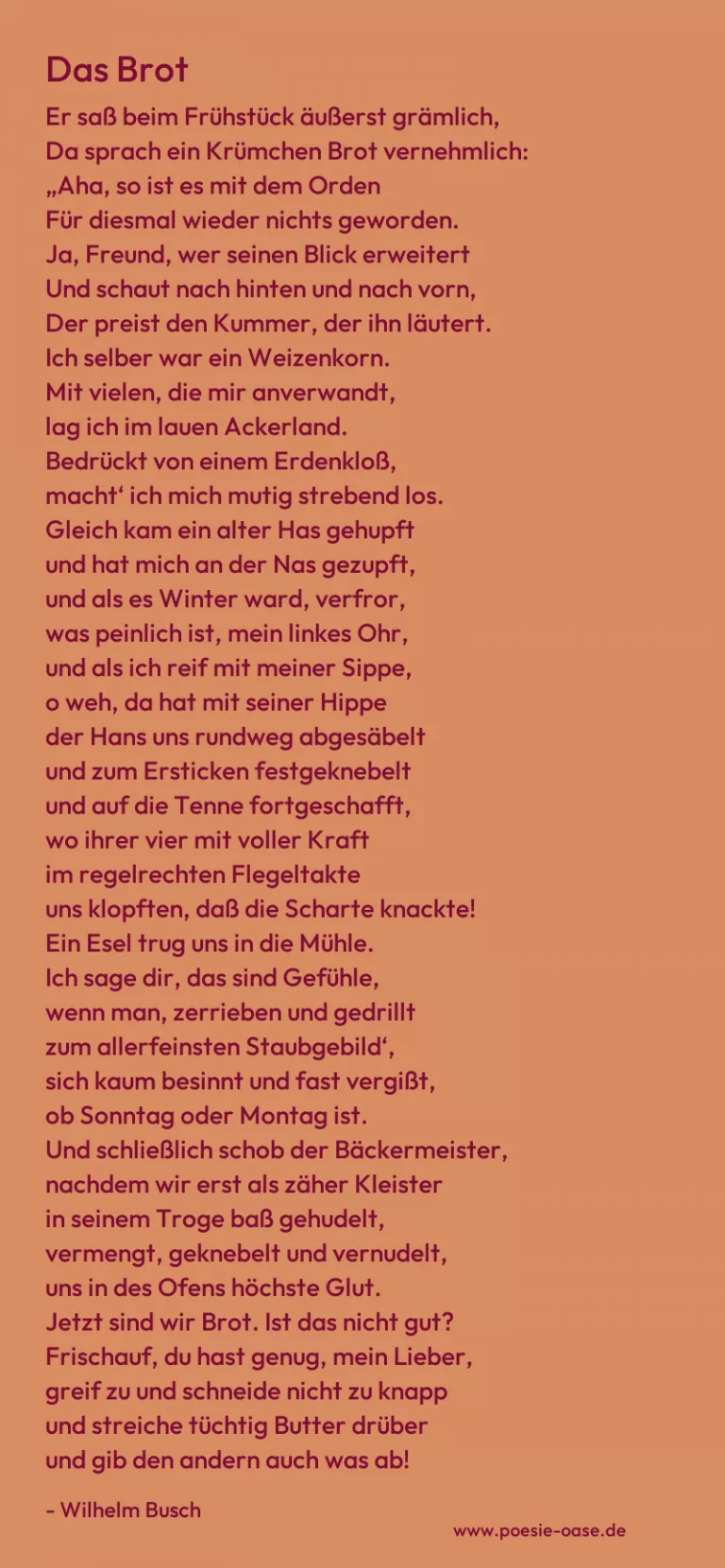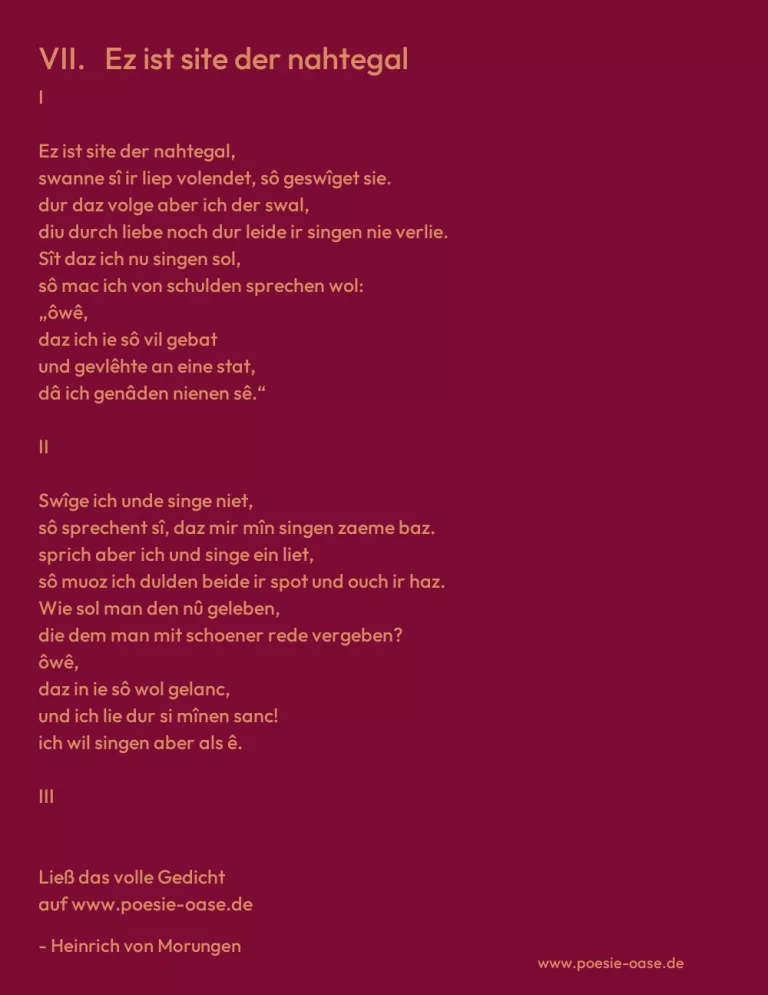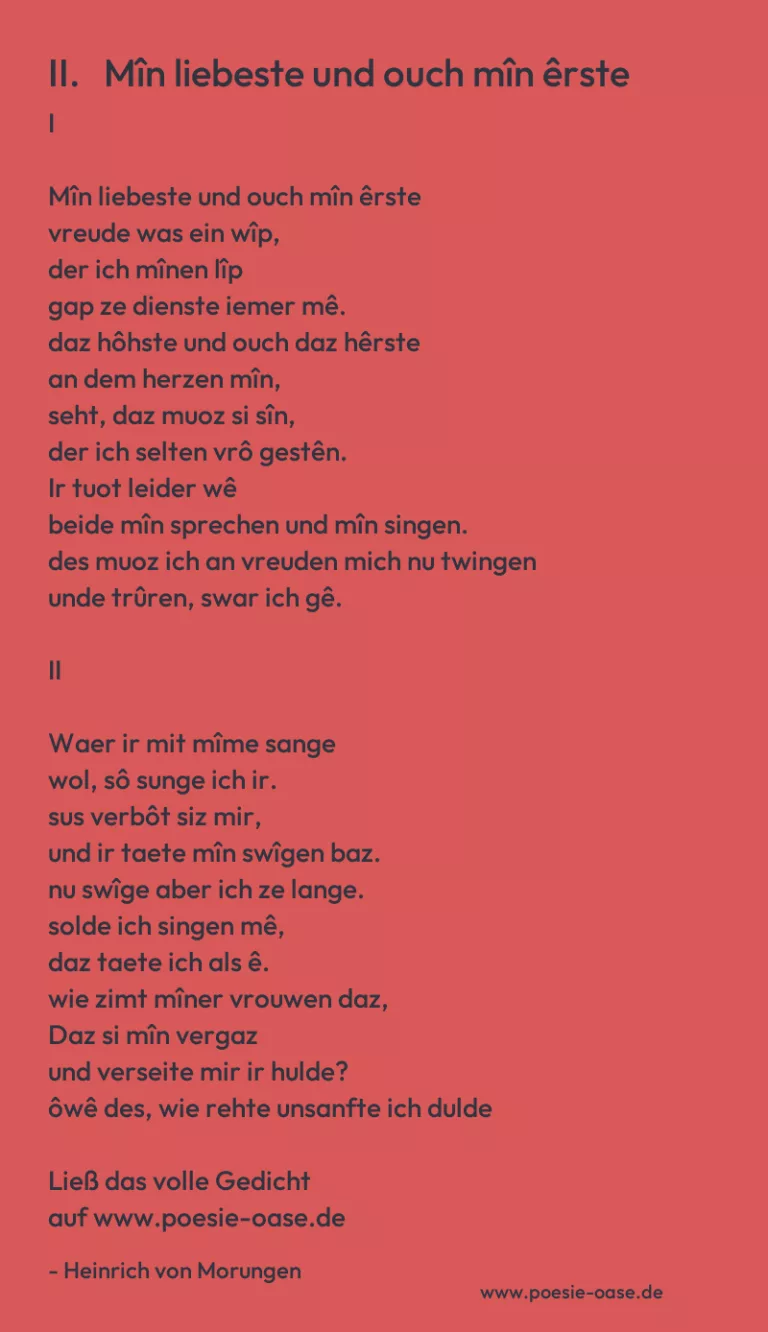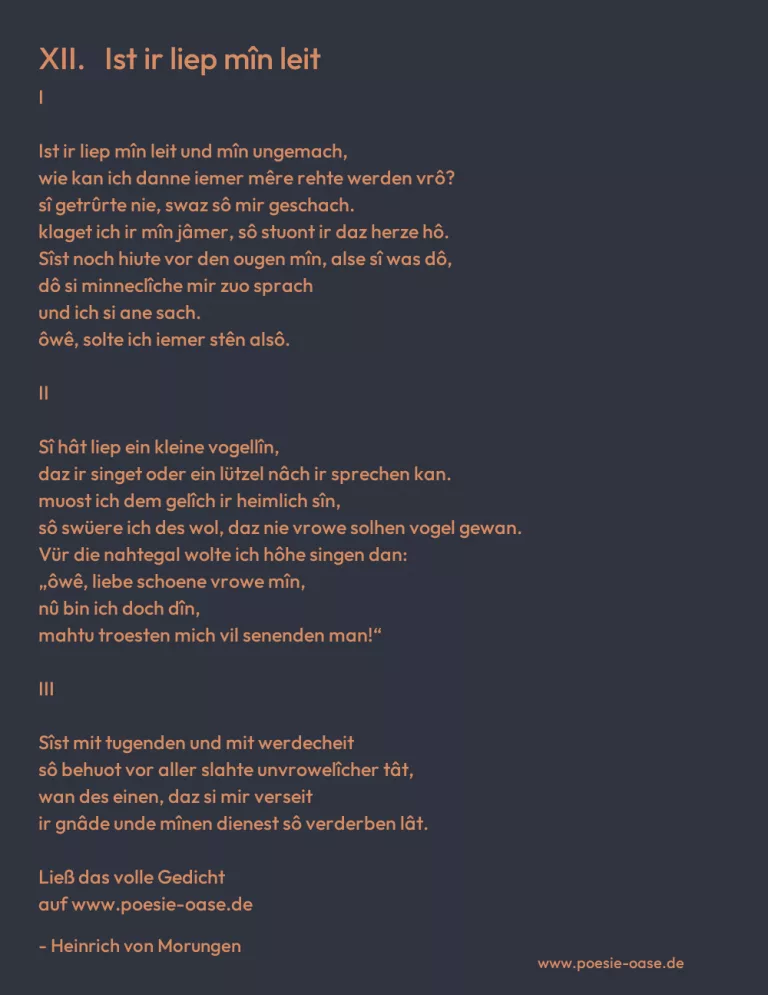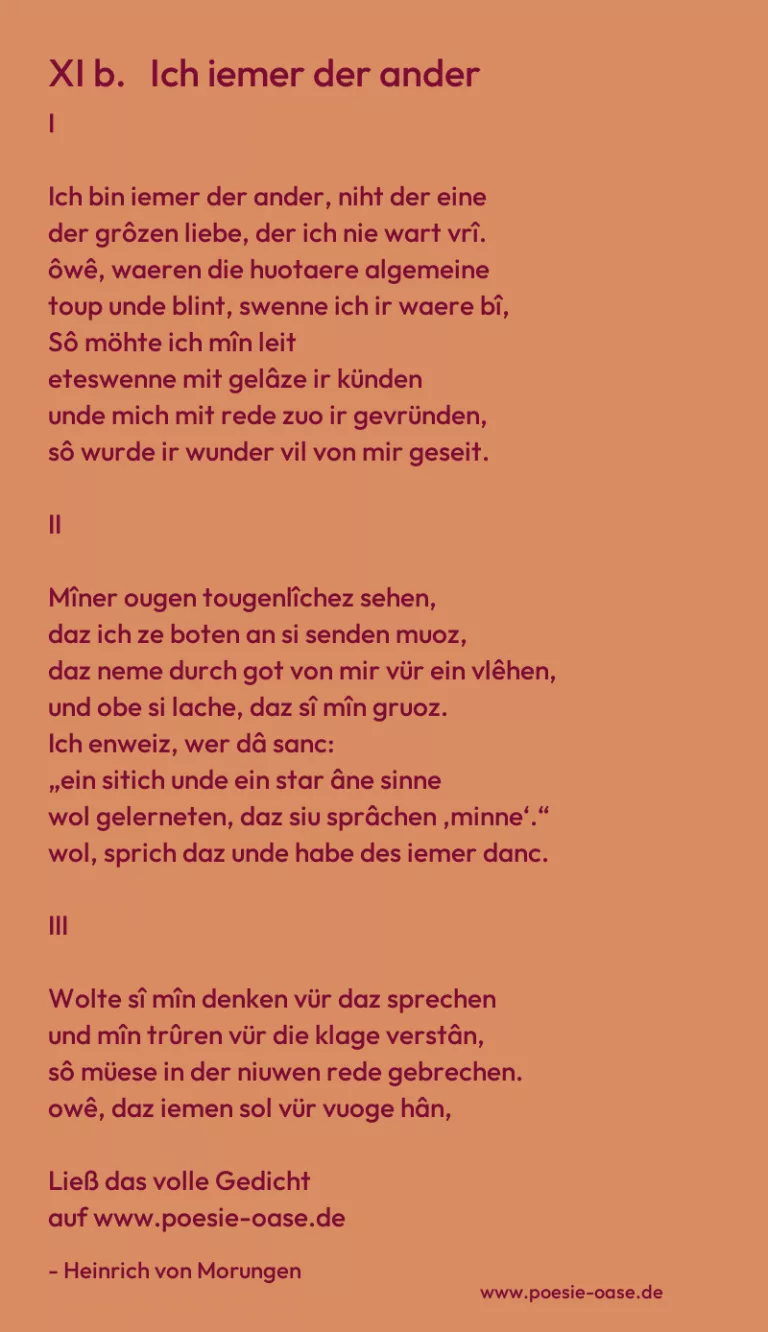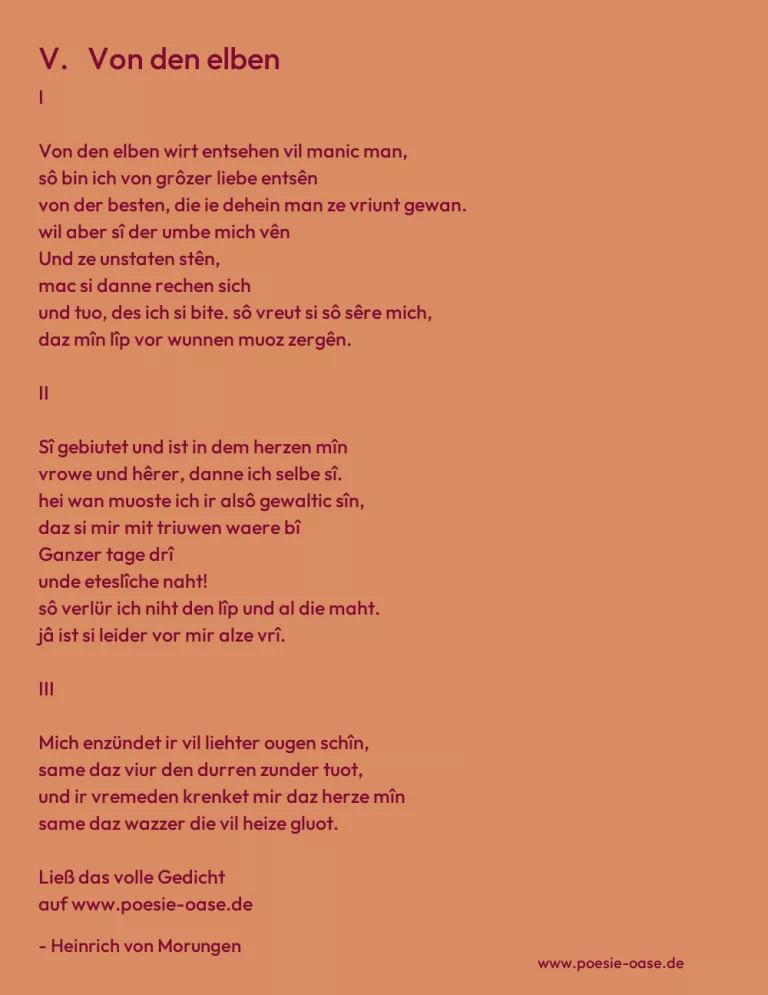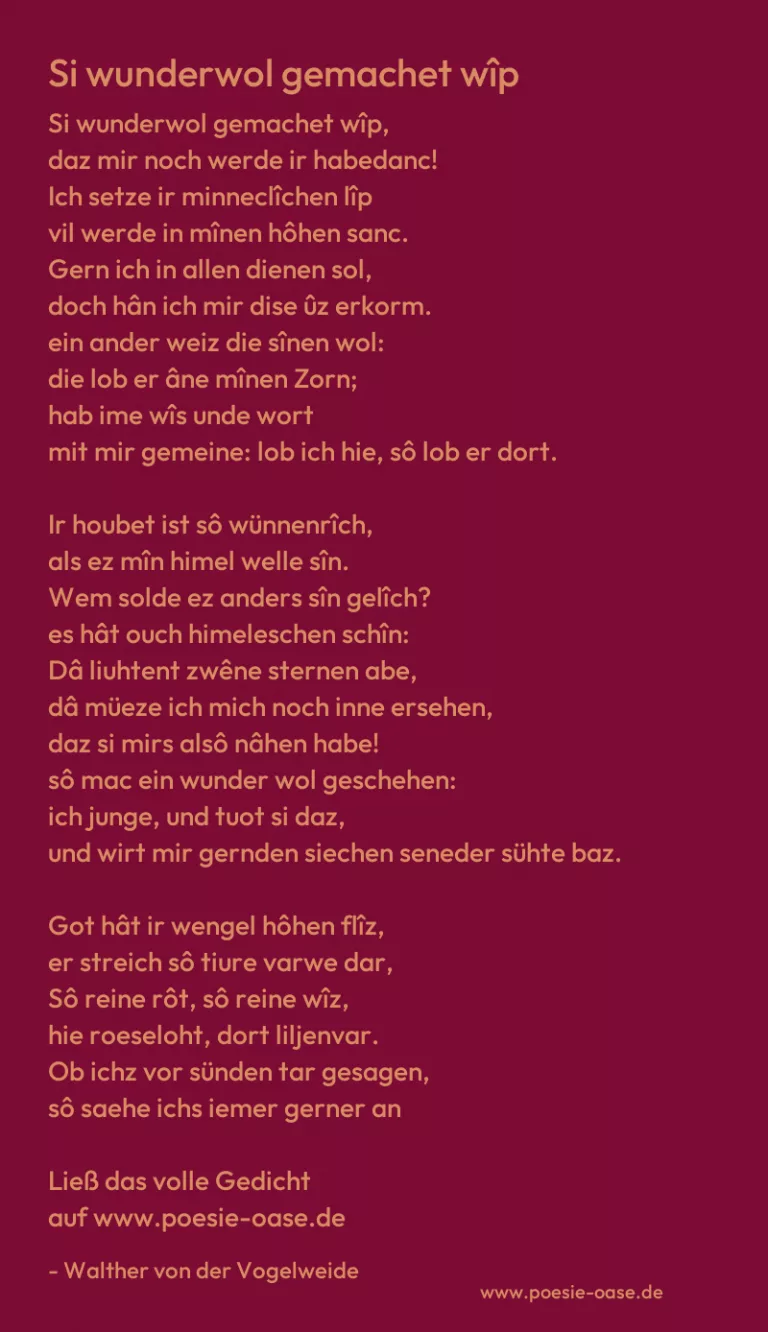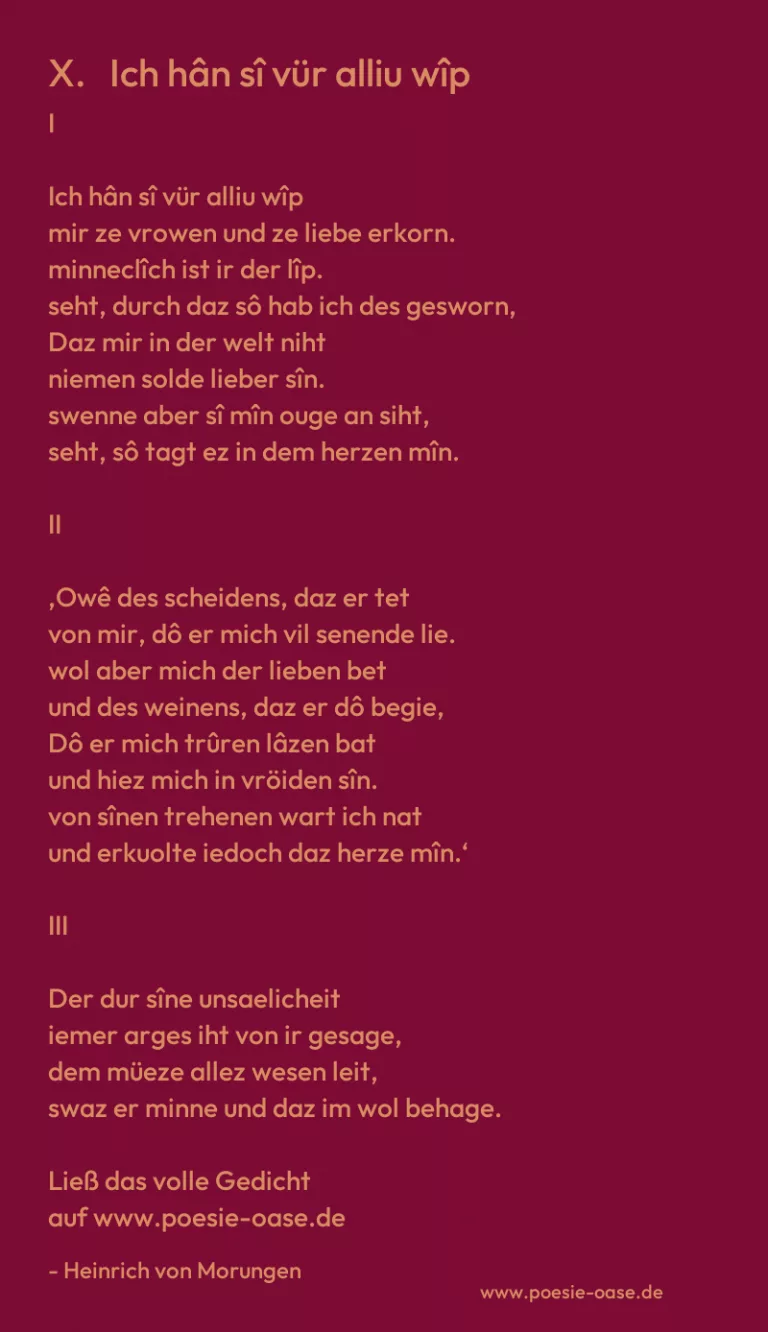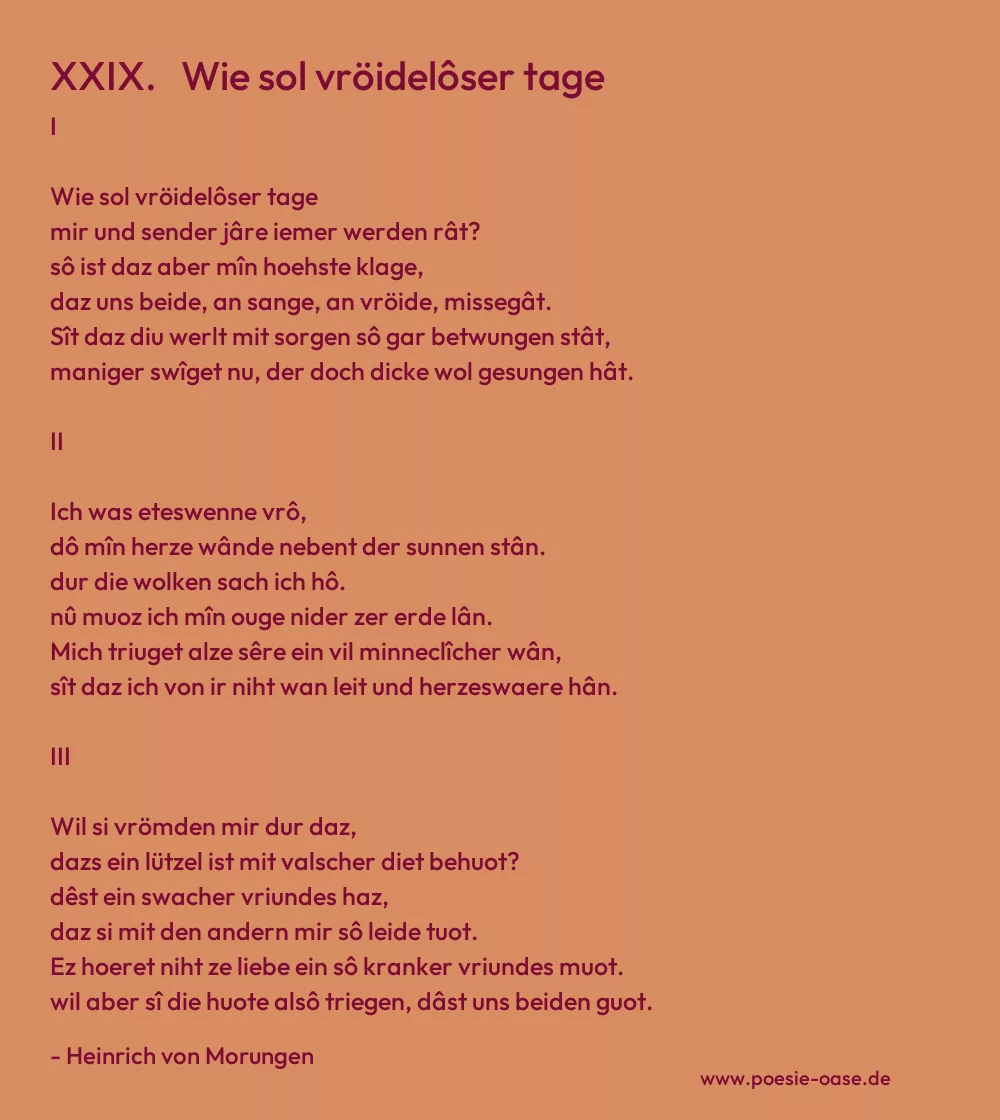XXIX. Wie sol vröidelôser tage
I
Wie sol vröidelôser tage
mir und sender jâre iemer werden rât?
sô ist daz aber mîn hoehste klage,
daz uns beide, an sange, an vröide, missegât.
Sît daz diu werlt mit sorgen sô gar betwungen stât,
maniger swîget nu, der doch dicke wol gesungen hât.
II
Ich was eteswenne vrô,
dô mîn herze wânde nebent der sunnen stân.
dur die wolken sach ich hô.
nû muoz ich mîn ouge nider zer erde lân.
Mich triuget alze sêre ein vil minneclîcher wân,
sît daz ich von ir niht wan leit und herzeswaere hân.
III
Wil si vrömden mir dur daz,
dazs ein lützel ist mit valscher diet behuot?
dêst ein swacher vriundes haz,
daz si mit den andern mir sô leide tuot.
Ez hoeret niht ze liebe ein sô kranker vriundes muot.
wil aber sî die huote alsô triegen, dâst uns beiden guot.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
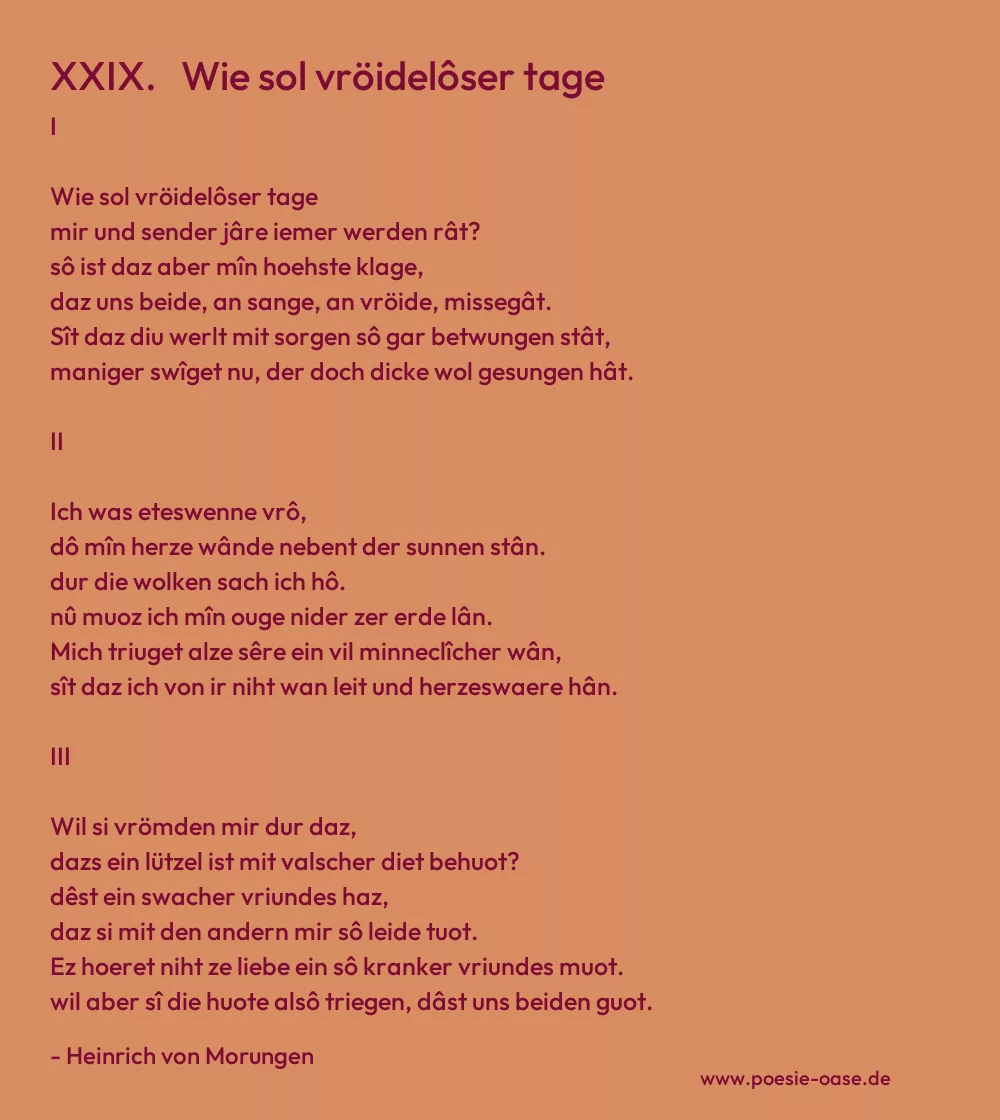
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wie sol vröidelôser tage“ von Heinrich von Morungen drückt die Verzweiflung und den Schmerz des lyrischen Ichs über verlorene Freude und Liebe aus. Im ersten Vers stellt der Sprecher die Frage, wie er in einer Welt ohne Freude und Gesang weiterleben soll. Es wird eine tiefe Traurigkeit über die unaufhörlichen Sorgen der Welt zum Ausdruck gebracht, die selbst diejenigen, die einst voller Freude und Gesang waren, zum Schweigen bringt. Diese Klage über die gegenwärtige Welt deutet auf eine Zeit des inneren Konflikts und der Enttäuschung hin.
Im zweiten Abschnitt erinnert sich der Sprecher an frühere Zeiten, als sein Herz noch voller Freude war und er die Sonne am Himmel sah. Doch nun hat er das Gefühl, in Dunkelheit gefangen zu sein, da Wolken den Himmel bedecken. Diese Veränderung symbolisiert den Verlust der Hoffnung und die Entfremdung von der einstigen Leichtigkeit des Lebens. Die „Minneclîcher wân“ (die trügerische Hoffnung der Liebe) trügt den Sprecher weiterhin, doch sie führt nur zu Schmerz und Enttäuschung, anstatt zu der ersehnten Erfüllung.
Im letzten Abschnitt des Gedichts spricht der Sprecher von einer Enttäuschung, die durch einen falschen Freund verursacht wurde. Es wird ein tiefer Verrat durch eine vertraute Person beschrieben, der das Vertrauen in Freundschaft und Liebe erschüttert. Der „kranker vriundes muot“ verweist auf die Verzweiflung und die verbitterte Erkenntnis, dass diese falsche Freundschaft die innere Harmonie zerstört hat. Das Gedicht endet mit der bitteren Einsicht, dass der Verrat durch eine enge Beziehung die Suche nach wahrer Liebe und Glück in der Welt erschwert.
Heinrich von Morungen thematisiert in diesem Gedicht das Leid durch verlorene Freude und den Schmerz durch Verrat. Es verbindet eine tiefe persönliche Reflexion über den Verlust von Liebe und Freundschaft mit der Erfahrung einer von Enttäuschung und Schmerz geprägten Welt. Der poetische Ausdruck von Trauer und Enttäuschung wird durch den mittelalterlichen Sprachstil und die klagende Tonalität verstärkt, die dem Gedicht eine melancholische Tiefe verleihen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.