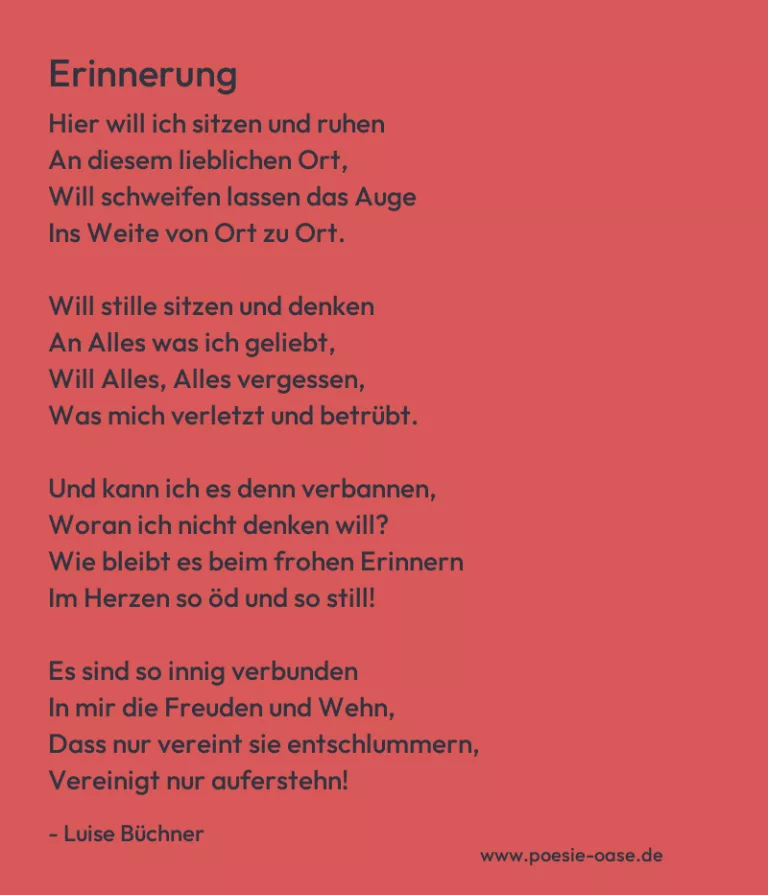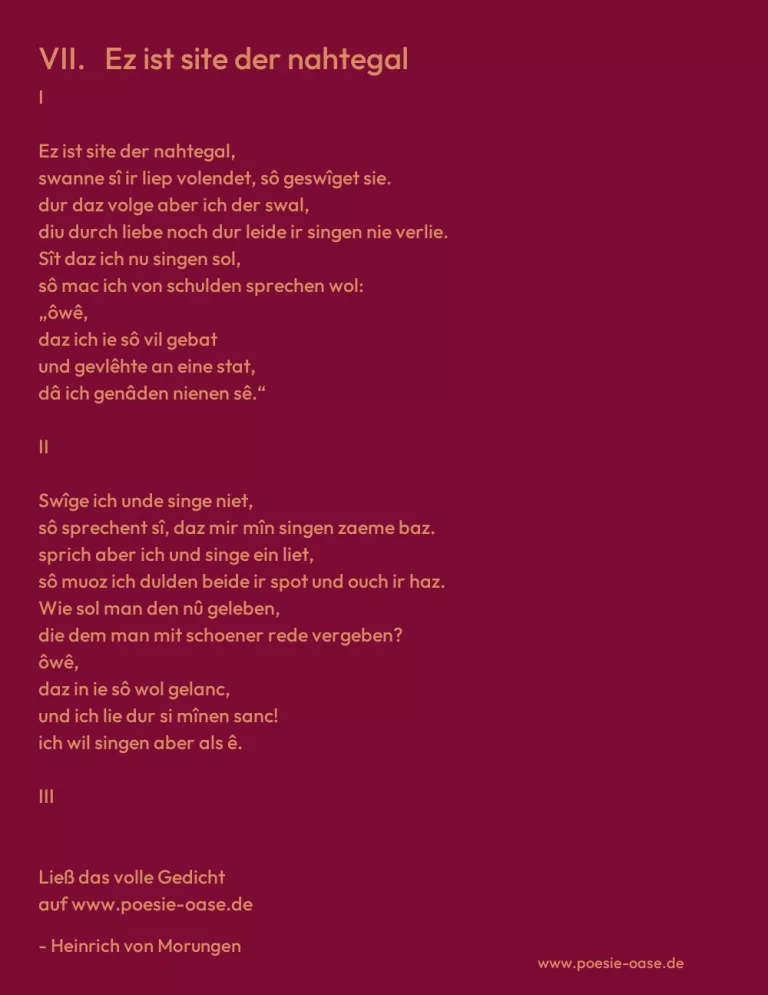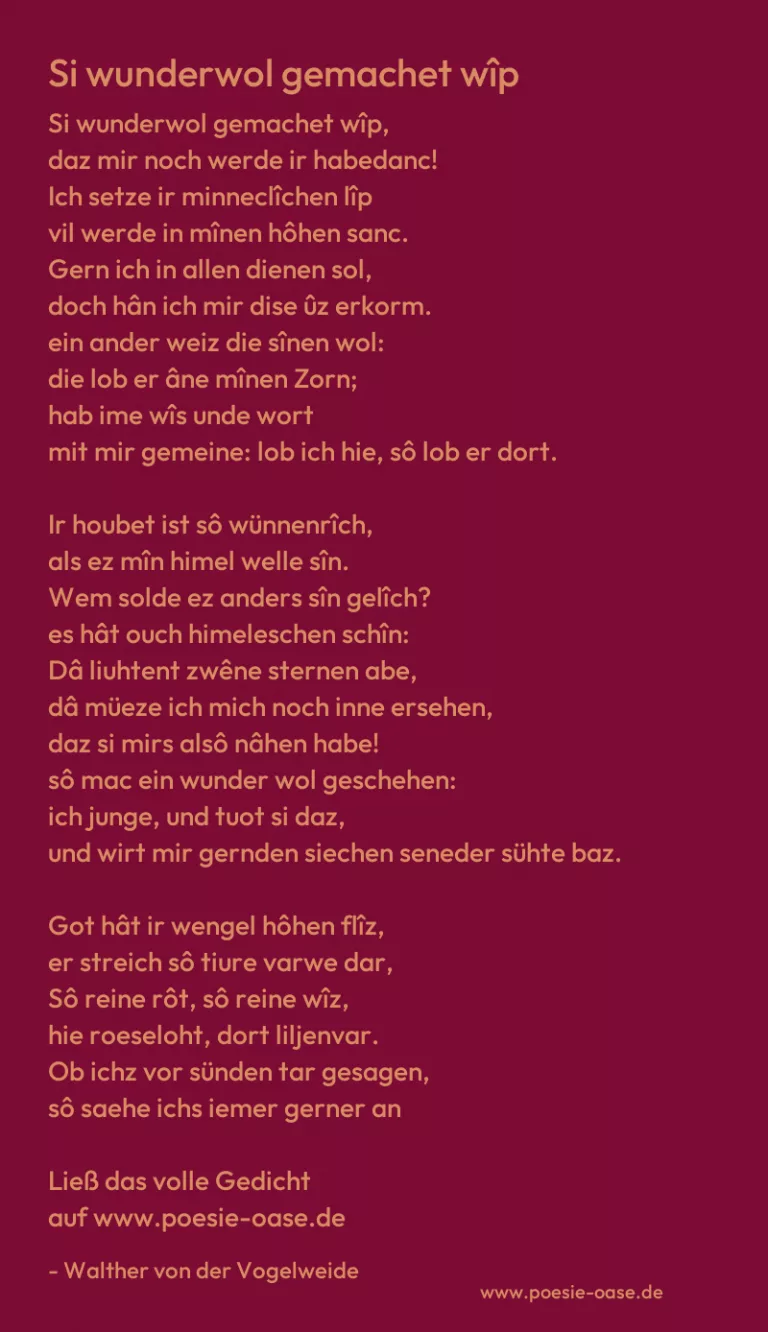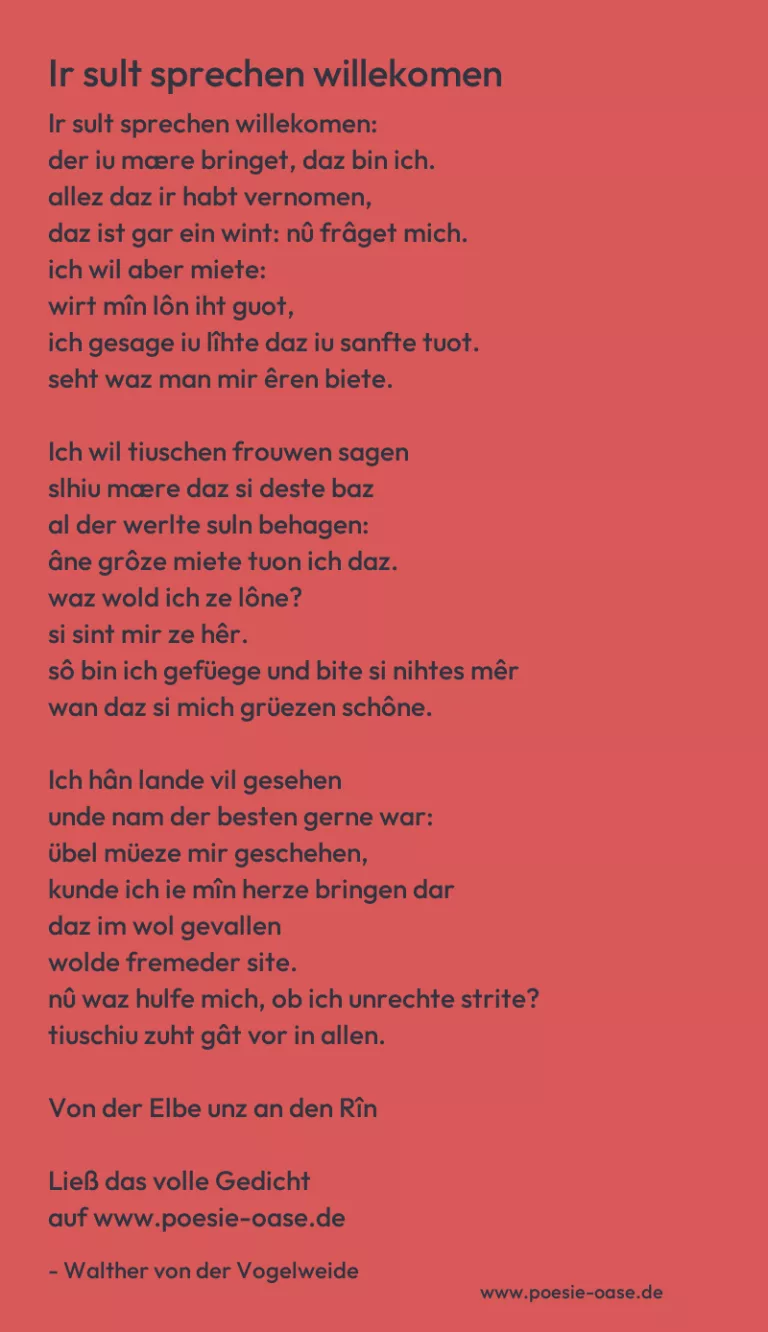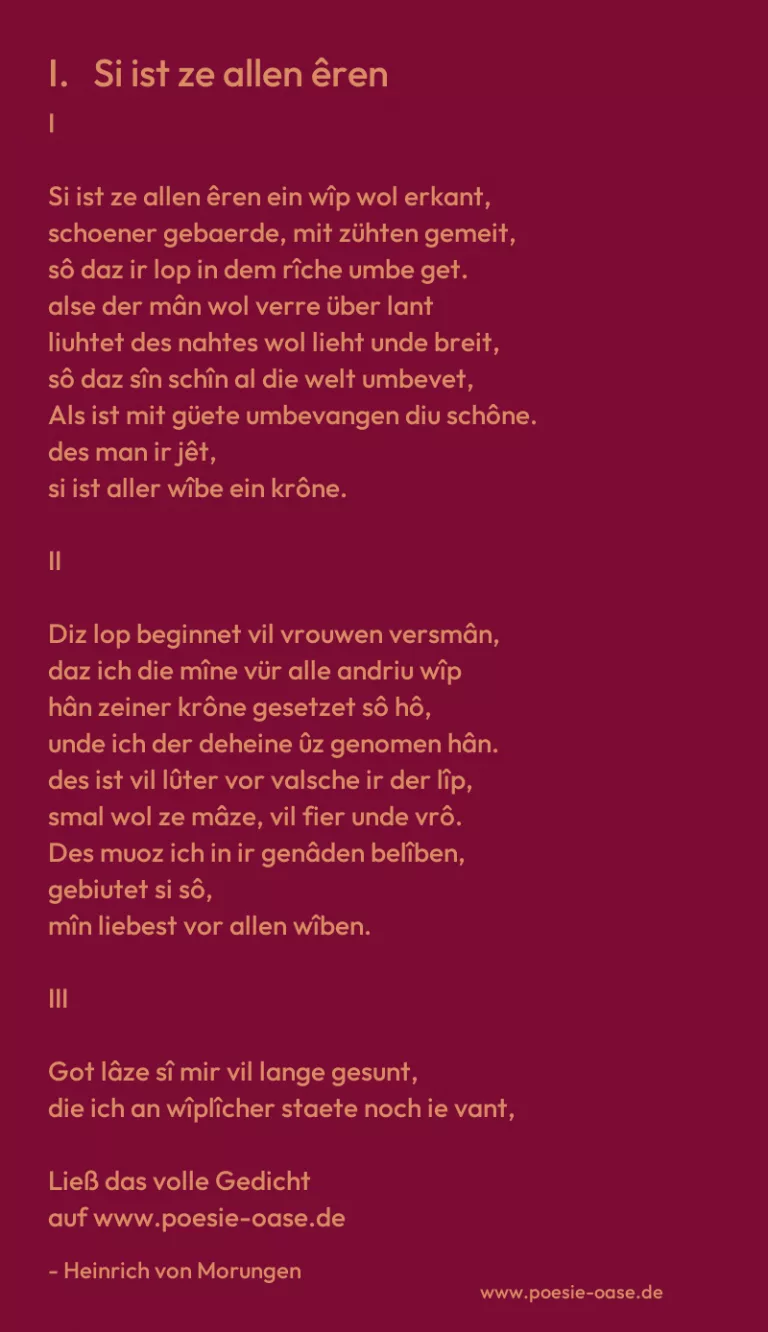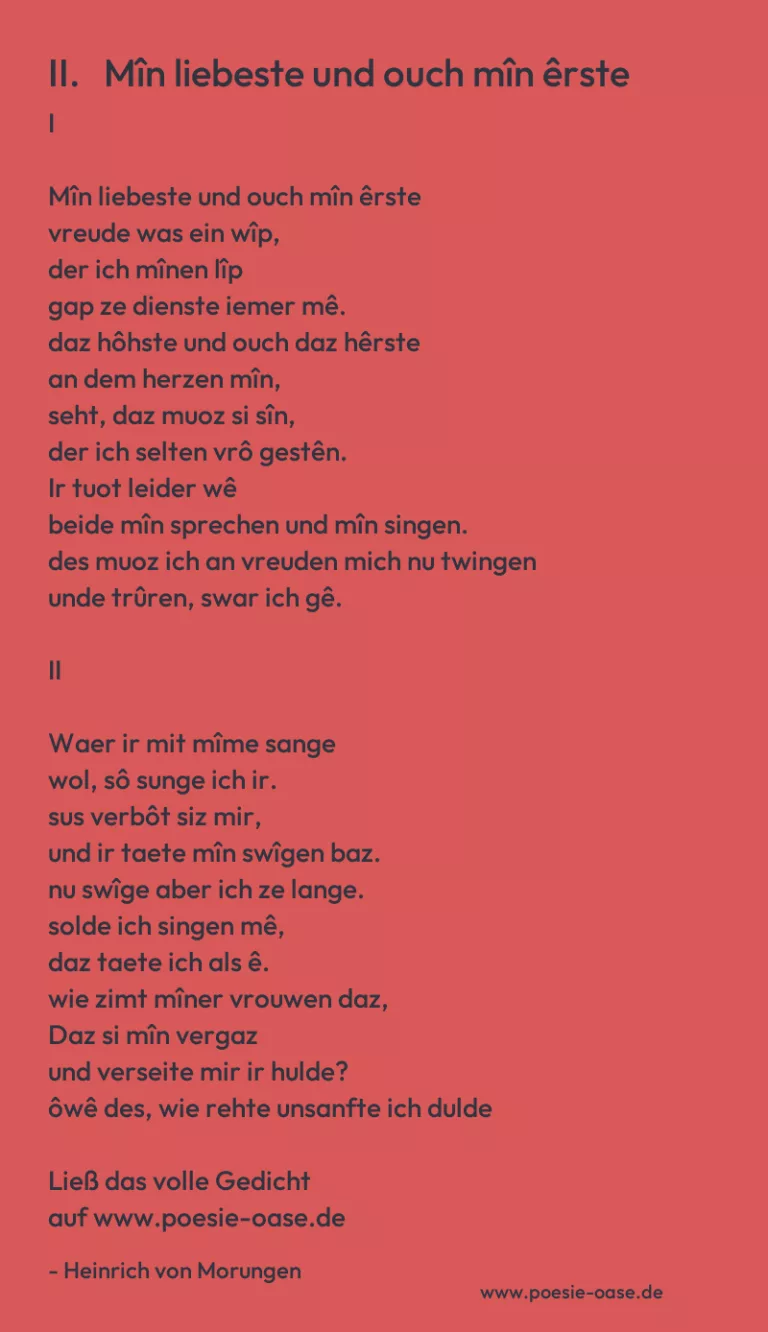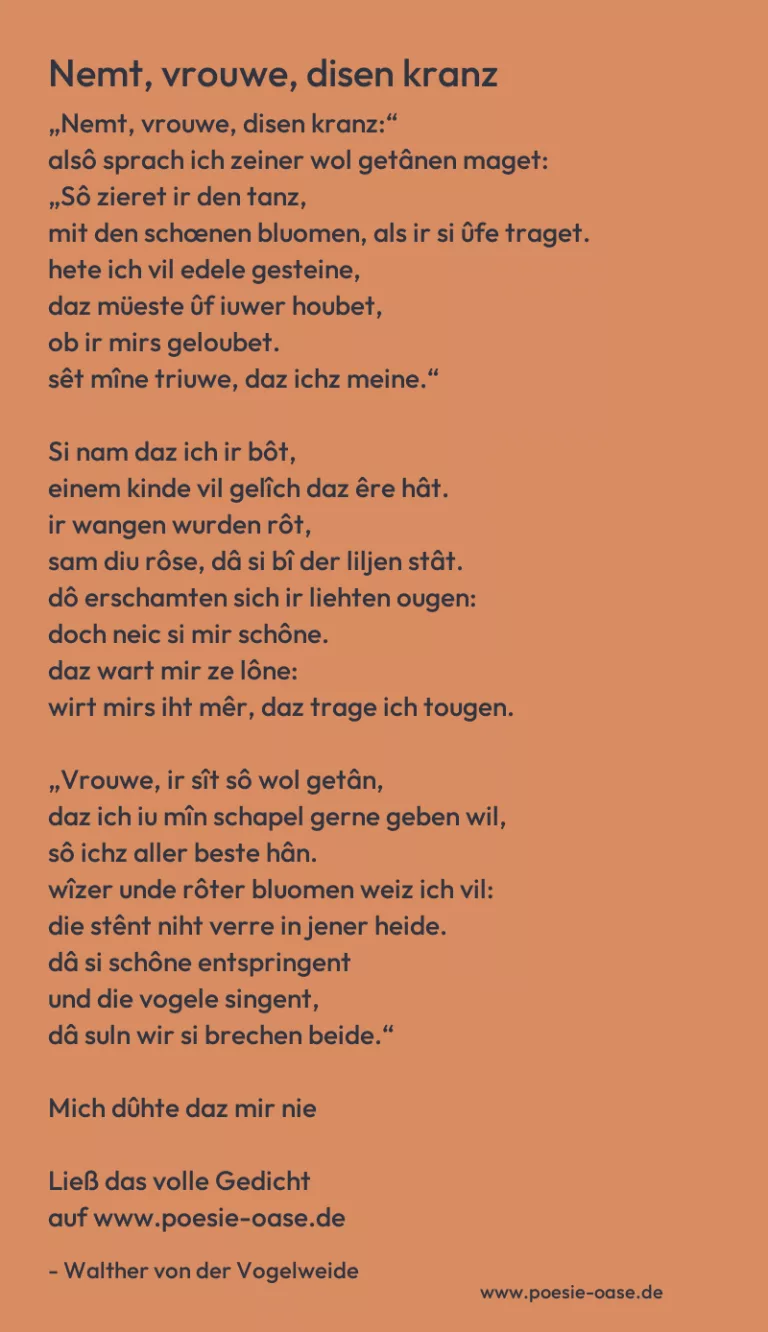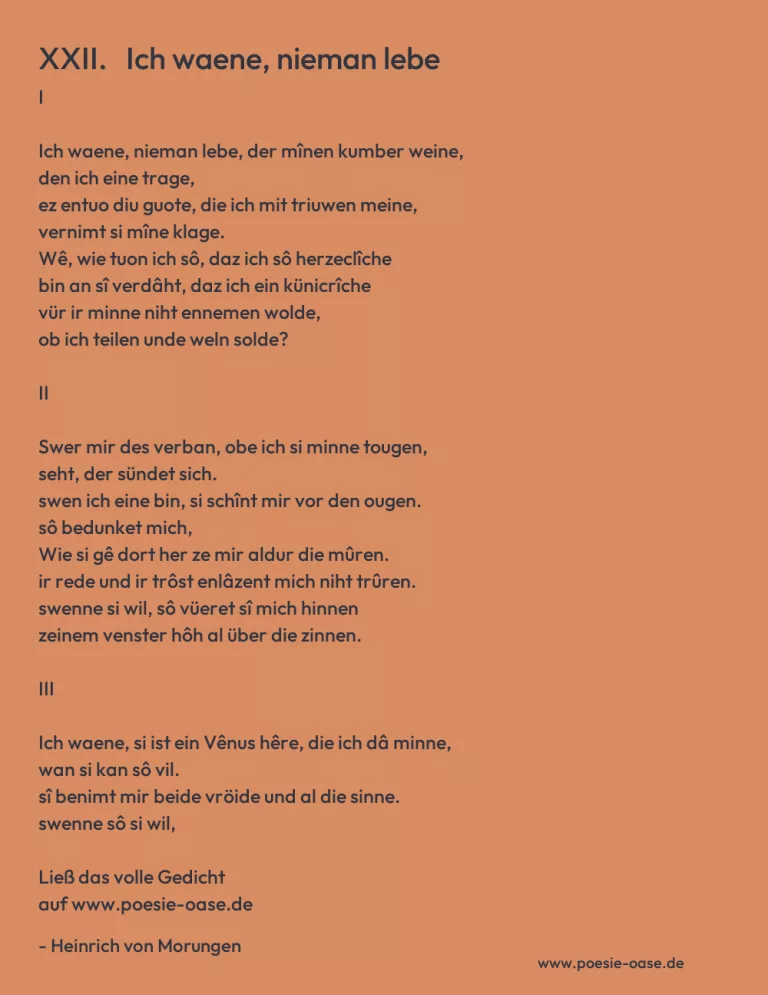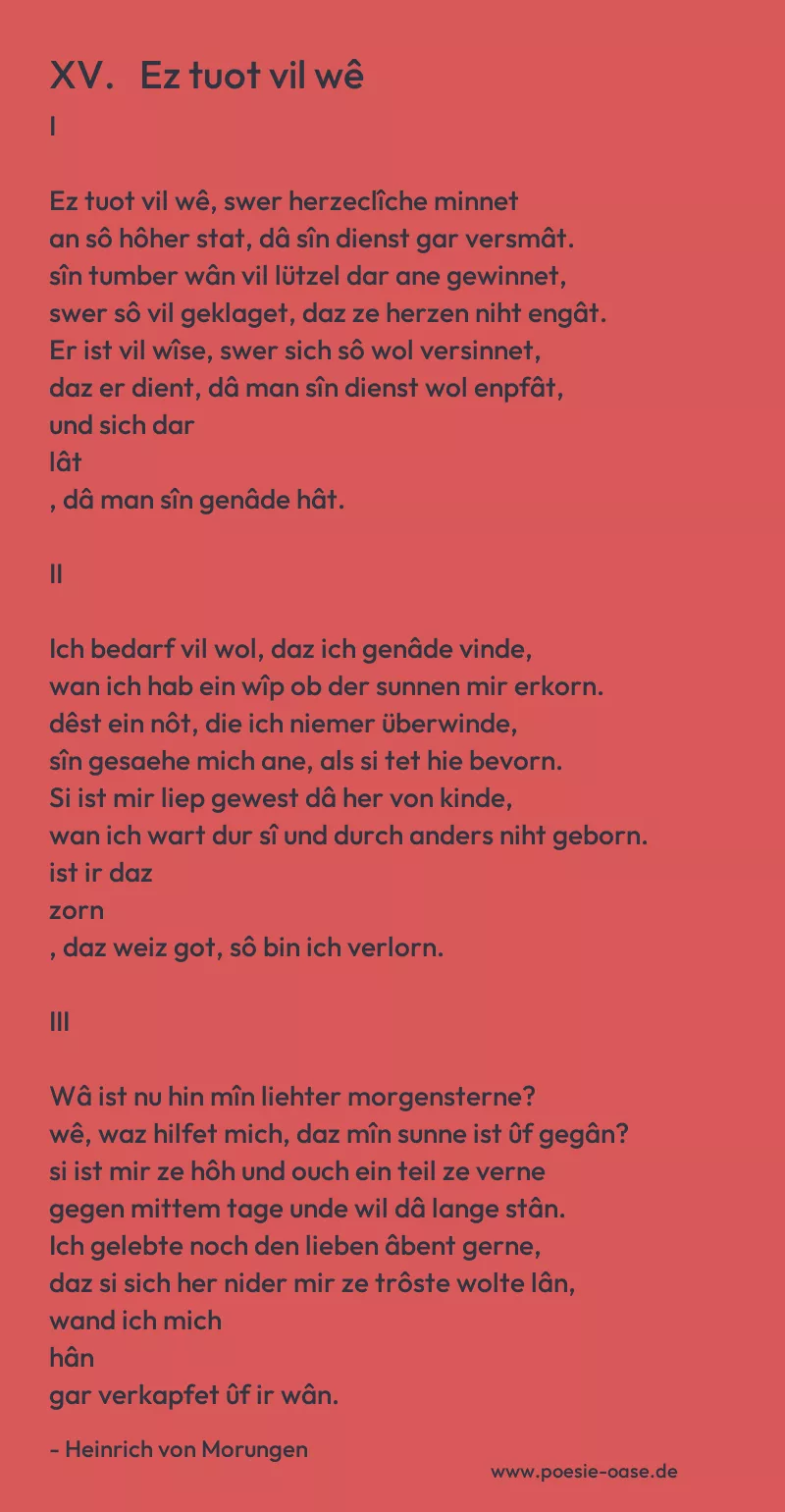XV. Ez tuot vil wê
I
Ez tuot vil wê, swer herzeclîche minnet
an sô hôher stat, dâ sîn dienst gar versmât.
sîn tumber wân vil lützel dar ane gewinnet,
swer sô vil geklaget, daz ze herzen niht engât.
Er ist vil wîse, swer sich sô wol versinnet,
daz er dient, dâ man sîn dienst wol enpfât,
und sich dar
lât
, dâ man sîn genâde hât.
II
Ich bedarf vil wol, daz ich genâde vinde,
wan ich hab ein wîp ob der sunnen mir erkorn.
dêst ein nôt, die ich niemer überwinde,
sîn gesaehe mich ane, als si tet hie bevorn.
Si ist mir liep gewest dâ her von kinde,
wan ich wart dur sî und durch anders niht geborn.
ist ir daz
zorn
, daz weiz got, sô bin ich verlorn.
III
Wâ ist nu hin mîn liehter morgensterne?
wê, waz hilfet mich, daz mîn sunne ist ûf gegân?
si ist mir ze hôh und ouch ein teil ze verne
gegen mittem tage unde wil dâ lange stân.
Ich gelebte noch den lieben âbent gerne,
daz si sich her nider mir ze trôste wolte lân,
wand ich mich
hân
gar verkapfet ûf ir wân.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
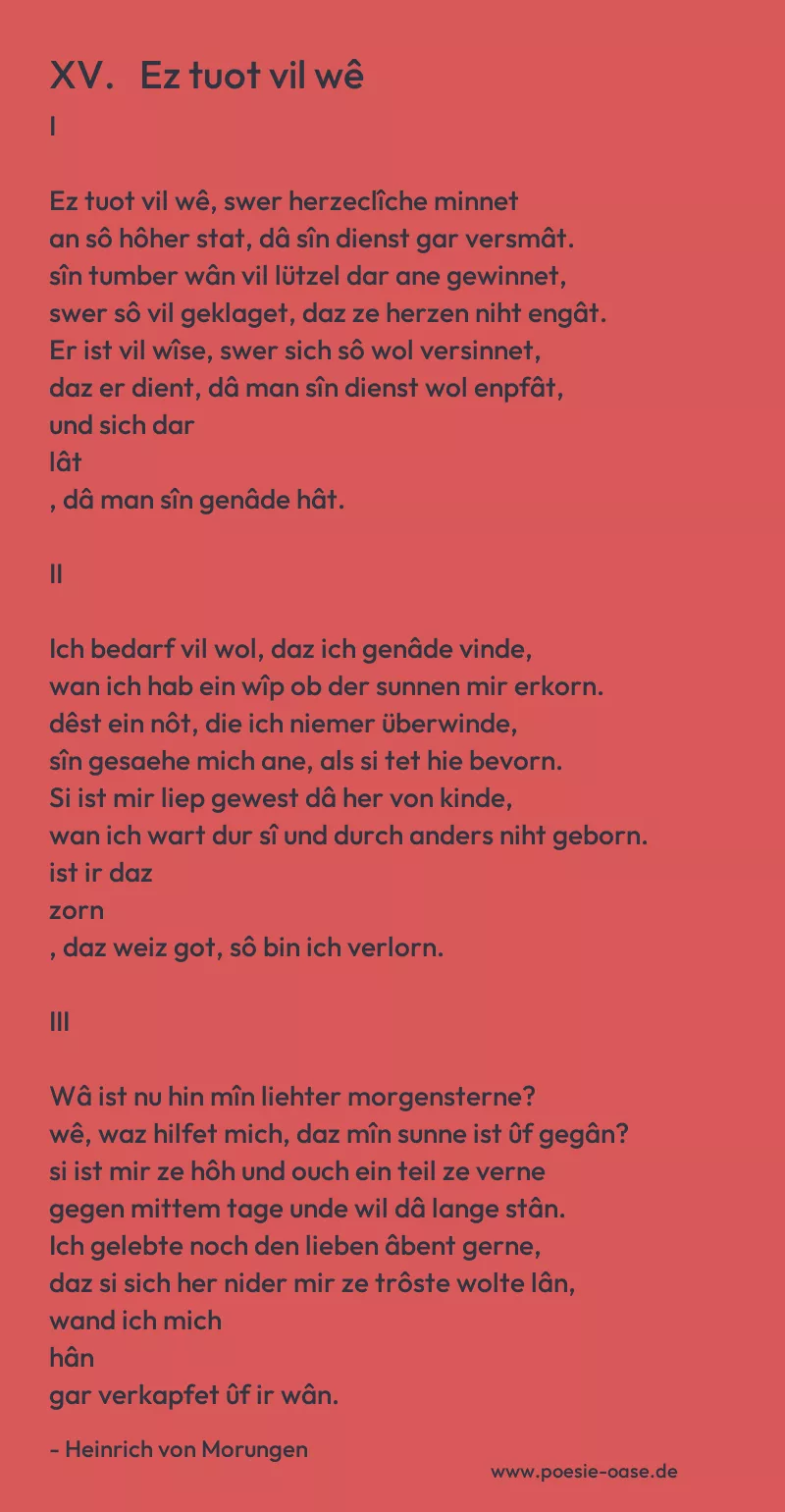
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ez tuot vil wê“ von Heinrich von Morungen thematisiert das leidvolle Ringen des lyrischen Ichs mit seiner Liebe, die ihn sowohl erhebt als auch quält. In der ersten Strophe beschreibt der Sprecher die Qualen eines Liebenden, der seinen Dienst und seine Hingabe der Geliebten darbringt, ohne Anerkennung zu erhalten. Der Ausdruck „sô hôher stat“ verweist auf die unerreichbare Stellung der Geliebten, die dem Sprecher eine demütige Verehrung abverlangt, die jedoch ungehört bleibt. Die „tumber wân“ (dummes Wagnis) des Sprechers führt zu keinem Gewinn, was die Frustration und die Ohnmacht über seine unerkannte Liebe betont. Das Gedicht vermittelt die Vorstellung, dass wahre Weisheit im Erkennen der Bedeutung des Dienstes und der Anerkennung durch die Geliebte liegt, doch der Sprecher bleibt in seiner unermüdlichen Hingabe gefangen, ohne eine Belohnung zu erfahren.
In der zweiten Strophe geht der Sprecher auf sein eigenes inneres Bedürfnis ein, „genâde“ (Gnade) zu finden, da er sich durch die Geliebte sowohl in seiner Jugend als auch in seiner gegenwärtigen Lage geprägt fühlt. Die „nôt“ (Not), die er empfindet, ist eine fortwährende Belastung, die er niemals überwinden kann. Das Bild der Geliebten als „wîp ob der sunnen mir erkorn“ (Frau, die mir das Licht der Sonne gewählt hat) verweist auf die Erhebung der Geliebten zu einer fast überirdischen, idealisierten Figur, die gleichzeitig das Leben des Sprechers bestimmt und ihn ins Unglück stürzt. Ihre Abwesenheit oder Ablehnung – symbolisiert durch den Zorn, der ihn zu „verlorn“ (verloren) macht – zeigt den intensiven Schmerz, den die unerfüllte Liebe verursacht. Die Geliebte wird hier als Quelle von Licht und Schatten, Freude und Leid dargestellt.
In der dritten Strophe wird das Bild des „liehter morgensterne“ (heller Morgenstern) als Symbol für die Geliebte weitergeführt, wobei der Sprecher nun den Verlust dieser Inspiration und Freude empfindet. Der „Morgenstern“ als ein Licht, das ihm den Tag erleuchtet, ist nun verschwunden, und der Sprecher steht vor der Dunkelheit eines „mittem tage“ (mittleren Tages), der ihn ohne ihre Gegenwart bedrückt. Der Wunsch nach Trost durch die Geliebte, die ihm jedoch unerreichbar bleibt, verstärkt seine Einsamkeit. Die Sehnsucht nach einem letzten „lieben abent“ (liebevollen Abend), an dem sie sich ihm zuwenden könnte, wird hier als verzweifelte Hoffnung auf eine unerreichbare Nähe dargestellt. Das Bild des „verkapfeten wân“ (verdeckten Wagens) unterstreicht die innere Zerrissenheit und das Gefühl der Gefangenschaft in einer Liebe, die sowohl erheben als auch zerstören kann.
Insgesamt fängt das Gedicht die inneren Widersprüche eines Liebenden ein, der in seiner Hingabe und Sehnsucht gefangen ist. Die Liebe wird sowohl als erlösende Kraft als auch als Quelle des Leidens dargestellt, was die tief verwurzelte Ambivalenz der mittelalterlichen Liebesdichtung widerspiegelt. Morungen beschreibt meisterhaft die emotionale Zerrissenheit, die entsteht, wenn Liebe unerwidert oder von der Geliebten ferngehalten wird – ein wiederkehrendes Thema in der höfischen Literatur.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.