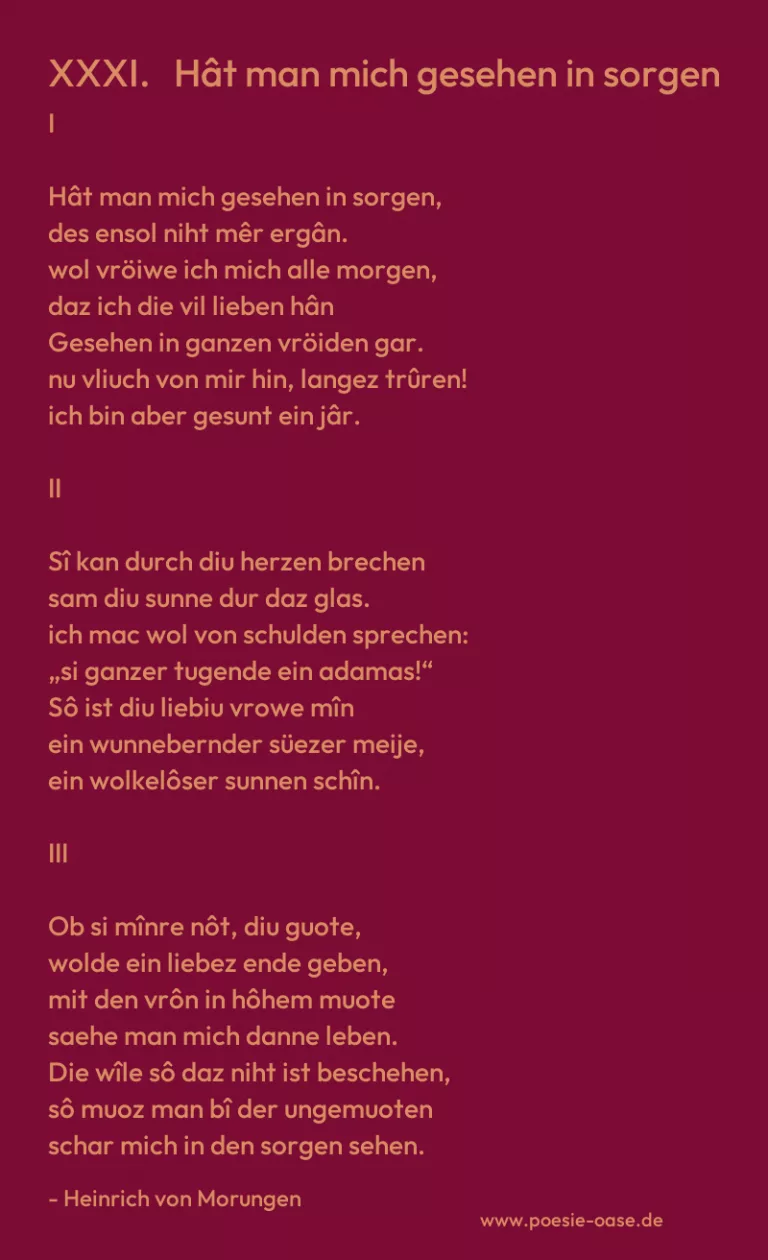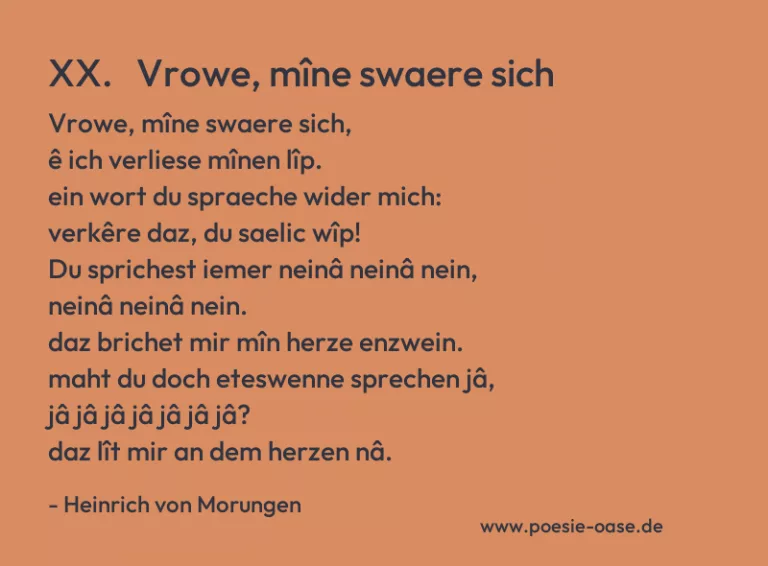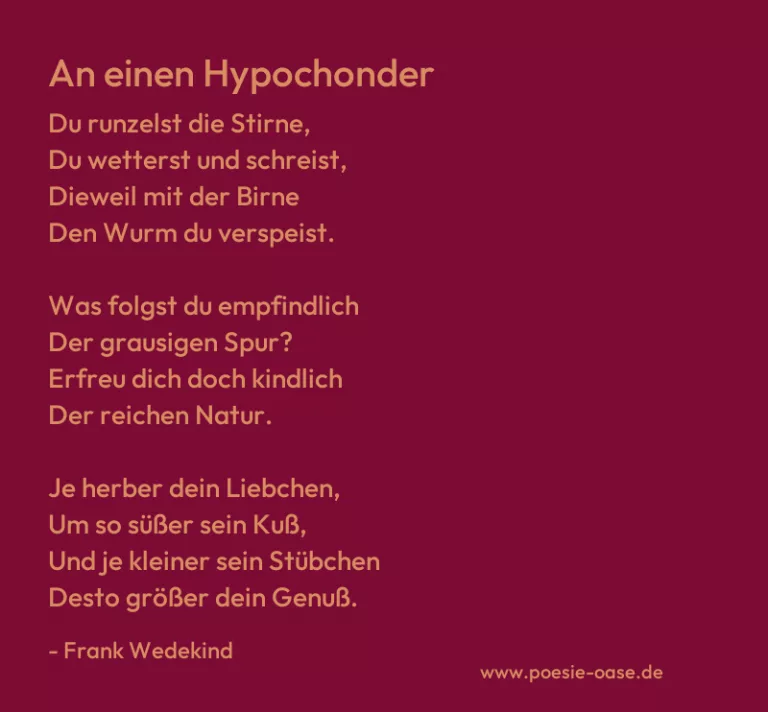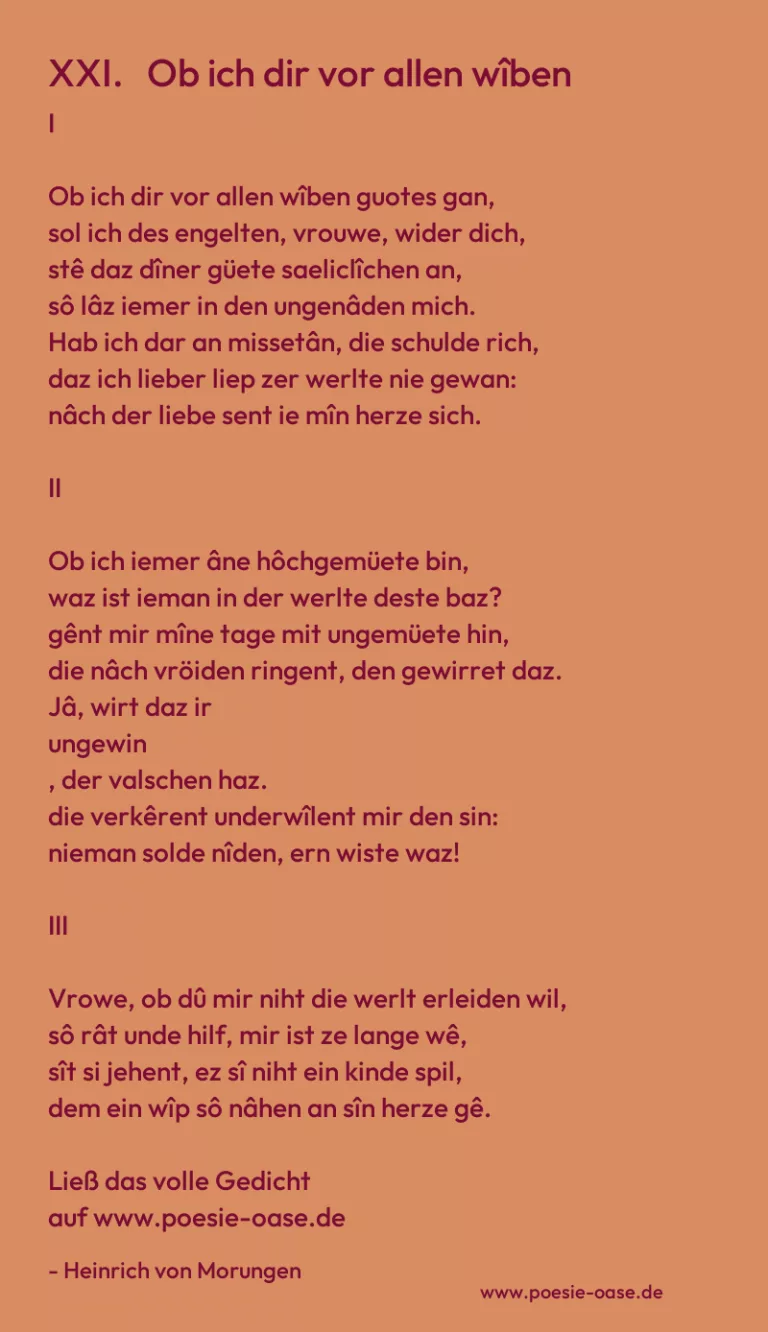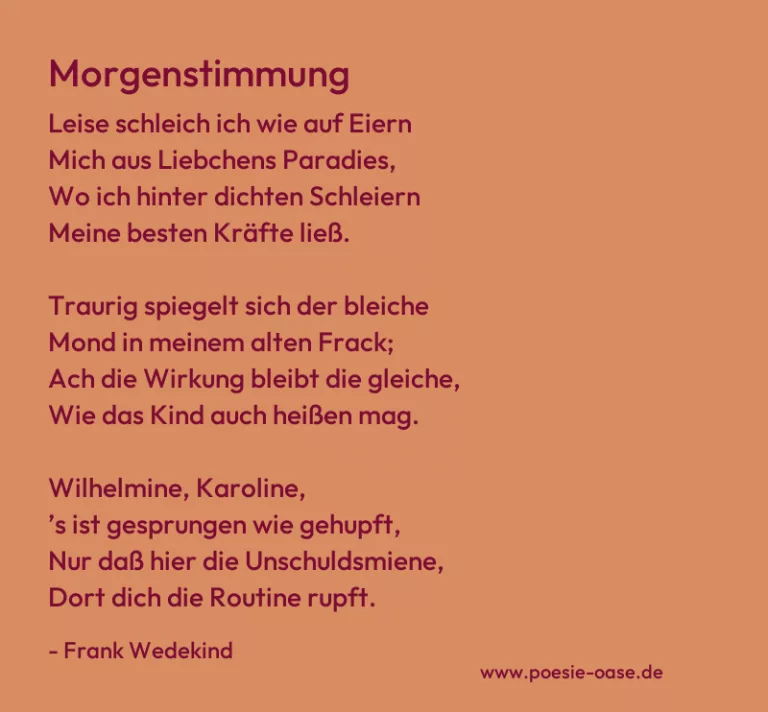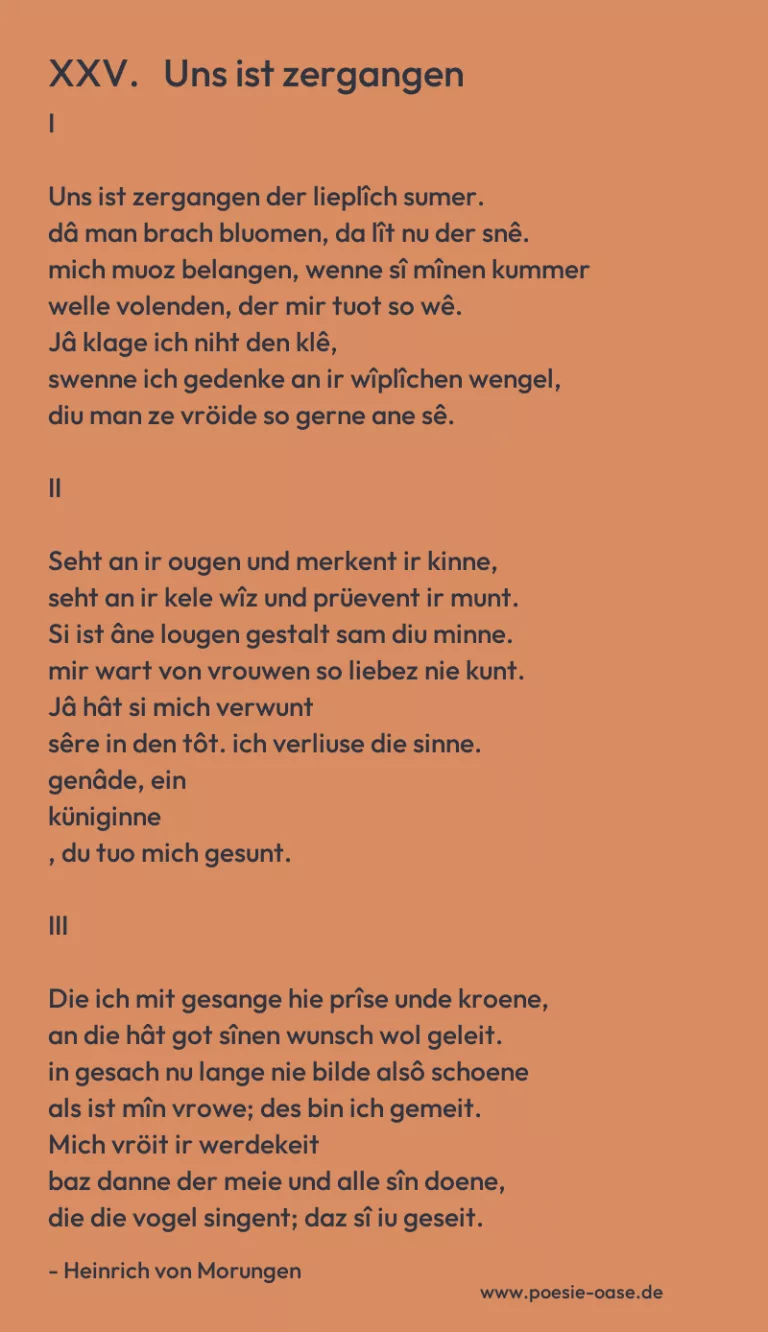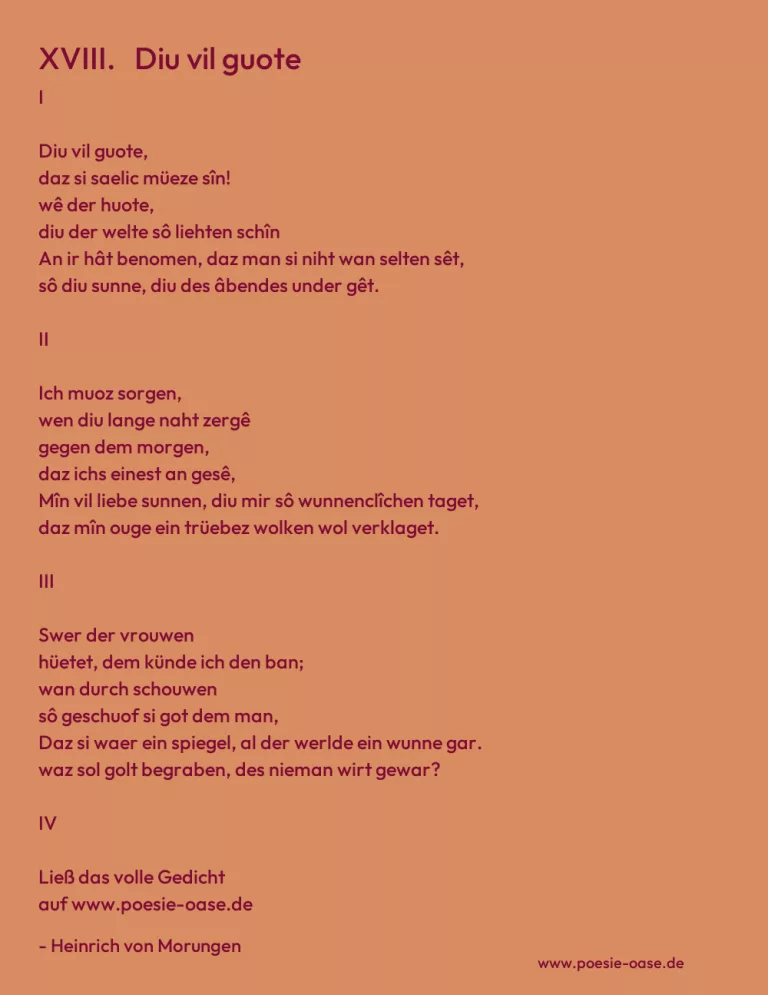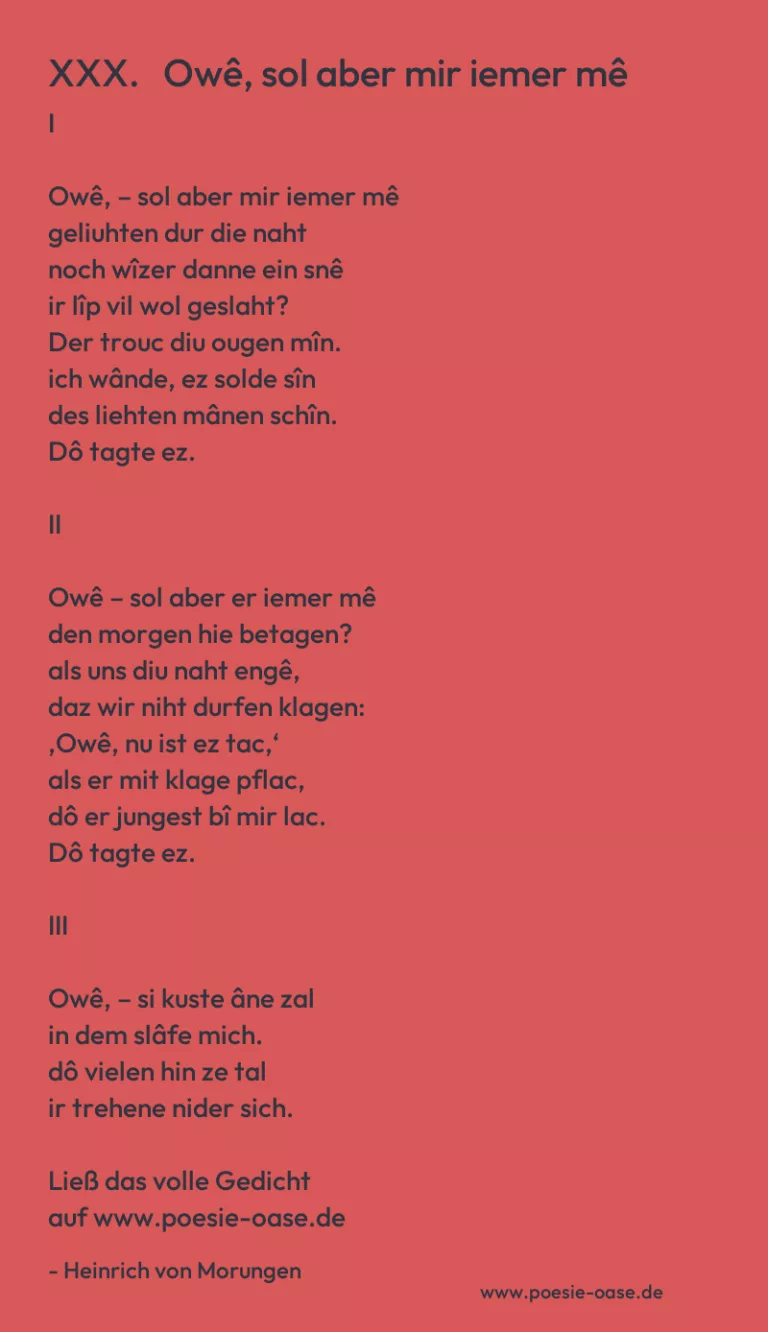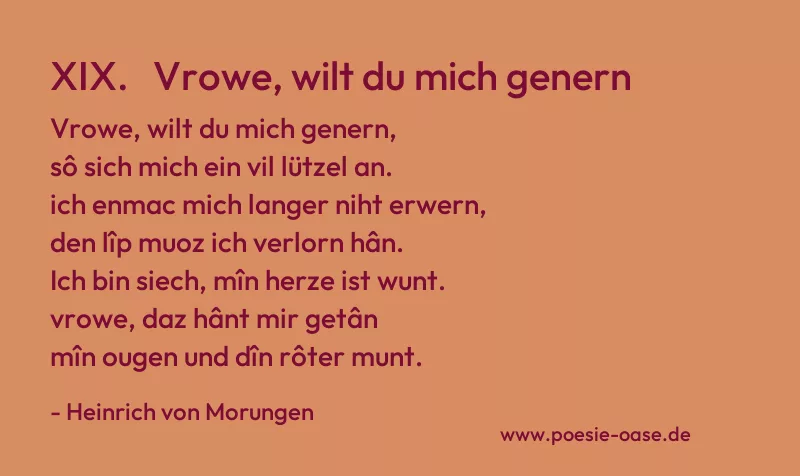XIX. Vrowe, wilt du mich genern
Vrowe, wilt du mich genern,
sô sich mich ein vil lützel an.
ich enmac mich langer niht erwern,
den lîp muoz ich verlorn hân.
Ich bin siech, mîn herze ist wunt.
vrowe, daz hânt mir getân
mîn ougen und dîn rôter munt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
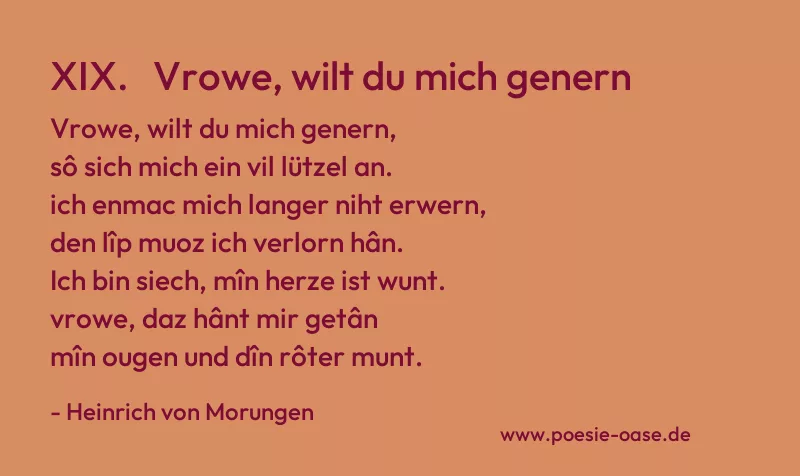
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vrowe, wilt du mich genern“ von Heinrich von Morungen beschreibt in wenigen, aber prägnanten Versen die Verzweiflung und den Schmerz eines Liebenden, der in seiner Sehnsucht nach der Geliebten fast zerbricht. In der ersten Strophe bittet der Sprecher die Geliebte, ihn zu „genern“ (gnädig zu behandeln). Seine Worte deuten darauf hin, dass er sich von ihr nicht nur emotional, sondern auch körperlich erschöpft fühlt – „ich enmac mich langer niht erwern“ (ich kann mich nicht länger erholen), was auf eine starke Erschöpfung und eine innere Leere hinweist. Die Vorstellung, dass er „den lîp muoz ich verlorn hân“ (den Körper verloren habe), unterstreicht den körperlichen und seelischen Schmerz, den er durch die unerfüllte Liebe erträgt.
In der zweiten Strophe wird der Zustand des Sprechers weiter verstärkt: Er fühlt sich von seiner Geliebten sowohl geistig als auch körperlich verletzt. Der Ausdruck „mîn herze ist wunt“ (mein Herz ist verwundet) verdeutlicht, wie sehr der Sprecher unter der Zurückweisung oder der unerwiderten Liebe leidet. Es scheint, als ob die Liebe der Geliebten eine tiefe Wunde hinterlässt, die nicht nur das Herz, sondern auch den Körper des Sprechers beeinflusst. Die Erwähnung der „ougen“ (Augen) und des „rôten munt“ (roten Mundes) der Geliebten als Verursacher dieses Schmerzes verstärkt die Vorstellung, dass ihre Schönheit und Anziehungskraft ihm sowohl Freude als auch tiefen Kummer bereiten.
Das Gedicht fängt auf eindrucksvolle Weise die Tragik der unerfüllten Liebe ein. Die wenigen Worte des Sprechers machen die Intensität seines Schmerzes greifbar und spiegeln die mittelalterliche Auffassung wider, dass die Liebe den Liebenden sowohl erheben als auch zerstören kann. Die Geliebte wird als eine Quelle der Schönheit und des Leids dargestellt, die den Sprecher in einen Zustand der Zerrissenheit versetzt. Das Gedicht ist ein kraftvolles Beispiel für die komplexe und oft schmerzhafte Beziehung, die die Liebenden im Kontext der höfischen Dichtung erfahren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.