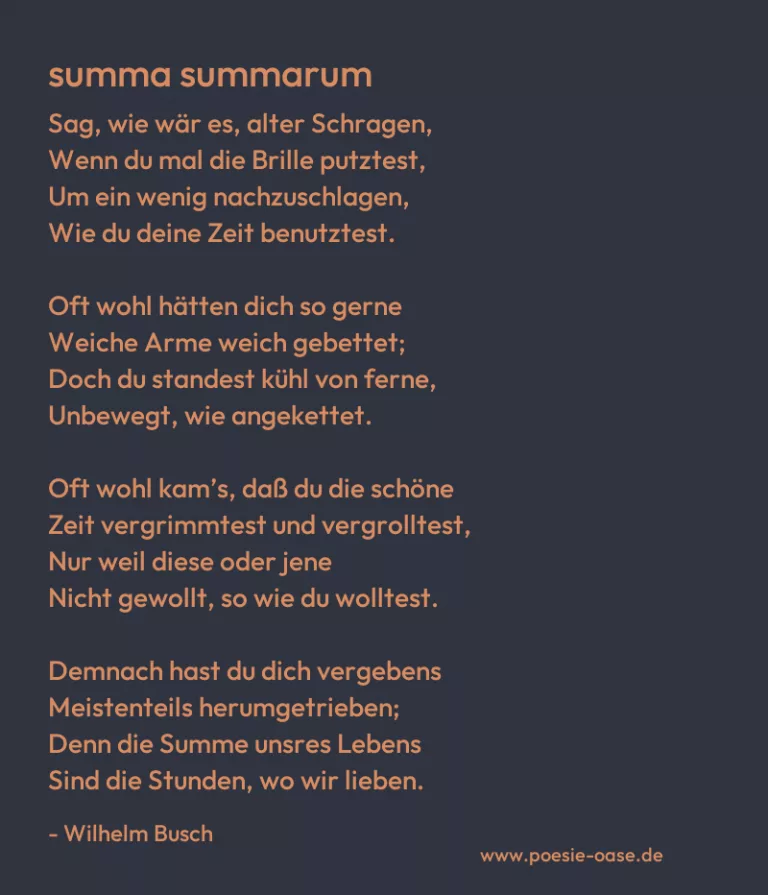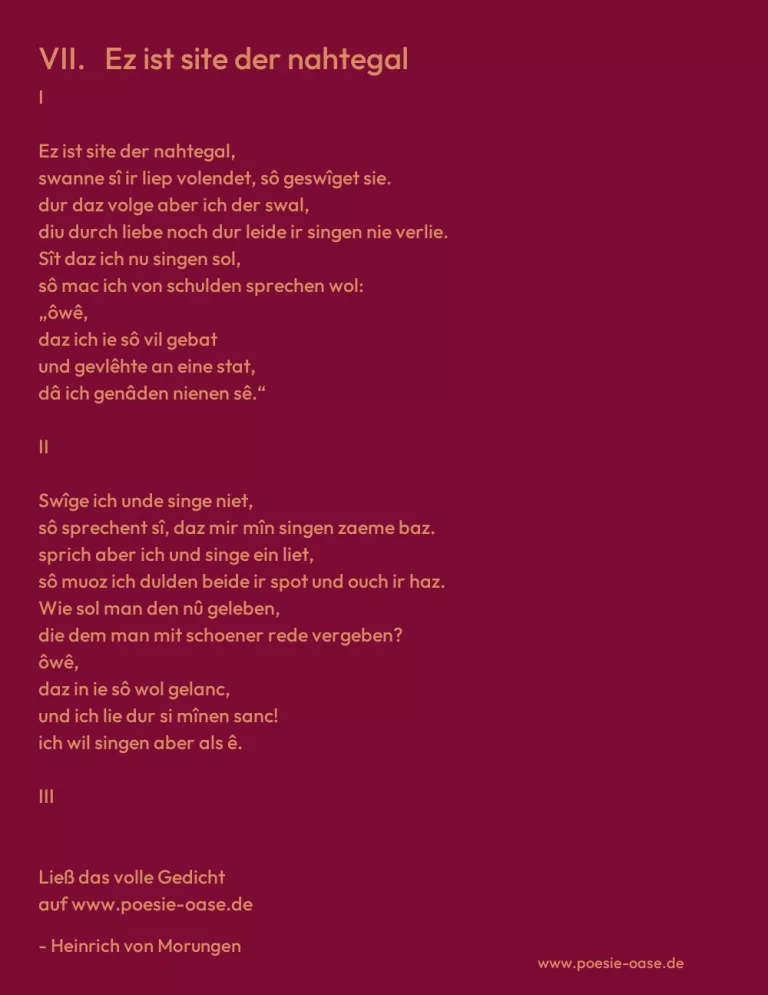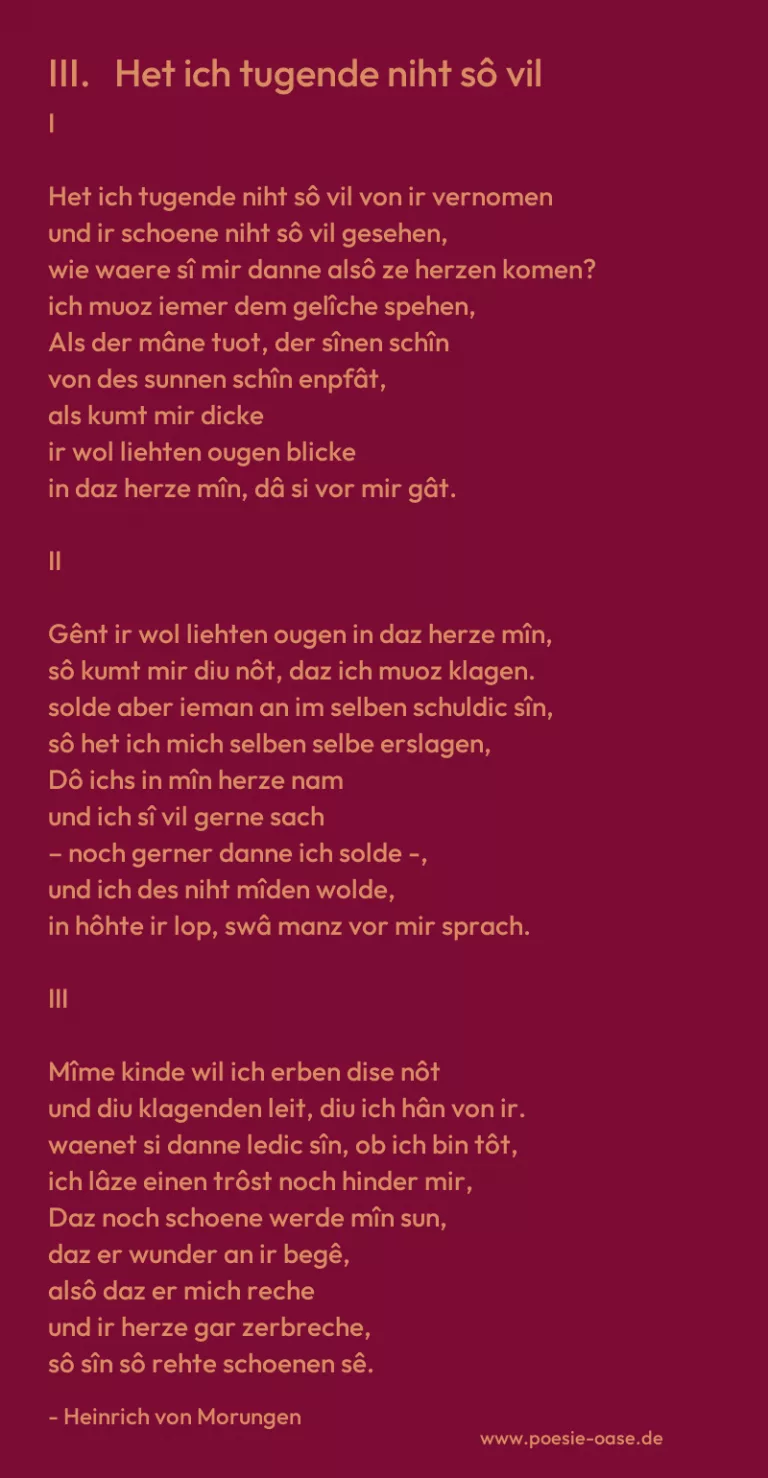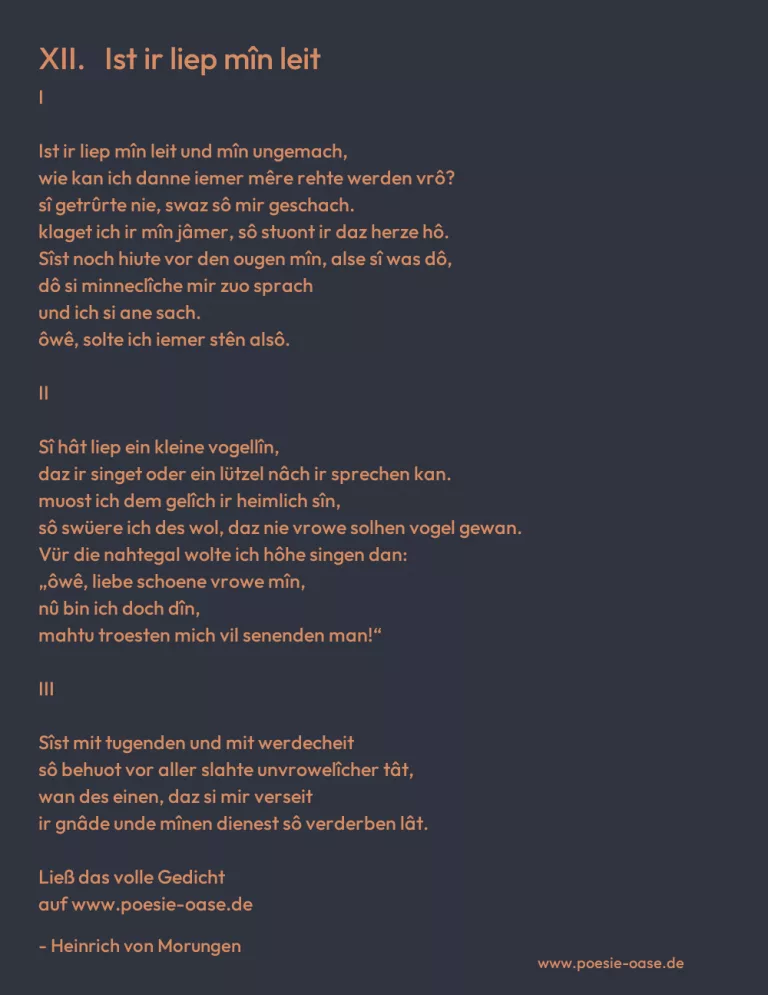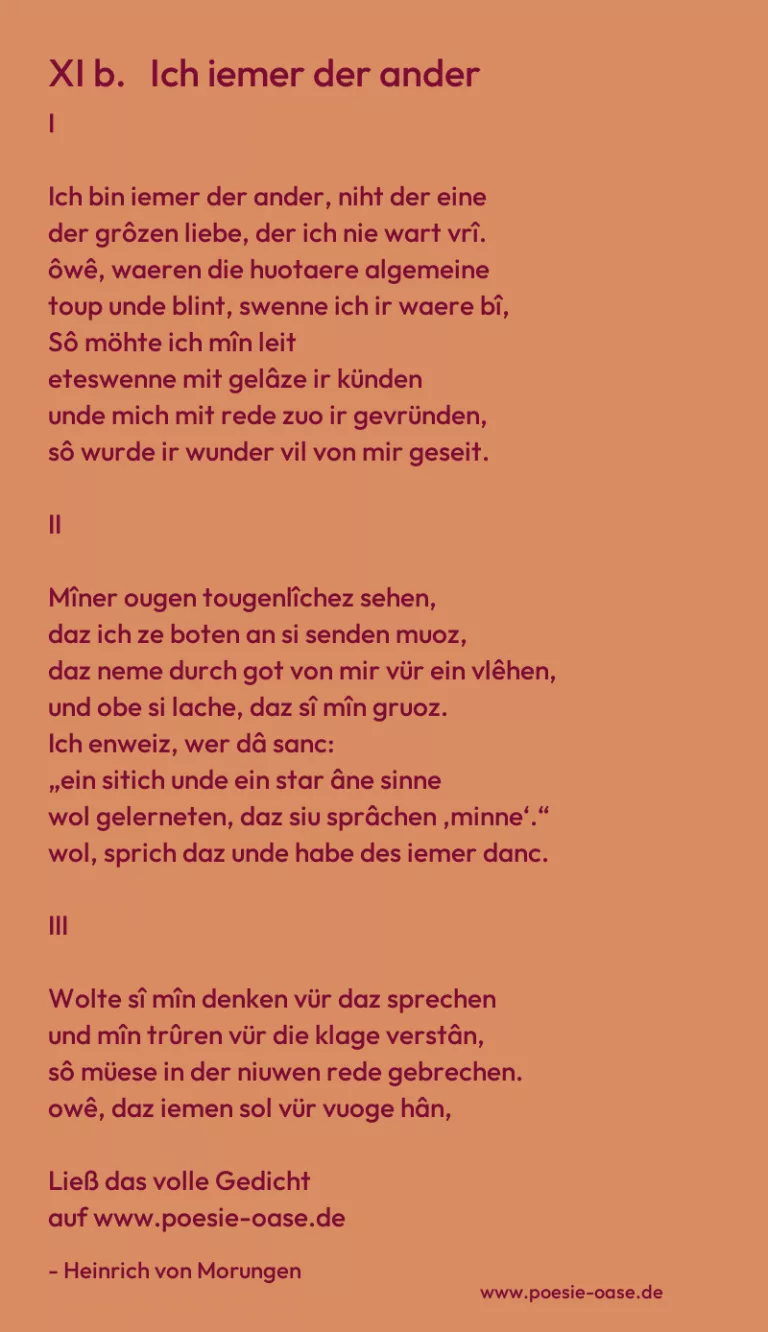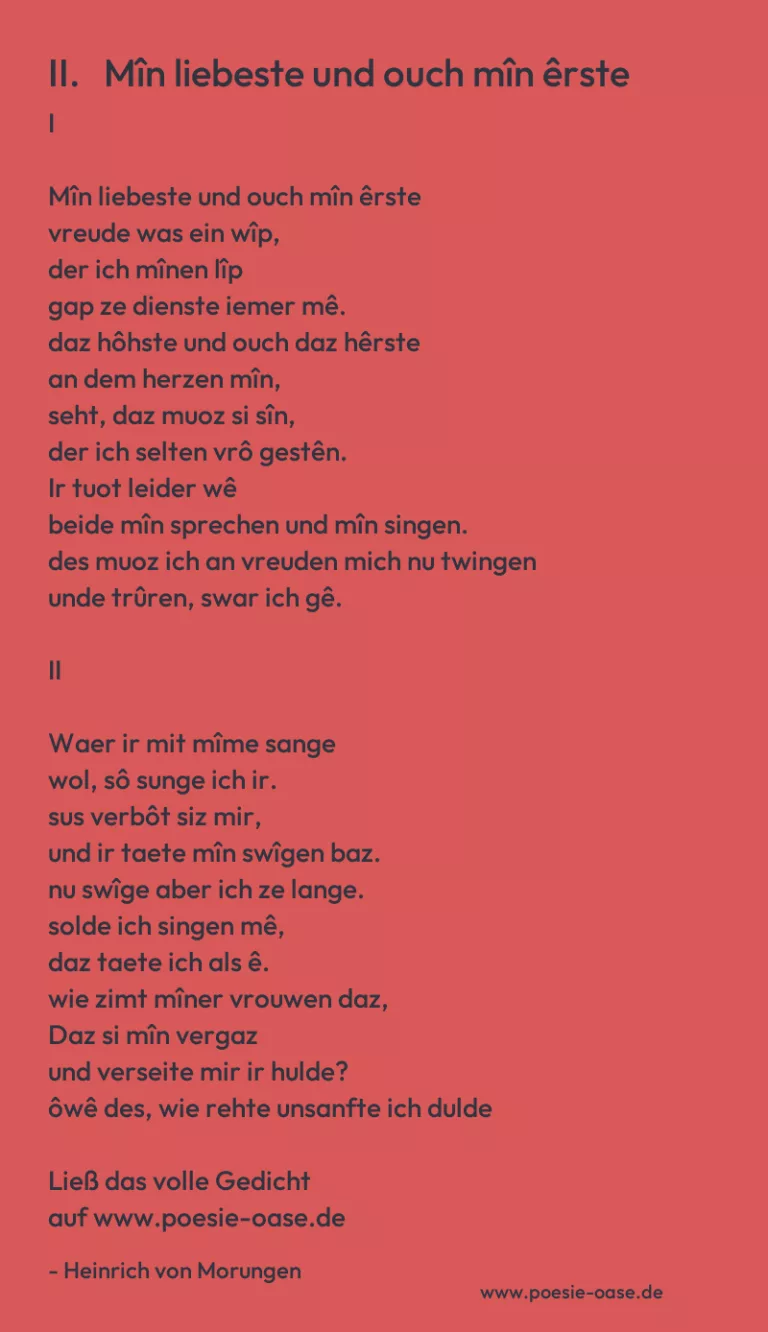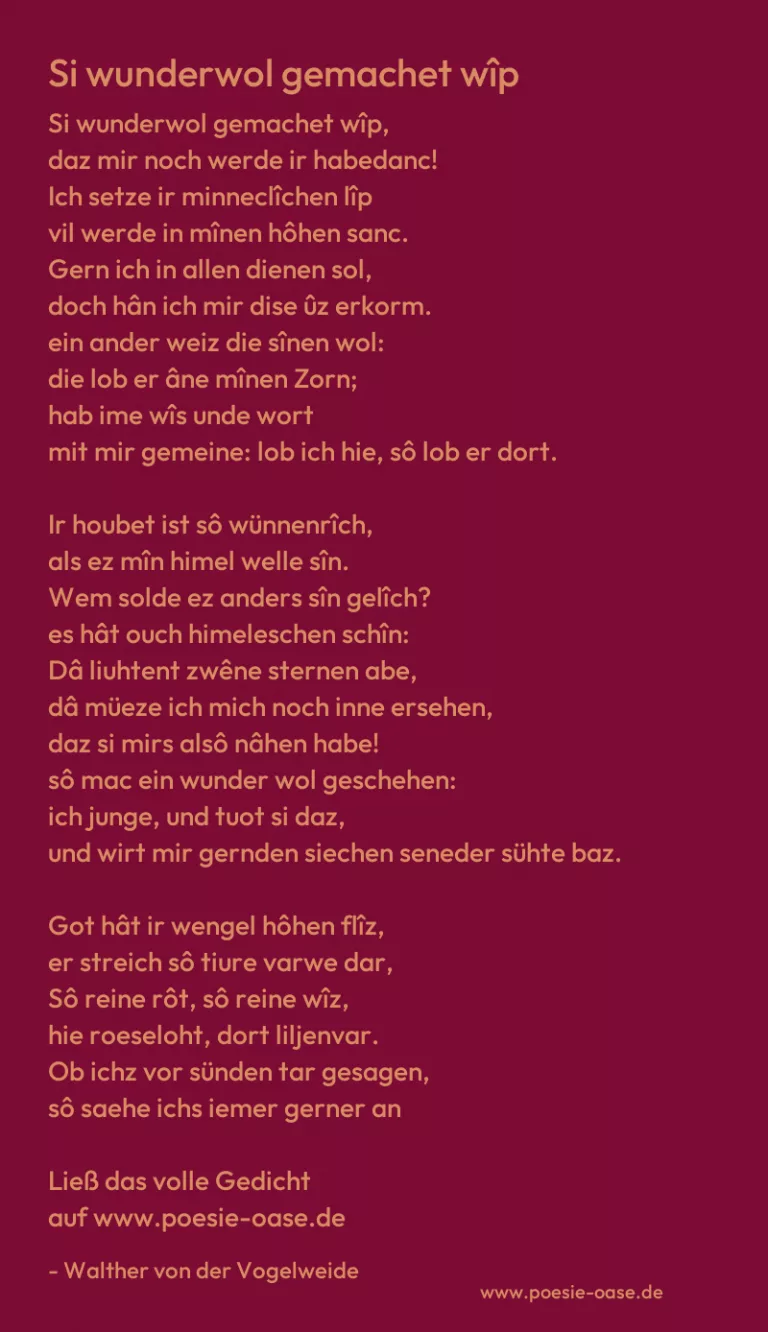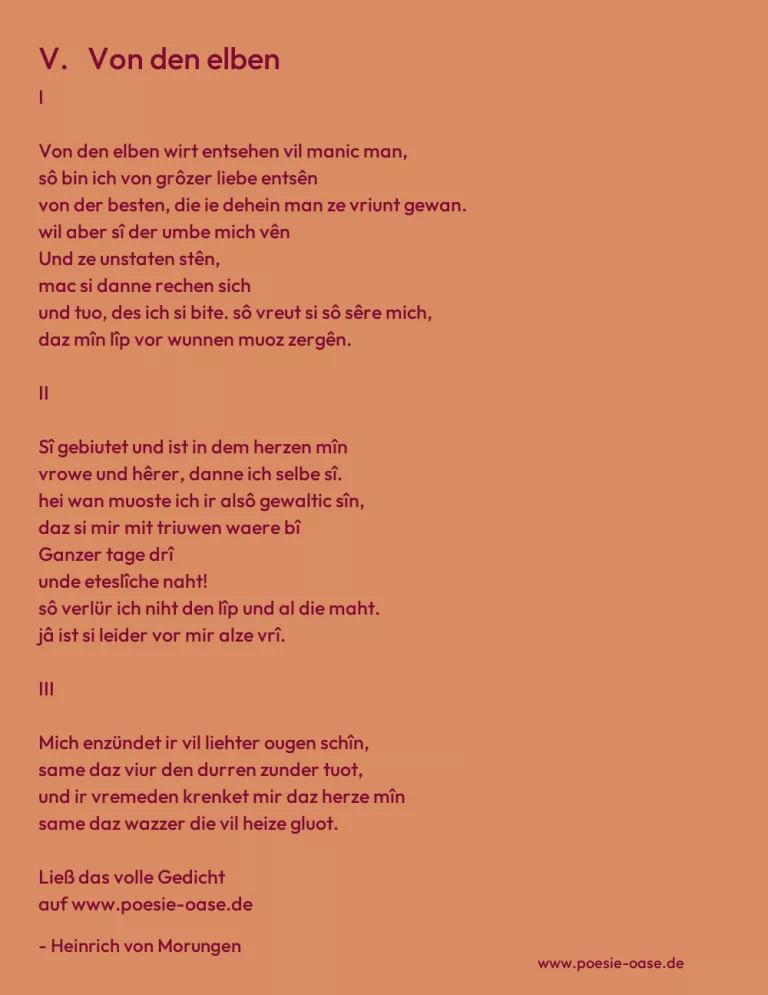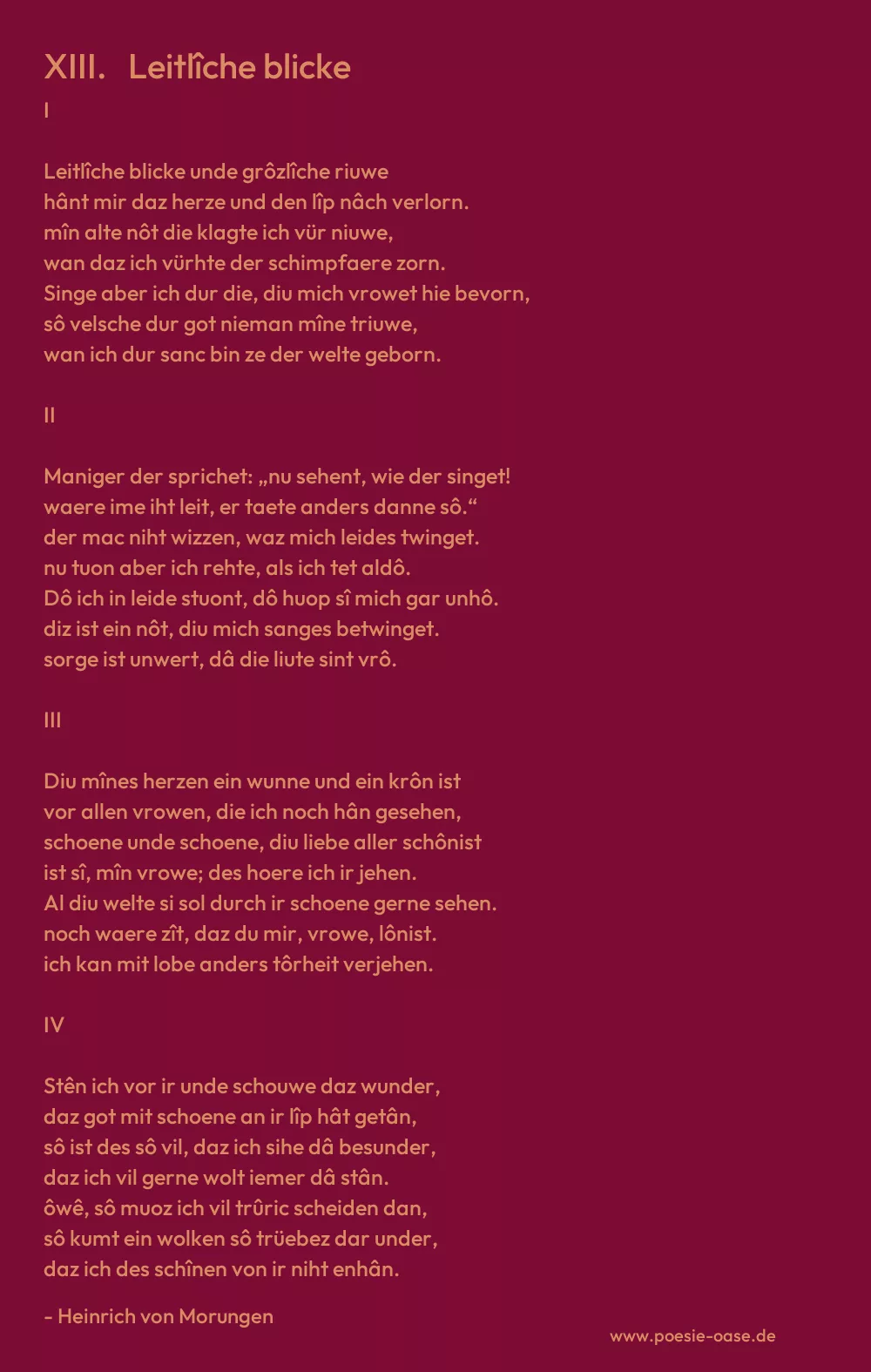XIII. Leitlîche blicke
I
Leitlîche blicke unde grôzlîche riuwe
hânt mir daz herze und den lîp nâch verlorn.
mîn alte nôt die klagte ich vür niuwe,
wan daz ich vürhte der schimpfaere zorn.
Singe aber ich dur die, diu mich vrowet hie bevorn,
sô velsche dur got nieman mîne triuwe,
wan ich dur sanc bin ze der welte geborn.
II
Maniger der sprichet: „nu sehent, wie der singet!
waere ime iht leit, er taete anders danne sô.“
der mac niht wizzen, waz mich leides twinget.
nu tuon aber ich rehte, als ich tet aldô.
Dô ich in leide stuont, dô huop sî mich gar unhô.
diz ist ein nôt, diu mich sanges betwinget.
sorge ist unwert, dâ die liute sint vrô.
III
Diu mînes herzen ein wunne und ein krôn ist
vor allen vrowen, die ich noch hân gesehen,
schoene unde schoene, diu liebe aller schônist
ist sî, mîn vrowe; des hoere ich ir jehen.
Al diu welte si sol durch ir schoene gerne sehen.
noch waere zît, daz du mir, vrowe, lônist.
ich kan mit lobe anders tôrheit verjehen.
IV
Stên ich vor ir unde schouwe daz wunder,
daz got mit schoene an ir lîp hât getân,
sô ist des sô vil, daz ich sihe dâ besunder,
daz ich vil gerne wolt iemer dâ stân.
ôwê, sô muoz ich vil trûric scheiden dan,
sô kumt ein wolken sô trüebez dar under,
daz ich des schînen von ir niht enhân.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
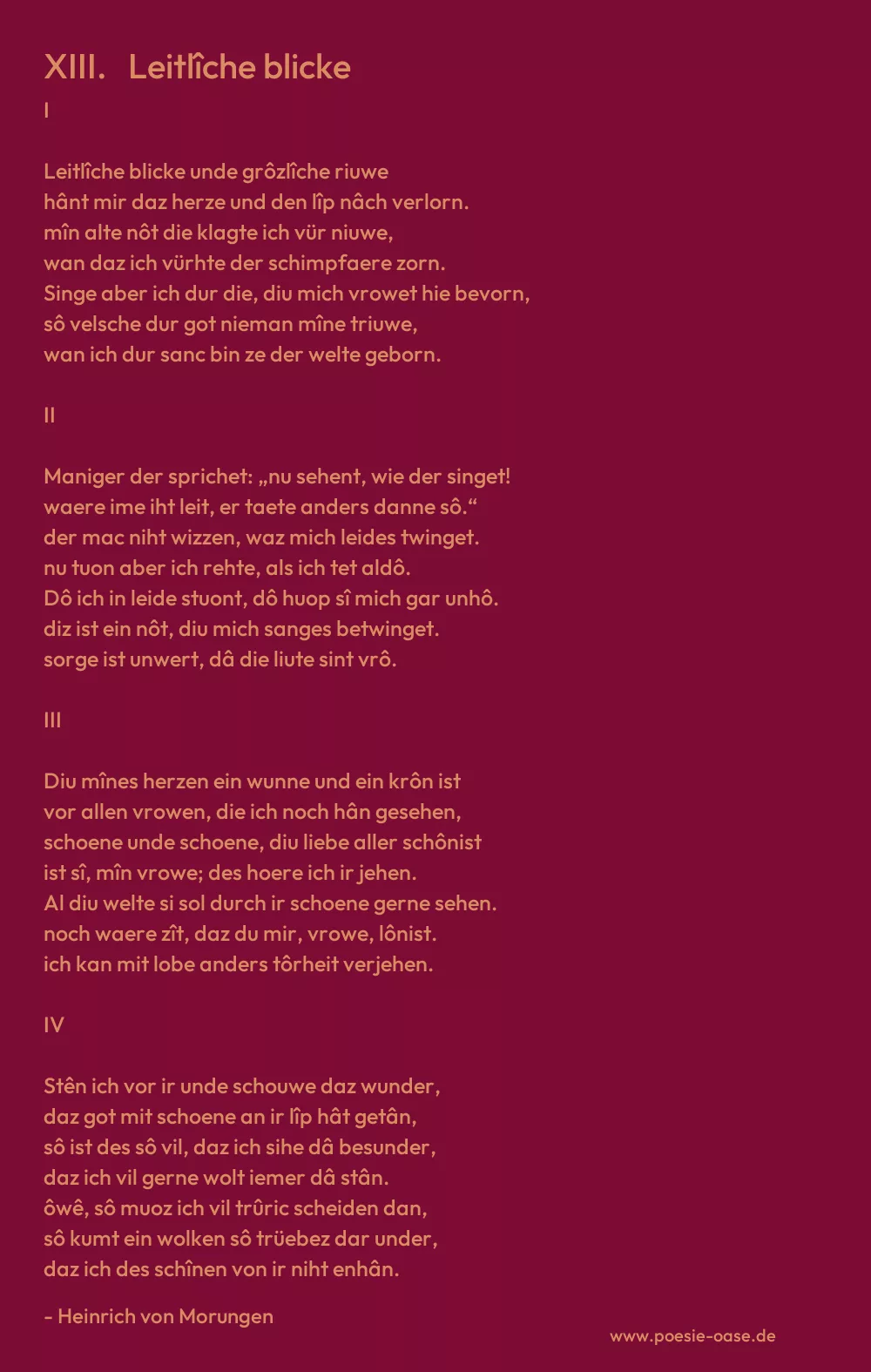
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Leitlîche blicke“ von Heinrich von Morungen beschreibt das innere Leiden eines Liebenden, der zwischen der Bewunderung der Geliebten und dem Schmerz, den ihre unerreichbare Schönheit ihm bereitet, hin- und hergerissen ist. In der ersten Strophe zeigt der Sprecher, wie die „leitlîche blicke“ (leidvollen Blicke) der Geliebten sowie die „grôzlîche riuwe“ (große Trauer) ihn in tiefes Leiden stürzen. Das Bild des Herzens und des Körpers, die nach Verlust streben, symbolisiert die Ohnmacht des Sprechers angesichts der unerfüllten Liebe. Die Klage über die „alte nôt“ (alte Not) und der Hinweis auf den „schimpfaeren zorn“ (zornigen Schimpf) deuten darauf hin, dass das Leiden sowohl durch die ungeteilte Liebe als auch durch die gesellschaftliche Missbilligung seiner Gefühle verstärkt wird. Trotz des Schmerzes, den die Geliebte ihm verursacht, beschreibt der Sprecher, wie er durch seinen Gesang der Welt seine Liebe ausdrückt.
In der zweiten Strophe geht der Sprecher auf die Reaktionen der Außenwelt ein. Einige Leute wundern sich über seine Lieder und beklagen sich über seine Traurigkeit, ohne die tiefe innere Qual zu verstehen, die ihn quält. Der Sprecher gibt an, dass diese äußeren Kritiker nichts über seine Qualen wissen und daher seine Handlungen nicht richtig deuten können. Die tiefe Trauer, die ihn bewegt, wird als etwas betrachtet, das ihn „betwinget“ (zwingt), während seine Lieder nicht nur ein Ausdruck von Schmerz sind, sondern auch ein Mittel, der Welt seine innere Zerrissenheit zu zeigen. Der Kontrast zwischen der fröhlichen Oberfläche der Welt und seiner eigenen inneren Kälte und Sorge wird deutlich.
Die dritte Strophe beschreibt dann eine Wendung, in der der Sprecher seine Geliebte als die Quelle von Freude und Schönheit idealisiert. Sie wird als „wunne und krôn“ (Wonne und Krone) seines Herzens beschrieben, eine perfekte Vereinigung von Schönheit und Liebe. In dieser Darstellung ist die Geliebte die unbestrittene Königin seines Herzens, deren Schönheit ihn in den höchsten Höhen der Liebe und des Lobes erhebt. Doch gleichzeitig fordert der Sprecher, dass sie ihm „lônist“ (Belohnung) für seine Liebe, was darauf hindeutet, dass er eine Erwiderung seiner Gefühle erwartet. Er sieht in seiner Liebe zu ihr keine Torheit, sondern eine würdige und gerechte Hingabe.
In der letzten Strophe beschreibt der Sprecher die unvergängliche Schönheit der Geliebten. Wenn er sie vor sich sieht, ist er so tief von ihrer Schönheit beeindruckt, dass er es als ein „wunder“ (Wunder) empfindet, das von Gott erschaffen wurde. Doch gleichzeitig wird das Bild von unvermeidlichem Schmerz eingeführt – der Gedanke, von ihr getrennt zu werden, ist für ihn kaum zu ertragen. Die „wolken“ (Wolken) und die „trüebez“ (Trübung) symbolisieren die Dunkelheit und den Kummer, die ihn überkommen, wenn er von ihr weggehen muss. Das Bild des Schmerzes und der Unfähigkeit, ihre Schönheit zu genießen, wenn er sie nicht mehr in seiner Nähe hat, zeigt die tiefe Verbindung, die der Sprecher zu ihr fühlt – eine Verbindung, die ihn gleichermaßen erhebt und in tiefe Verzweiflung stürzt.
Das Gedicht spiegelt die leidenschaftliche Hingabe und den inneren Konflikt eines Liebenden wider, der sich von der Schönheit und Anziehungskraft der Geliebten sowohl erhebt als auch schmerzlich gefangen fühlt. Die Wechselwirkungen zwischen idealisierter Liebe und unaufhörlichem Schmerz sind zentrale Themen in der mittelalterlichen Liebesdichtung, und Morungen gelingt es, diese komplexen Emotionen auf kraftvolle Weise auszudrücken.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.