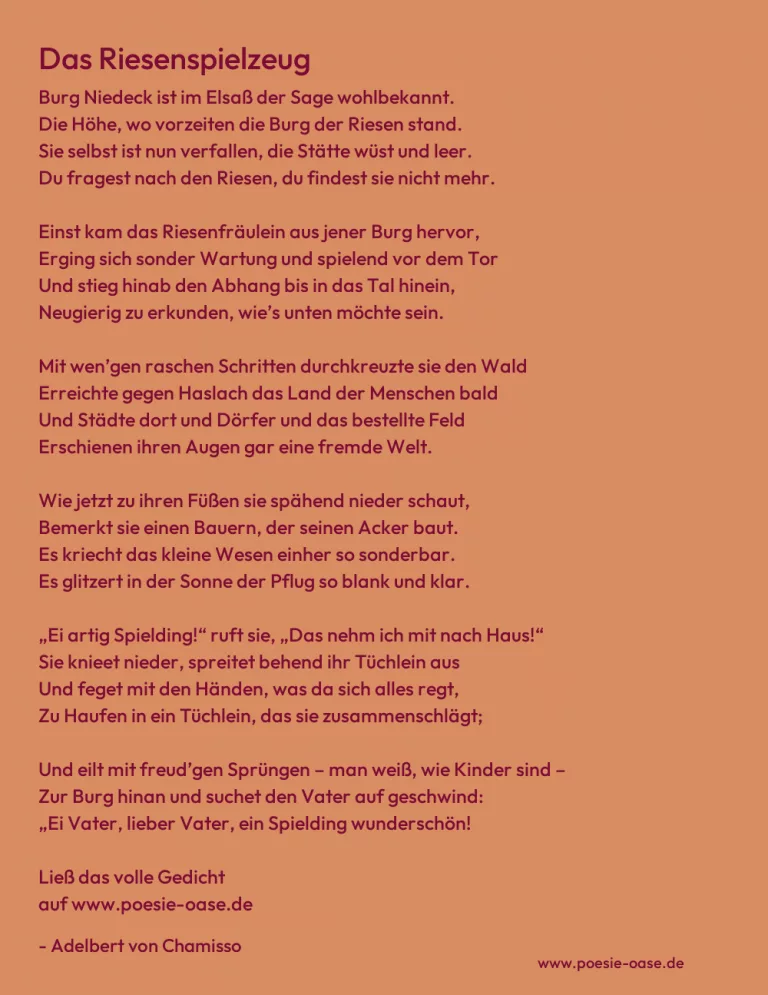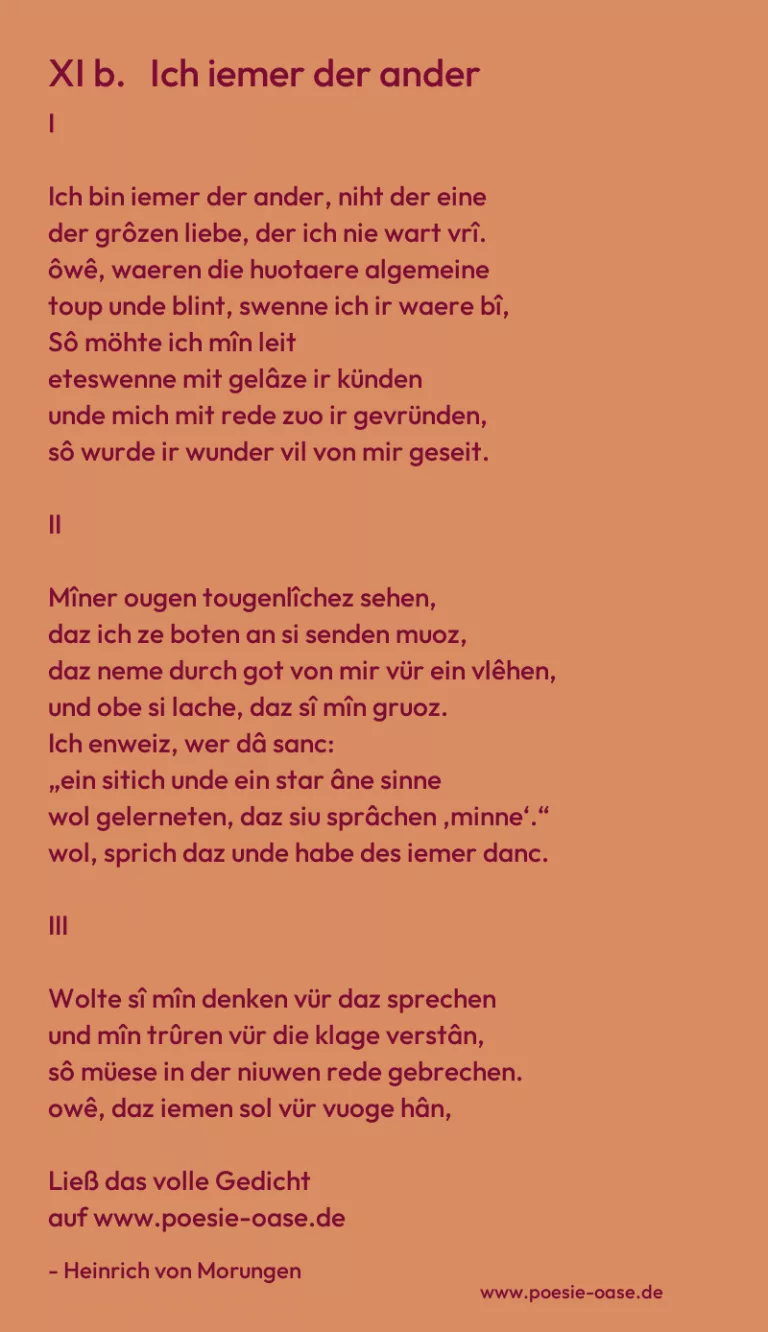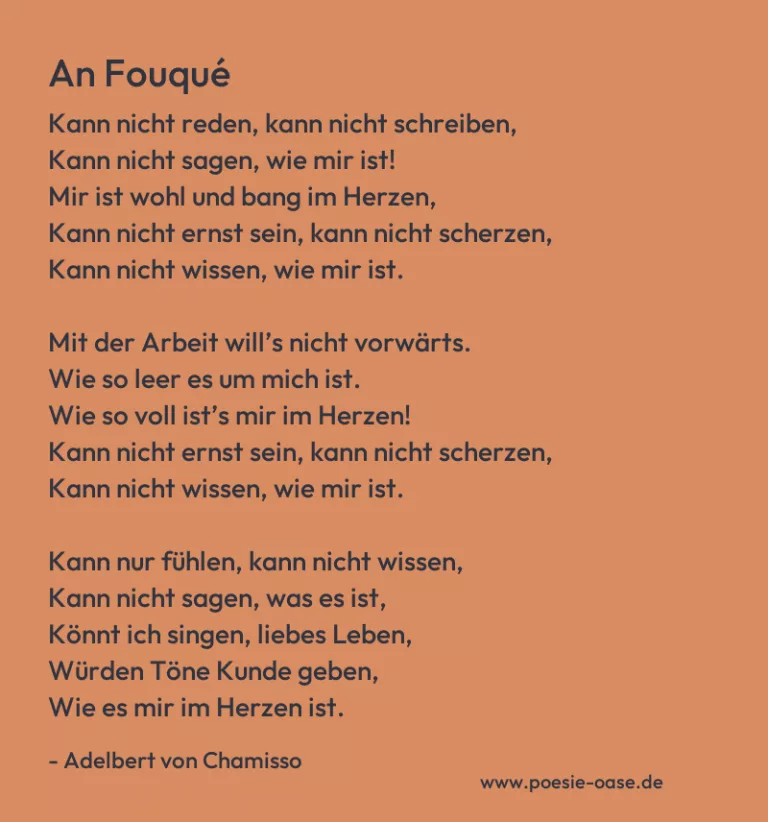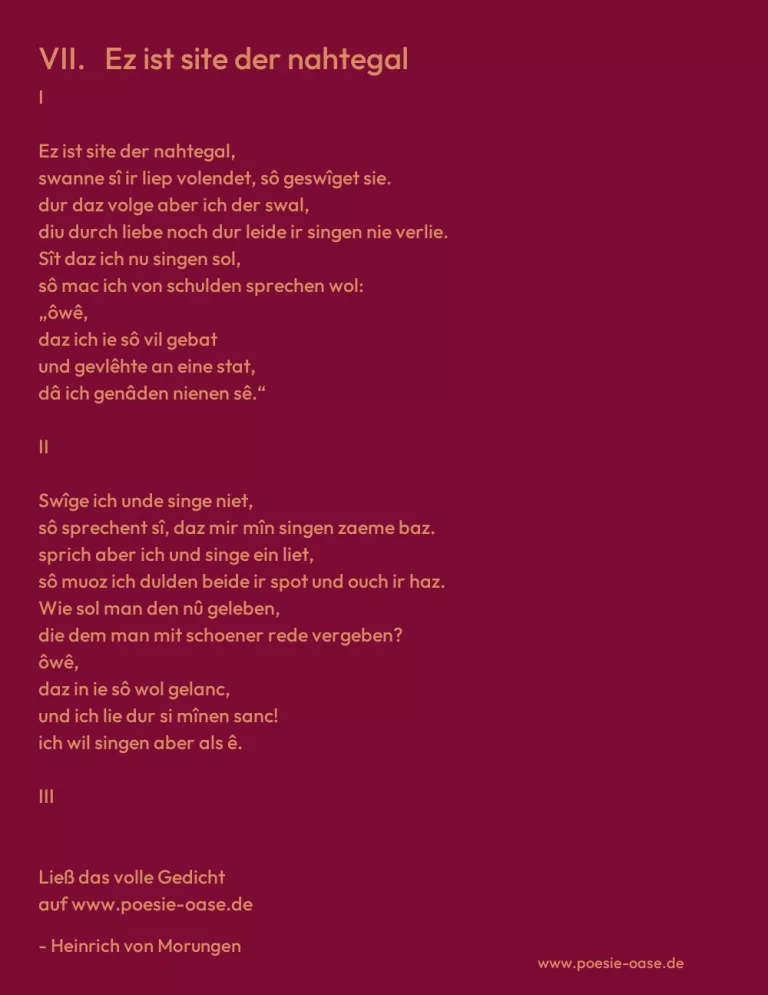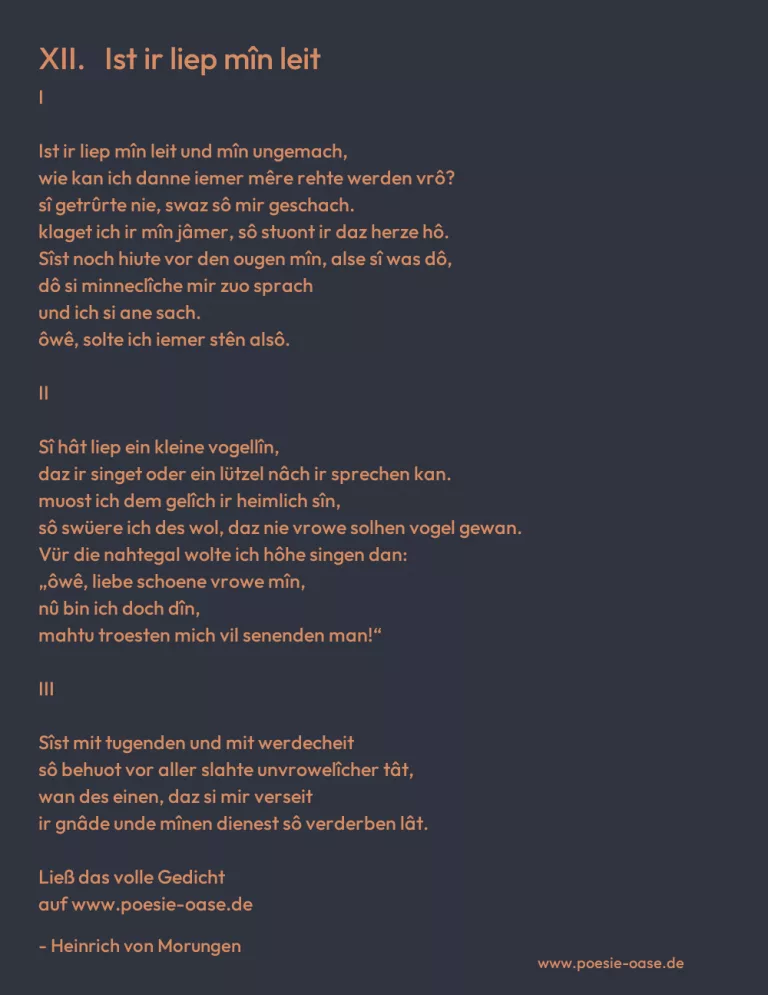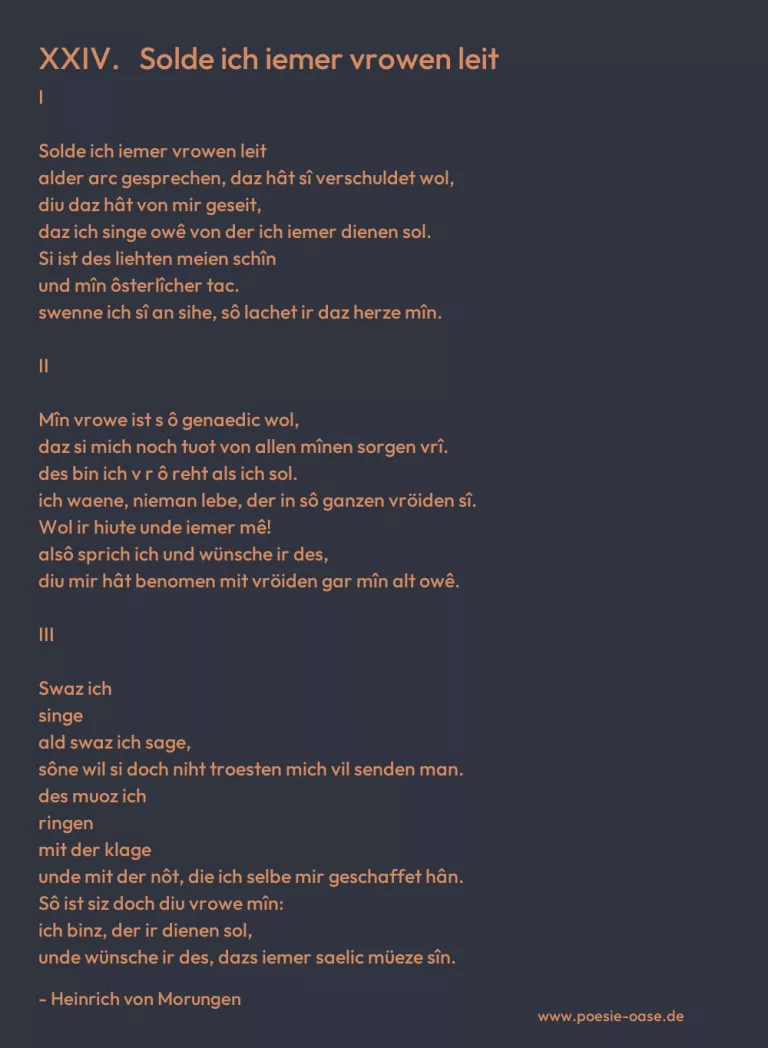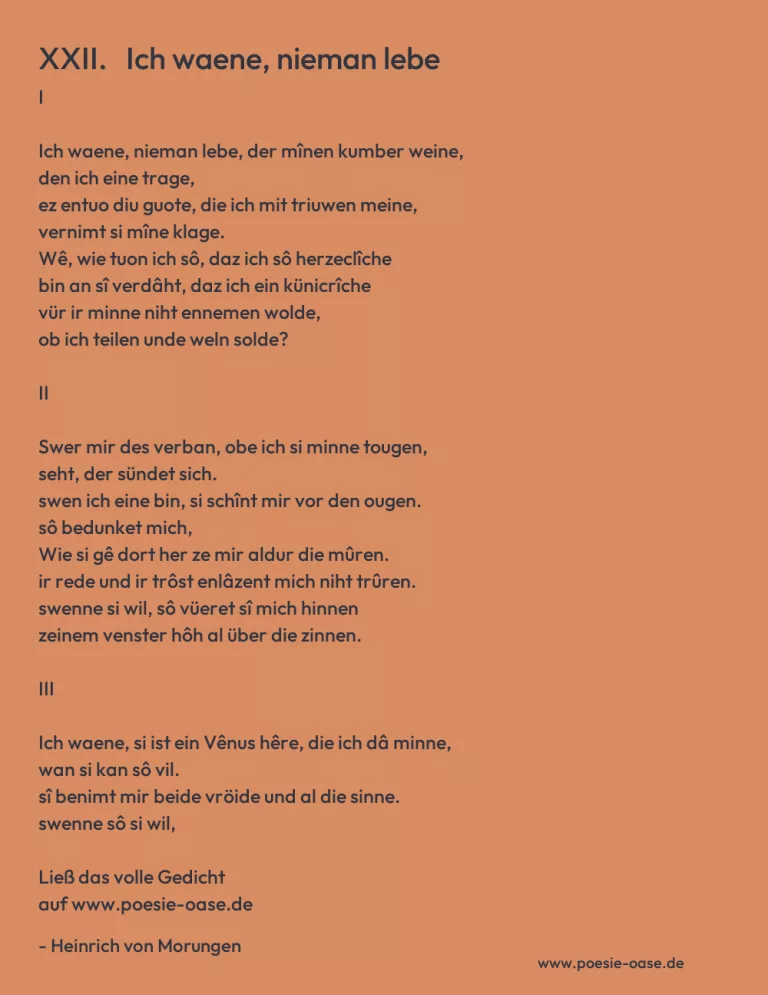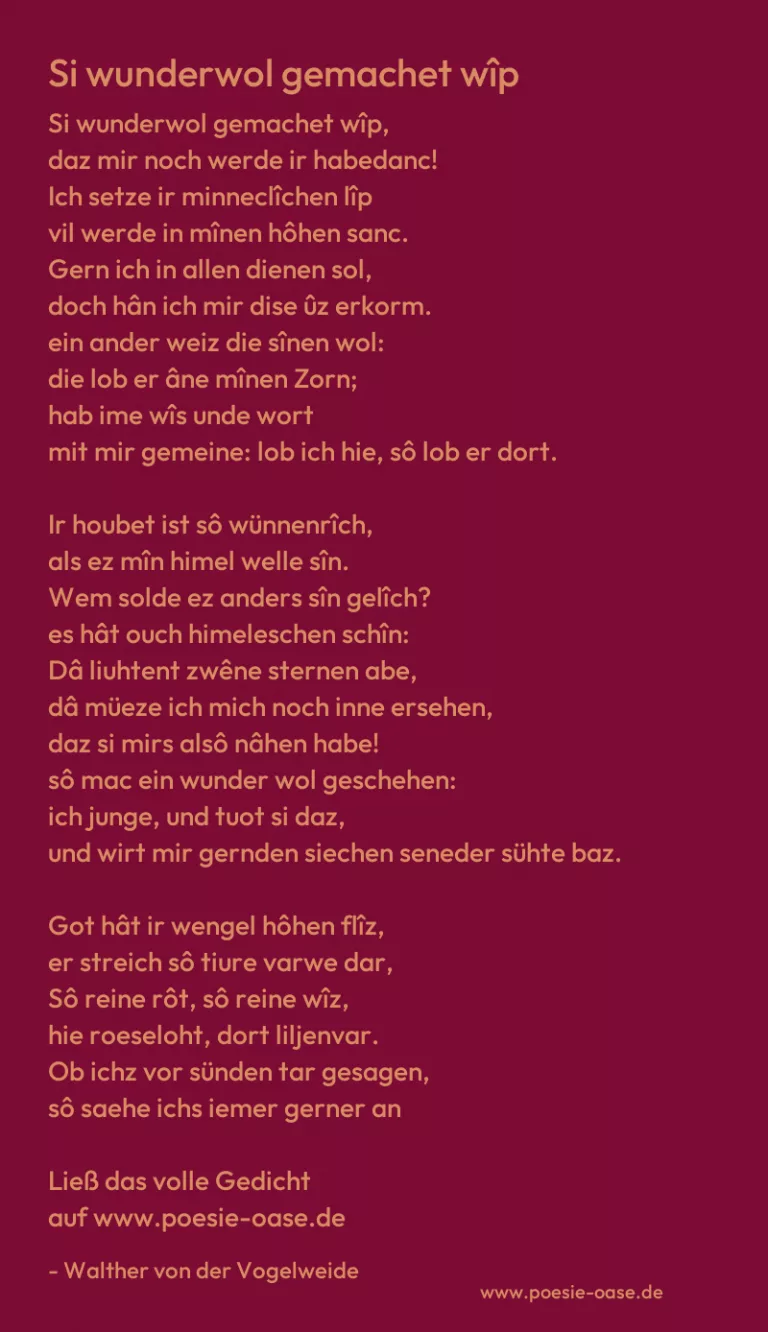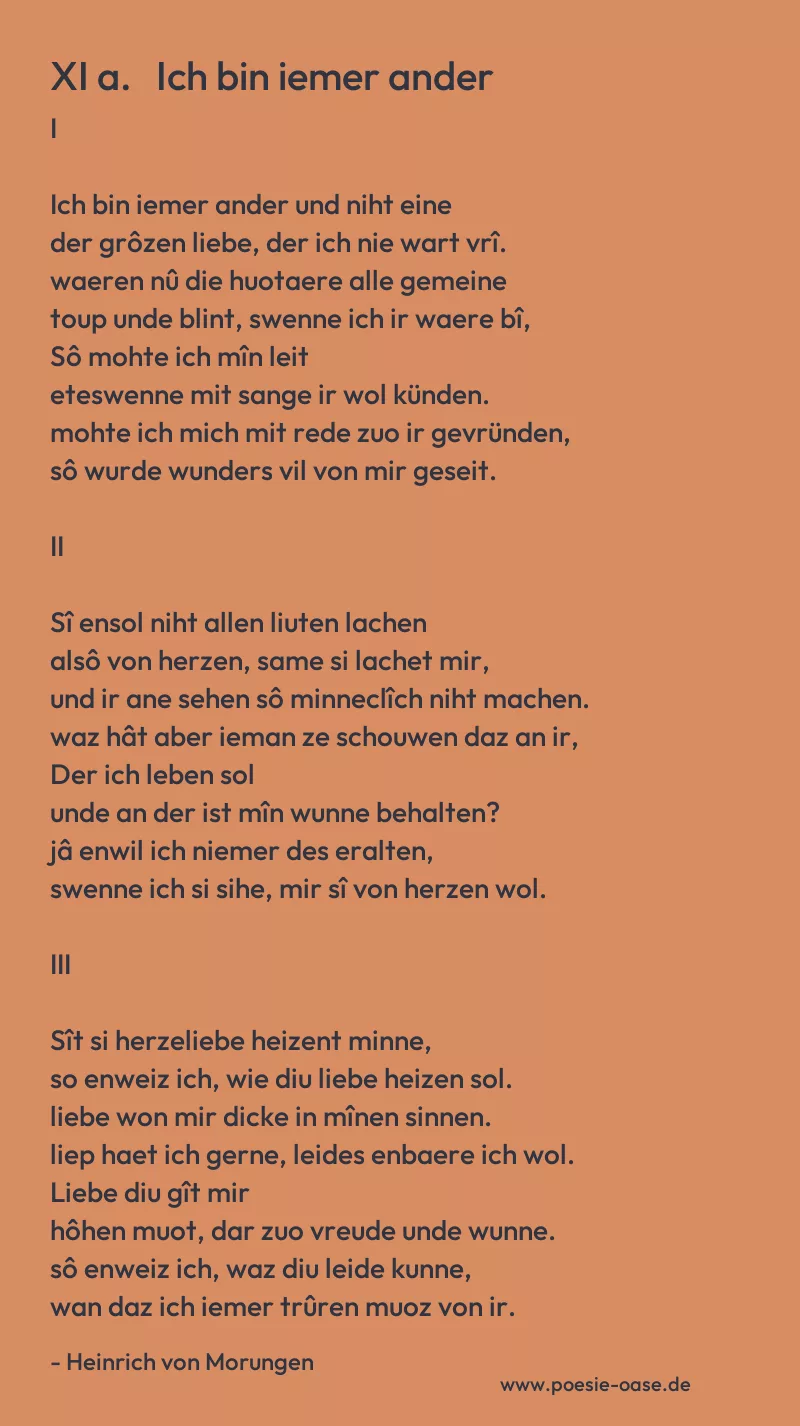XI a. Ich bin iemer ander
I
Ich bin iemer ander und niht eine
der grôzen liebe, der ich nie wart vrî.
waeren nû die huotaere alle gemeine
toup unde blint, swenne ich ir waere bî,
Sô mohte ich mîn leit
eteswenne mit sange ir wol künden.
mohte ich mich mit rede zuo ir gevründen,
sô wurde wunders vil von mir geseit.
II
Sî ensol niht allen liuten lachen
alsô von herzen, same si lachet mir,
und ir ane sehen sô minneclîch niht machen.
waz hât aber ieman ze schouwen daz an ir,
Der ich leben sol
unde an der ist mîn wunne behalten?
jâ enwil ich niemer des eralten,
swenne ich si sihe, mir sî von herzen wol.
III
Sît si herzeliebe heizent minne,
so enweiz ich, wie diu liebe heizen sol.
liebe won mir dicke in mînen sinnen.
liep haet ich gerne, leides enbaere ich wol.
Liebe diu gît mir
hôhen muot, dar zuo vreude unde wunne.
sô enweiz ich, waz diu leide kunne,
wan daz ich iemer trûren muoz von ir.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
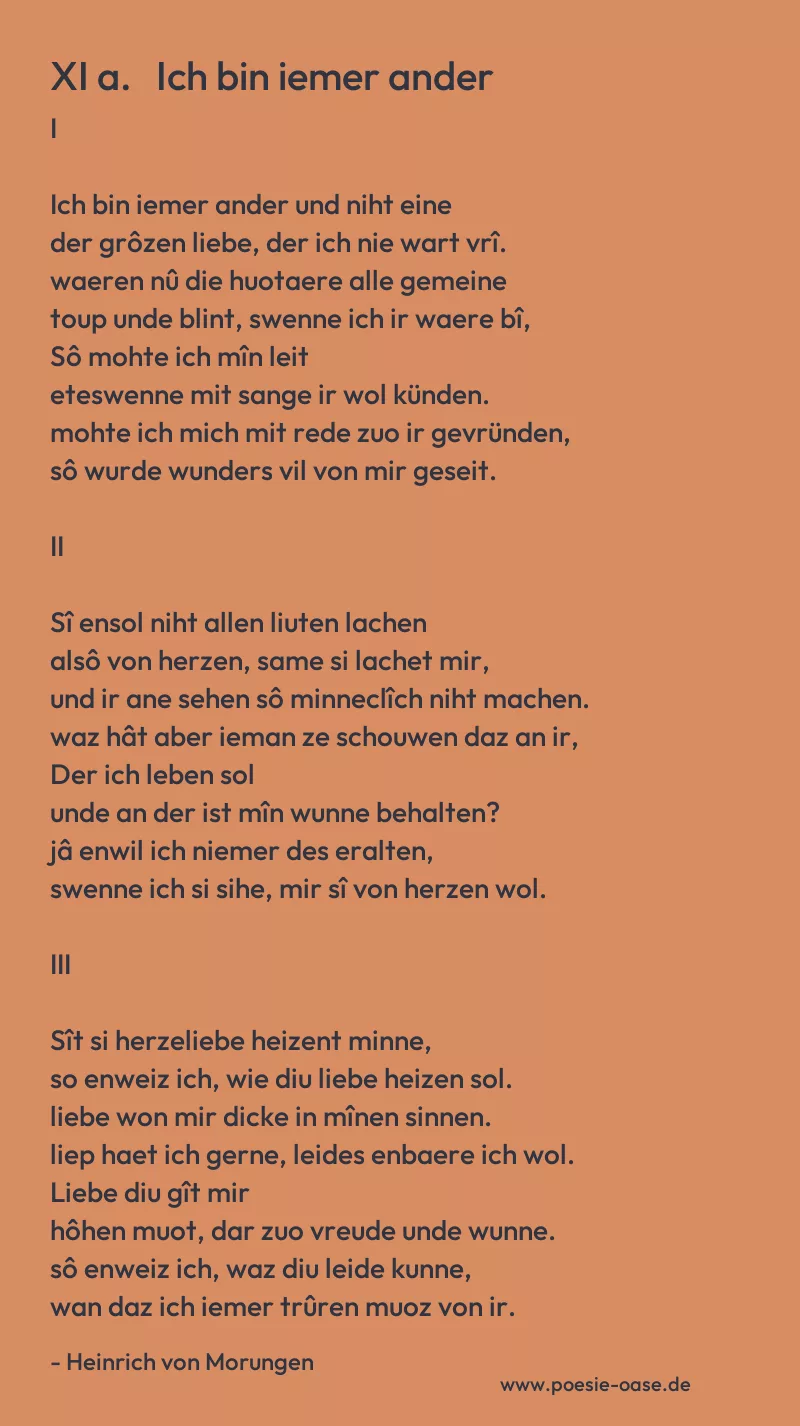
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich bin iemer ander“ von Heinrich von Morungen zeigt das innere Ringen des lyrischen Ichs mit der eigenen Rolle in der Liebe und seiner Sehnsucht nach einer vollkommenen, aber schmerzhaften Verbindung. Im ersten Teil des Gedichts drückt der Sprecher aus, dass er sich immer anders fühlt als die „große Liebe“, die er nie erfahren hat. Er stellt sich vor, wie es wäre, wenn er in der Nähe seiner Geliebten wäre – er könnte seine Schmerzen mit Gesang und Worten teilen. Doch diese Vorstellung bleibt unerreichbar, und er erkennt, dass seine tiefsten Gefühle und das Leid in ihm verborgen bleiben. Der Gedanke, dass er seine Liebe in Worte fassen könnte, um sich mit ihr zu verbinden, verweist auf das starke Verlangen nach Kommunikation und Nähe, das jedoch von einer Mauer des Unausgesprochenen blockiert wird.
Im zweiten Teil wird die Sehnsucht nach einer bedingungslosen, offenen Zuneigung thematisiert. Der Sprecher ist von der Idee besessen, dass Liebe und Freude nur dann vollständig sein können, wenn sie von Herzen kommen. Doch gleichzeitig zweifelt er daran, dass er je die wahre Liebe erfahren wird, da er von den Erwartungen der anderen und seiner eigenen Unfähigkeit, sich vollständig zu öffnen, eingeengt ist. Das Fehlen von echter Zuneigung seitens der Geliebten lässt ihn in tiefer Einsamkeit zurück, wodurch der Schmerz der Liebe in den Vordergrund rückt. Er kann nicht verstehen, warum die andere Person ihm nicht die gleiche Liebe entgegenbringt, die er für sie empfindet.
Im letzten Teil des Gedichts wird die Liebe als eine heilige und heilende Kraft beschrieben, die sowohl Freude als auch Leiden mit sich bringt. Der Sprecher erkennt, dass Liebe ihn zu „hohem Mut“ führt und ihm Freude verschafft, aber auch Leid und Tränen mit sich bringt. Diese Erkenntnis zeigt die doppelte Natur der Liebe: Sie gibt und nimmt gleichzeitig. Der Dichter akzeptiert, dass das Streben nach Liebe unvermeidlich mit Schmerz verbunden ist, was jedoch nicht von der intensiven Sehnsucht nach Liebe ablenkt. Das Gedicht endet mit einem bittersüßen Ton, der die Untrennbarkeit von Freude und Schmerz in der Liebe illustriert.
Das Gedicht spiegelt Morungens typische Themen wider – die Zwiespältigkeit der Liebe, die ständige Spannung zwischen Sehnsucht und Enttäuschung sowie die Vorstellung, dass wahre Liebe sowohl ein Geschenk als auch eine Last ist. Die emotionale Tiefe und das Ringen mit der Liebe machen das Gedicht zu einem ausdrucksstarken Beispiel mittelalterlicher Liebesdichtung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.