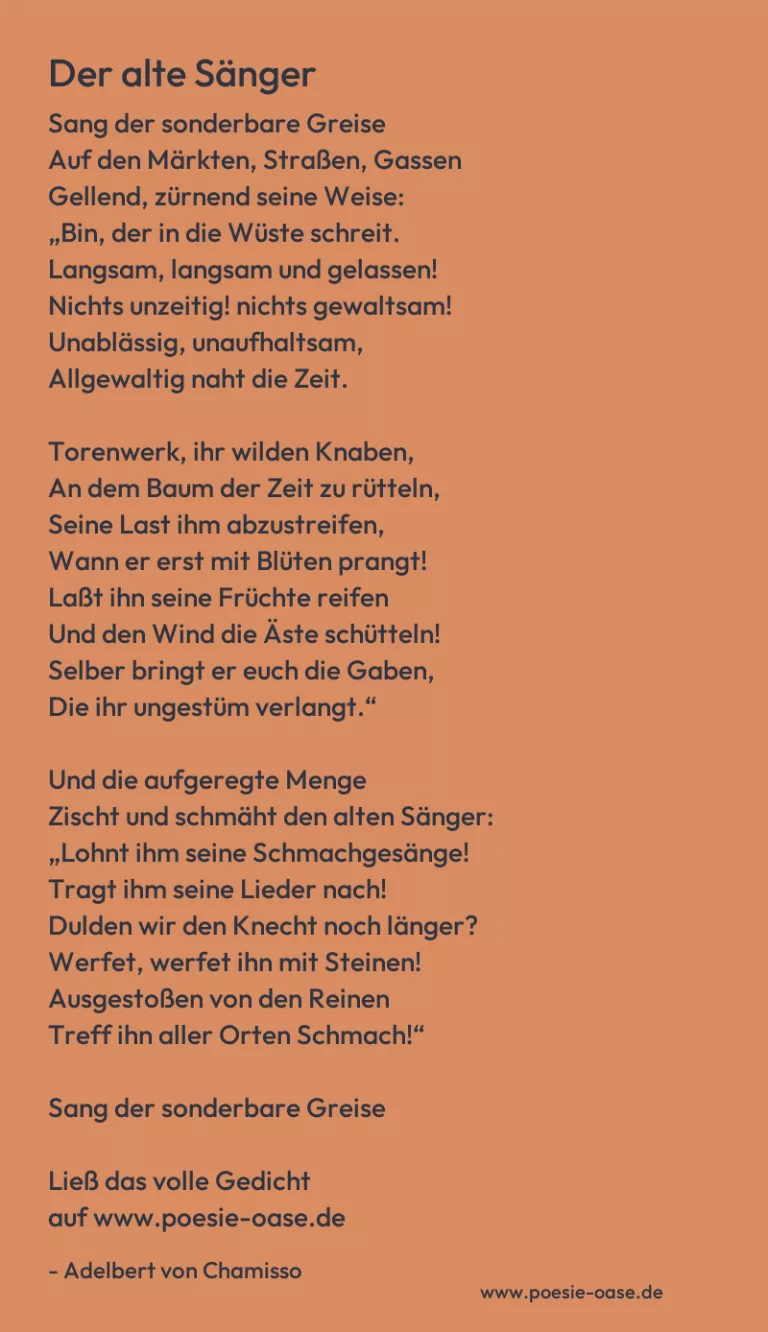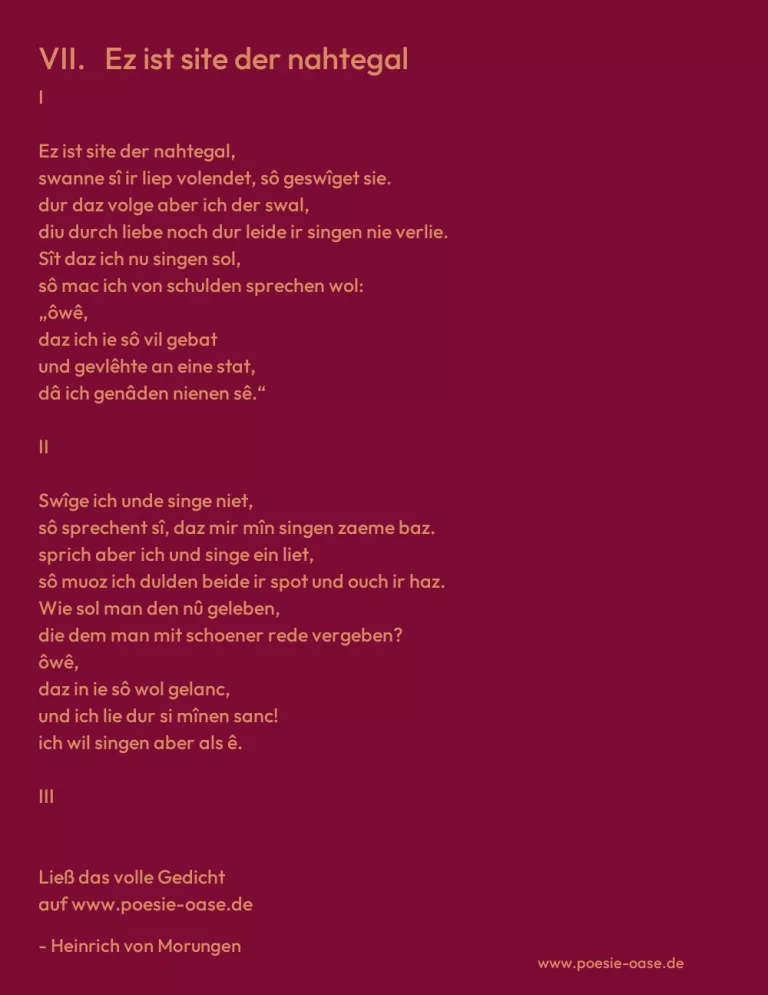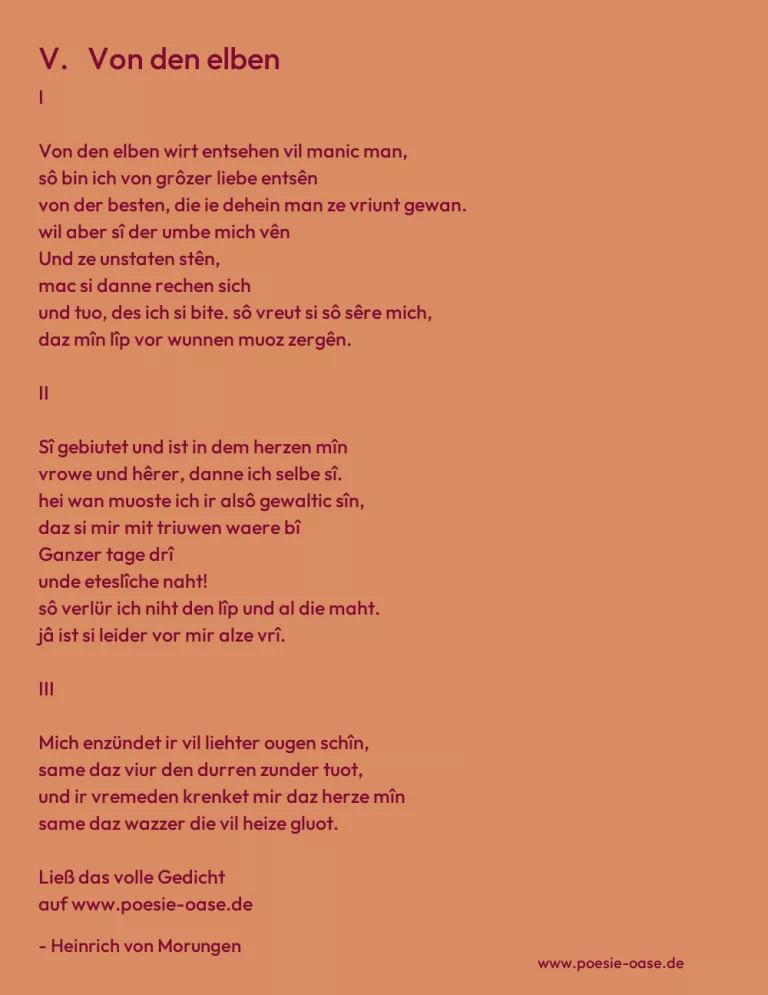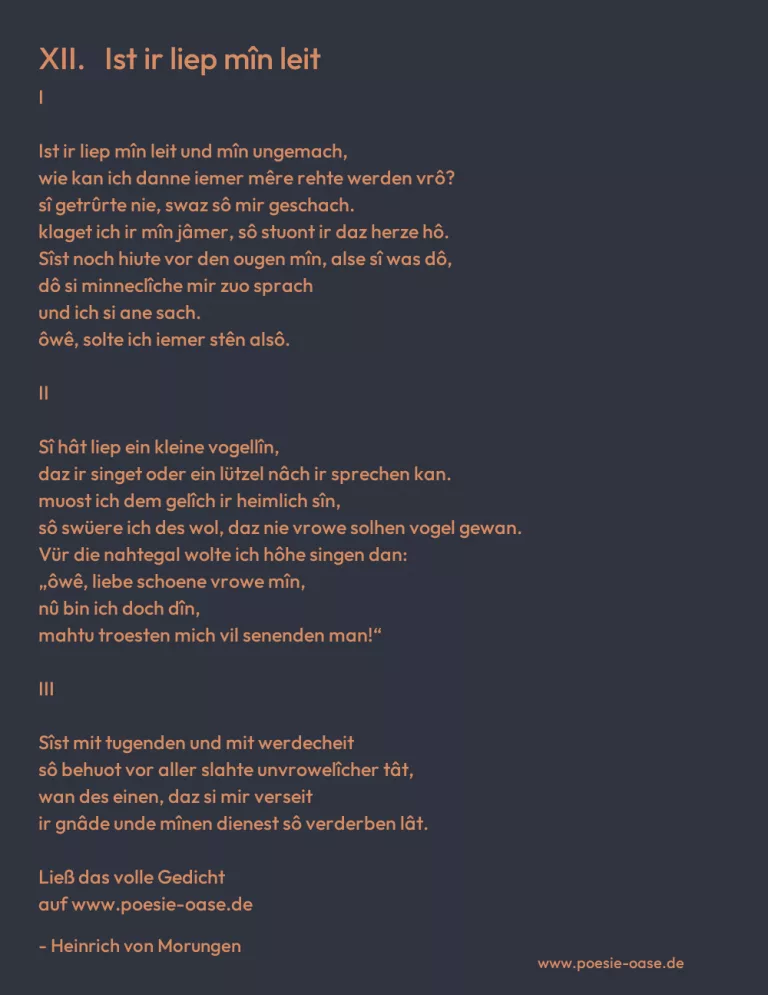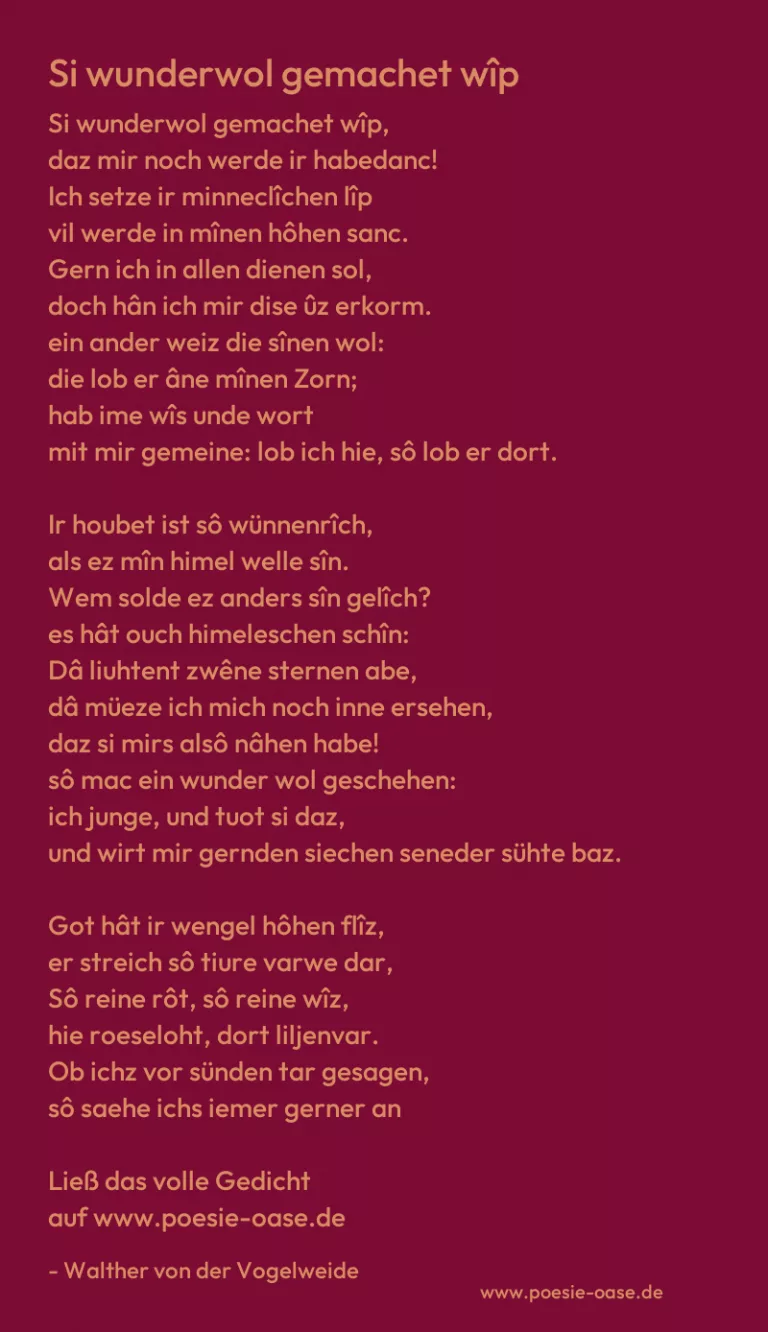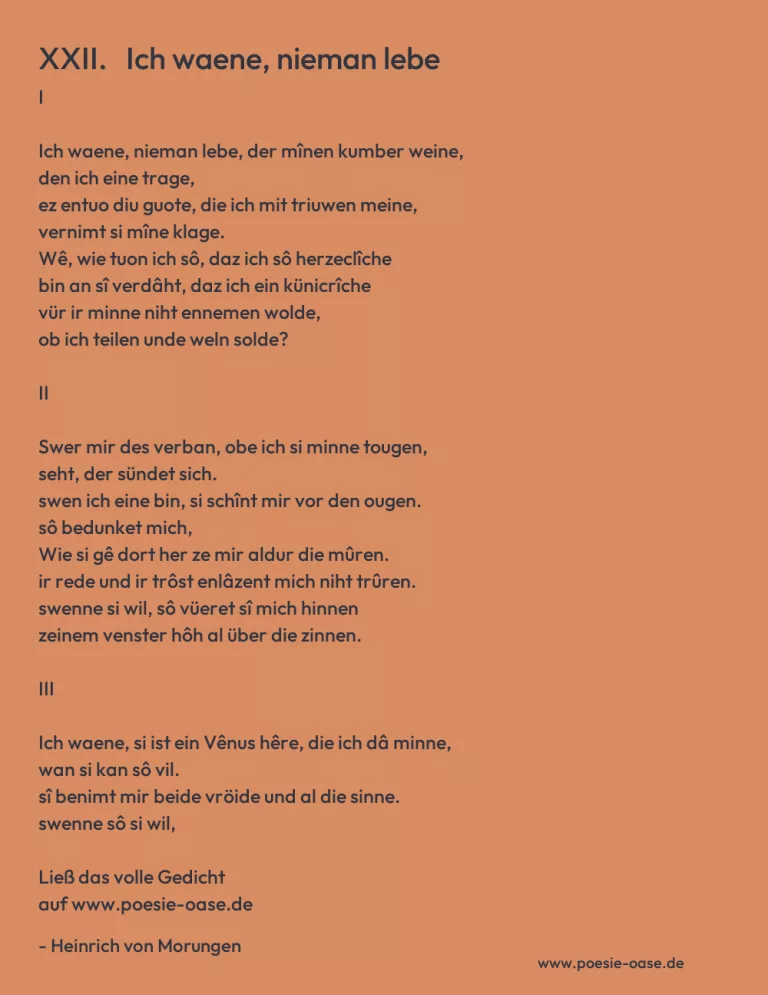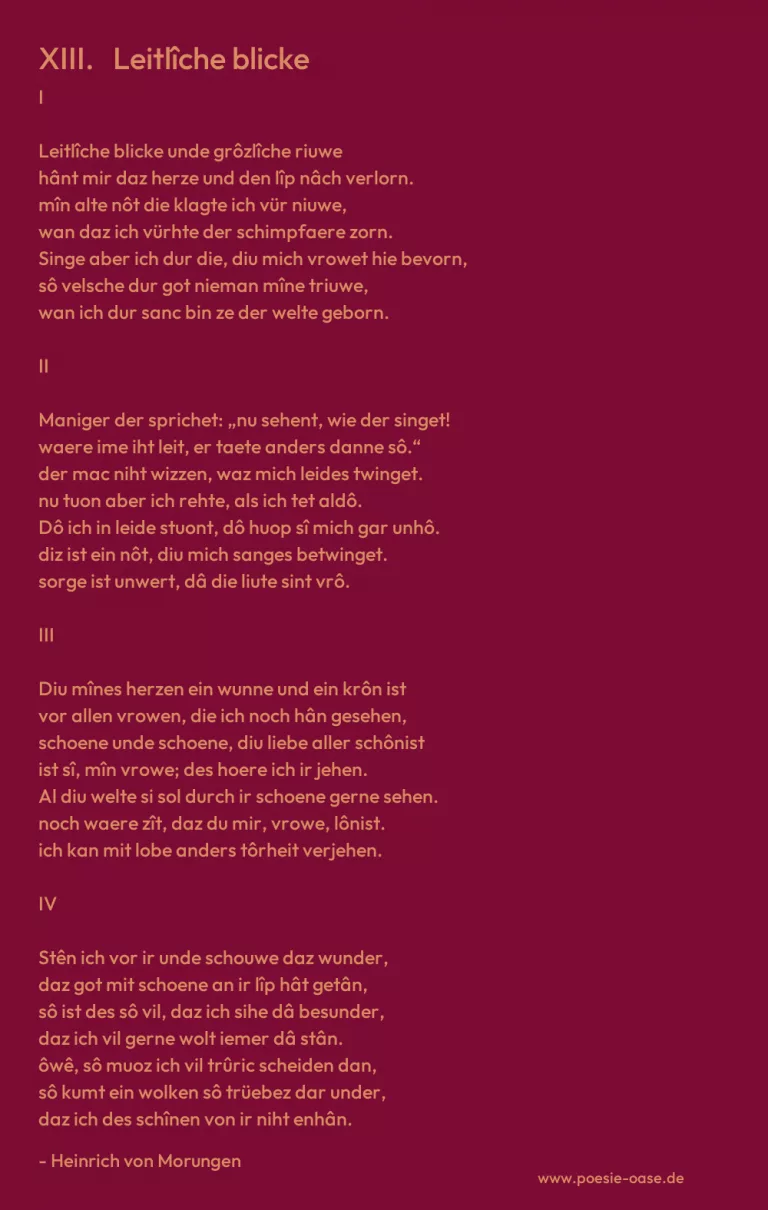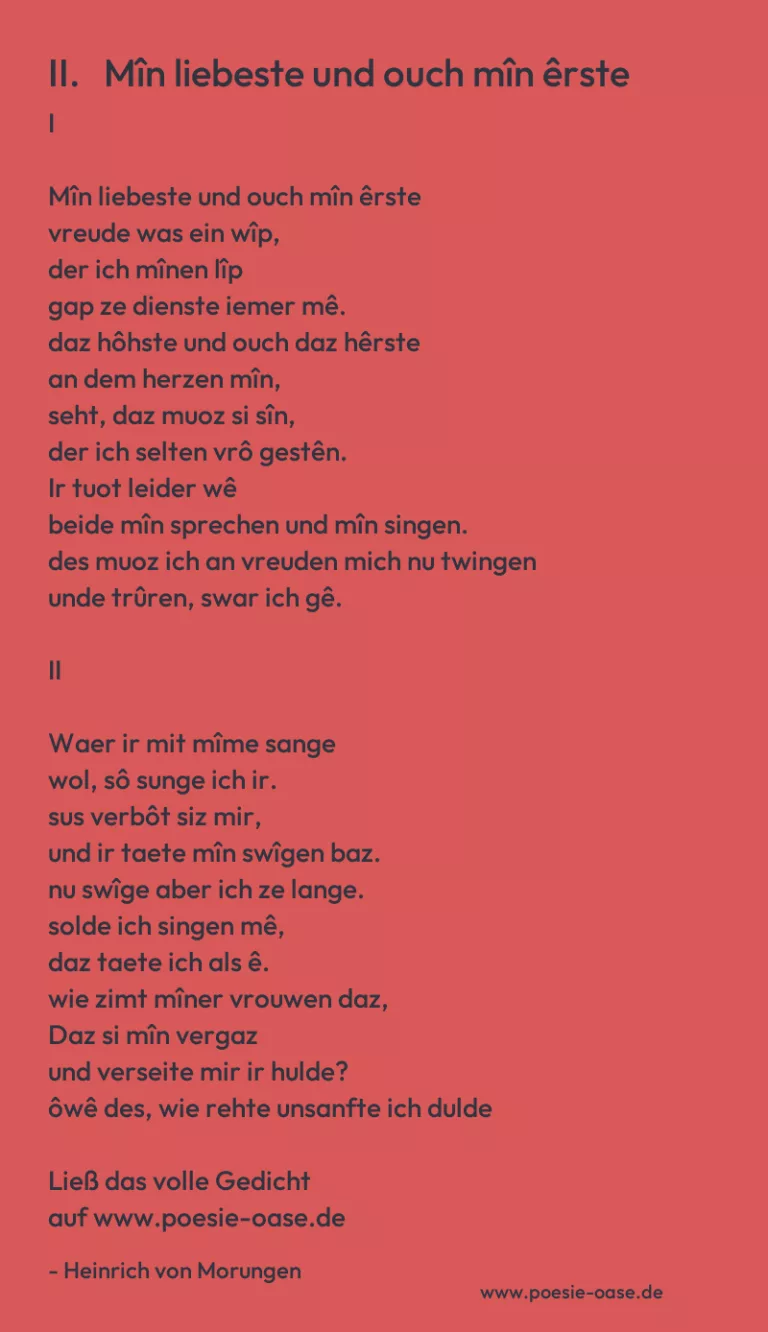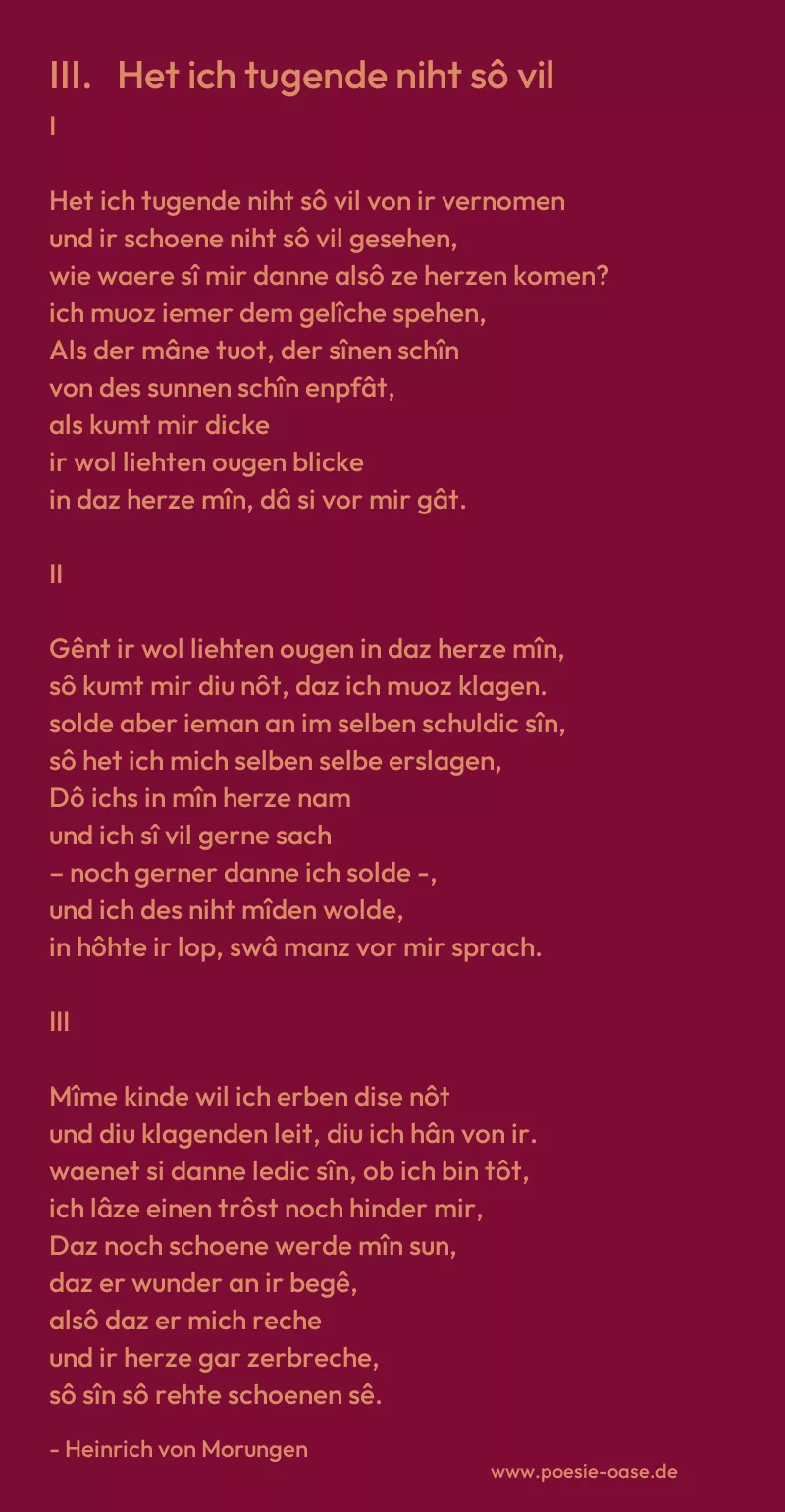III. Het ich tugende niht sô vil
I
Het ich tugende niht sô vil von ir vernomen
und ir schoene niht sô vil gesehen,
wie waere sî mir danne alsô ze herzen komen?
ich muoz iemer dem gelîche spehen,
Als der mâne tuot, der sînen schîn
von des sunnen schîn enpfât,
als kumt mir dicke
ir wol liehten ougen blicke
in daz herze mîn, dâ si vor mir gât.
II
Gênt ir wol liehten ougen in daz herze mîn,
sô kumt mir diu nôt, daz ich muoz klagen.
solde aber ieman an im selben schuldic sîn,
sô het ich mich selben selbe erslagen,
Dô ichs in mîn herze nam
und ich sî vil gerne sach
– noch gerner danne ich solde -,
und ich des niht mîden wolde,
in hôhte ir lop, swâ manz vor mir sprach.
III
Mîme kinde wil ich erben dise nôt
und diu klagenden leit, diu ich hân von ir.
waenet si danne ledic sîn, ob ich bin tôt,
ich lâze einen trôst noch hinder mir,
Daz noch schoene werde mîn sun,
daz er wunder an ir begê,
alsô daz er mich reche
und ir herze gar zerbreche,
sô sîn sô rehte schoenen sê.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
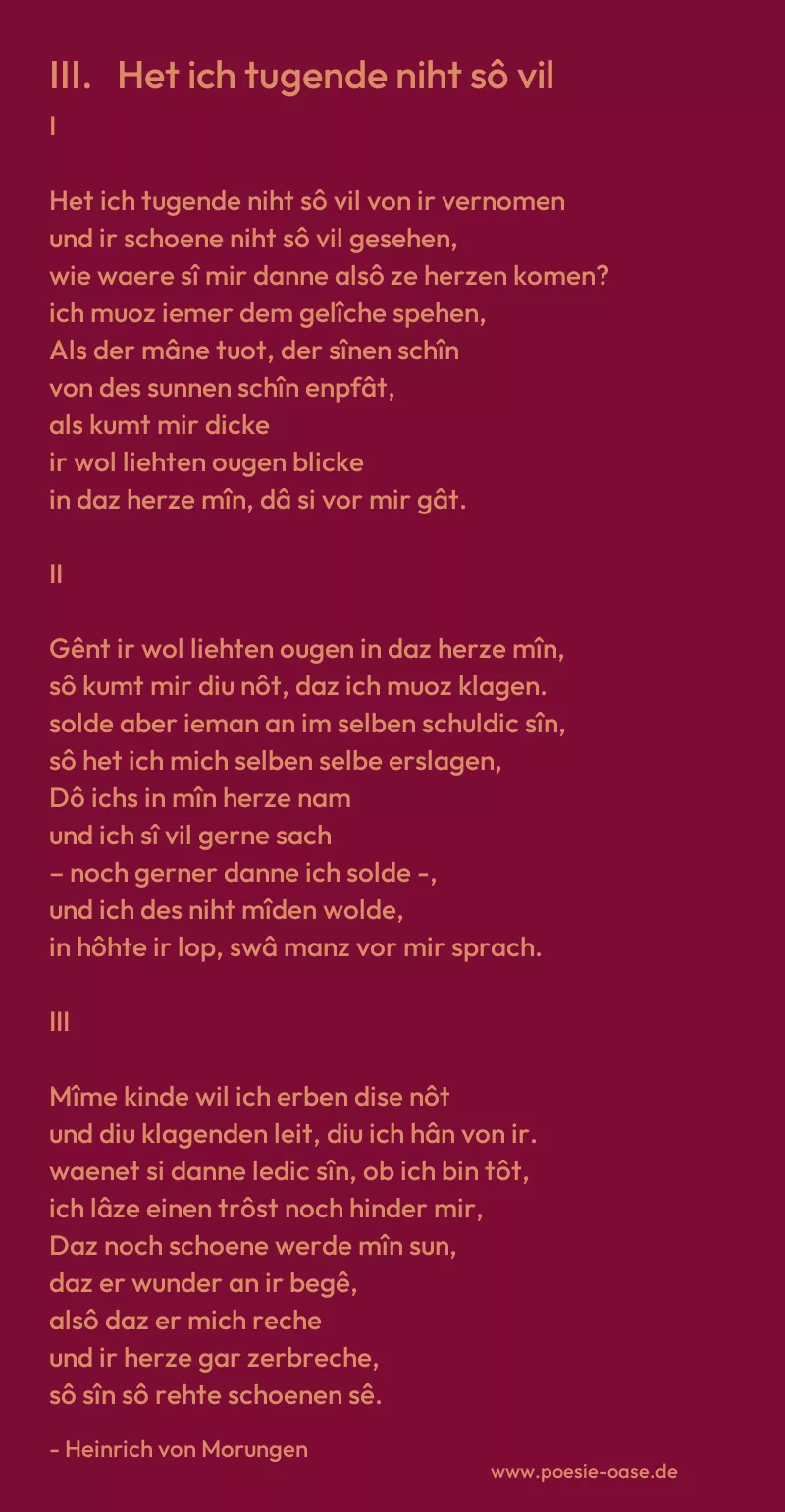
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Het ich tugende niht“ von Heinrich von Morungen entfaltet das innere Ringen des lyrischen Ichs mit seiner Liebe, die gleichzeitig Quelle von Freude und Schmerz ist. In der ersten Strophe beschreibt der Sprecher, wie er sich an die Geliebte erinnert und wie ihre Schönheit und Tugend ihm immer wieder ins Herz dringen, als wären sie von der Sonne erleuchtet. Diese Darstellung ihrer Augen und ihrer Schönheit, die ihm wie ein Lichtstrahl erscheinen, symbolisiert die nahezu göttliche Anziehungskraft, die sie auf ihn ausübt. Doch die Schönheit und Anmut der Geliebten sind für ihn gleichzeitig auch eine Quelle des Leidens, da sie ihm ihre Liebe verweigert und er nur in der Sehnsucht nach ihr lebt. Die Sonne als Metapher für die Geliebte und ihre unaufhörliche Präsenz in seinem Inneren spiegeln seine Ohnmacht, sich von ihr zu lösen.
In der zweiten Strophe erkennt der Sprecher, dass der Blick der Geliebten, ihre „wol liehten ougen“ (hellen Augen), zwar Schönheit und Freude mit sich bringt, ihm jedoch auch ein tiefes Leid verursacht. Die Unmöglichkeit, ihr zu entkommen, wird hier als tragisch empfunden, da der Sprecher das Gefühl hat, in diesem Leiden gefangen zu sein. Er verweist auf das „gelîche“ (Gleichnis) des Mondes, der sich von der Sonne abbilden lässt – ein Bild für die unerreichbare Liebe und den schmerzhaften Zustand des Verlangens. Der Sprecher verurteilt sich fast selbst für seine Gefühle, da er weiß, dass seine Liebe ihn nur weiter in diese Qual treibt, und erkennt, dass er sich selbst damit bestraft. Die Geliebte wird zur Quelle von sowohl Freude als auch Qual, was die Ambivalenz der Liebe in Morungens Dichtung verdeutlicht.
Im dritten Teil des Gedichts äußert der Sprecher eine düstere Vorstellung, wie seine Zukunft ohne die Geliebte aussehen könnte. Er spricht von der „nôt“ (Not), die er von ihr erben würde – als ob der Schmerz, den er durch ihre Abwesenheit empfindet, ein Erbe ist, das er an die nächste Generation weitergibt. Der Gedanke, dass er „tot“ sein könnte, ohne dass die Geliebte ihm ihre Zuneigung schenkt, deutet auf die seelische Erschöpfung und den tiefen Verlust hin, den der Sprecher befürchtet. Doch selbst im Tod gibt er sich nicht auf; er hofft, dass sein „Sun“ (Sohn) eines Tages den Schmerz und das Leid erleben wird, das er selbst erfahren hat. In dieser Vorstellung wird das Erbe der unerfüllten Liebe als ein grausames, aber auch allumfassendes Schicksal dargestellt.
Das Gedicht reflektiert die Themen der Selbstaufopferung und der unausweichlichen Qual, die die Liebe mit sich bringt. Morungen zeigt die paradoxe und tragische Natur der Liebe – sie ist zugleich Quelle der Freude und des Leidens. Die Geliebte bleibt ein unerreichbares Ideal, das den Sprecher sowohl erleuchtet als auch zerstört.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.