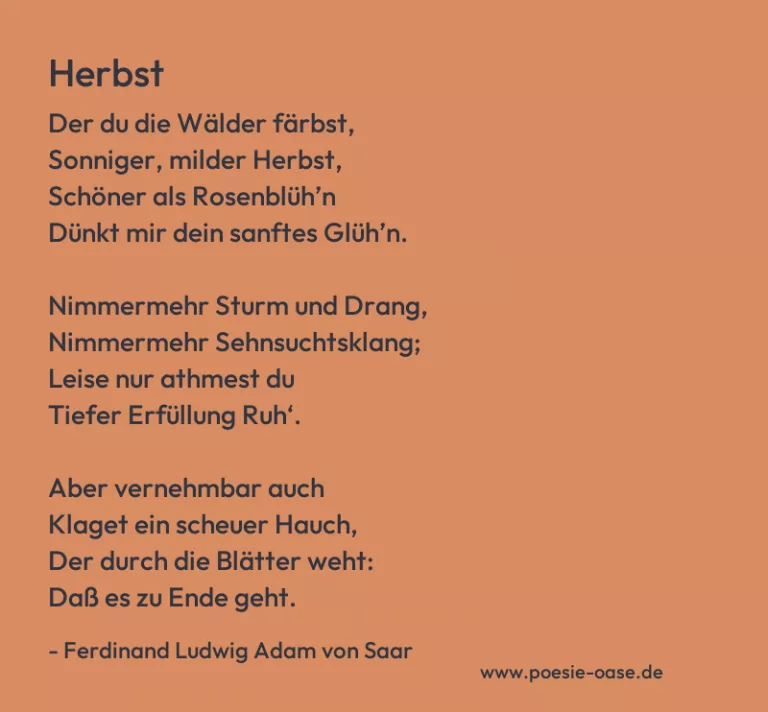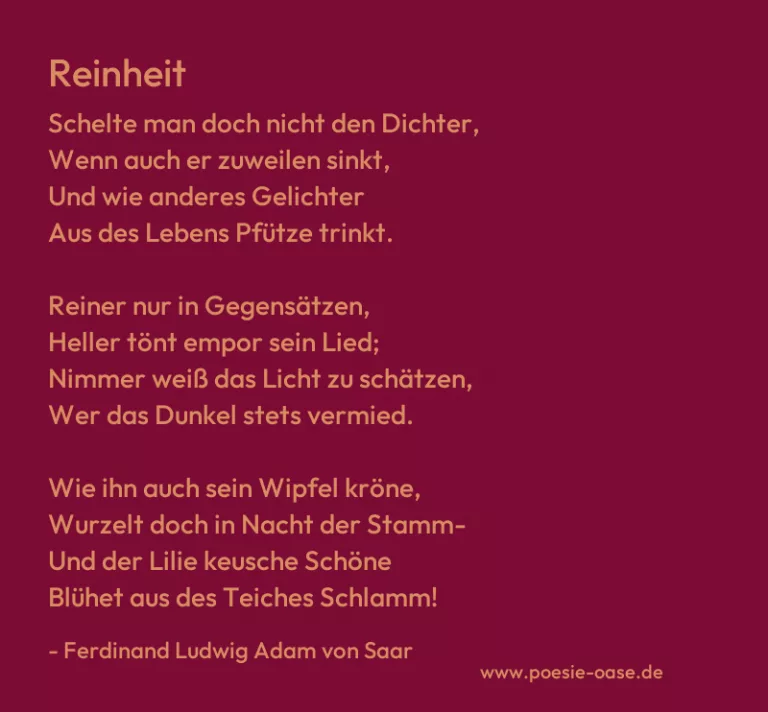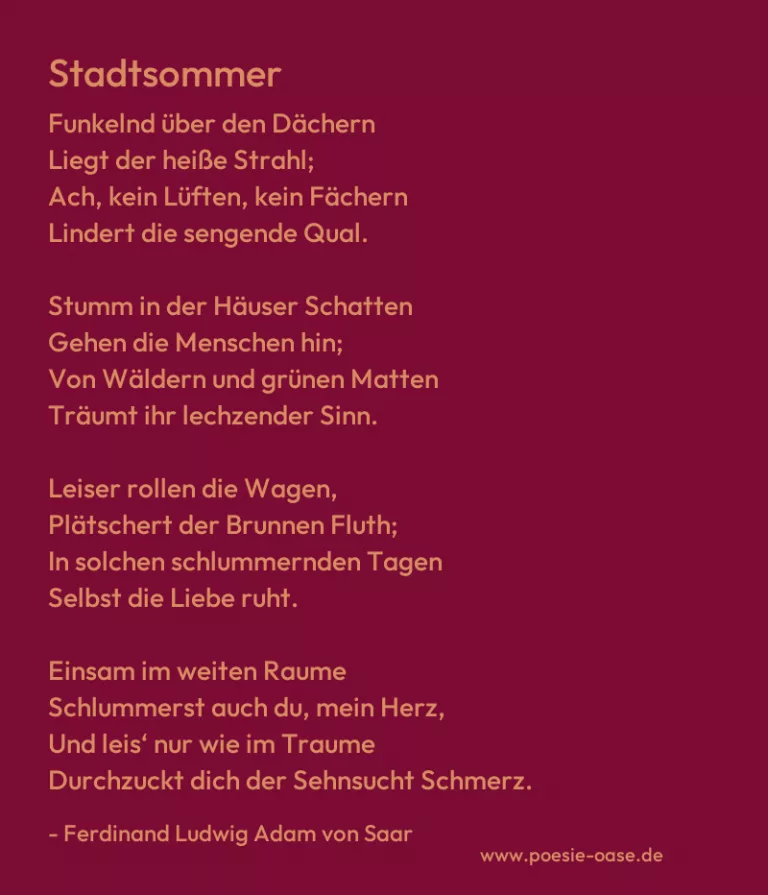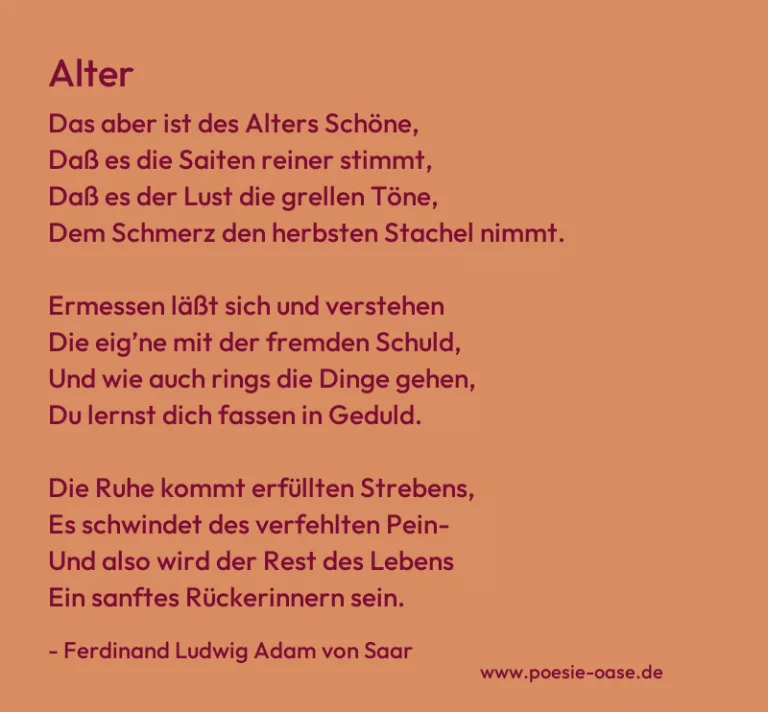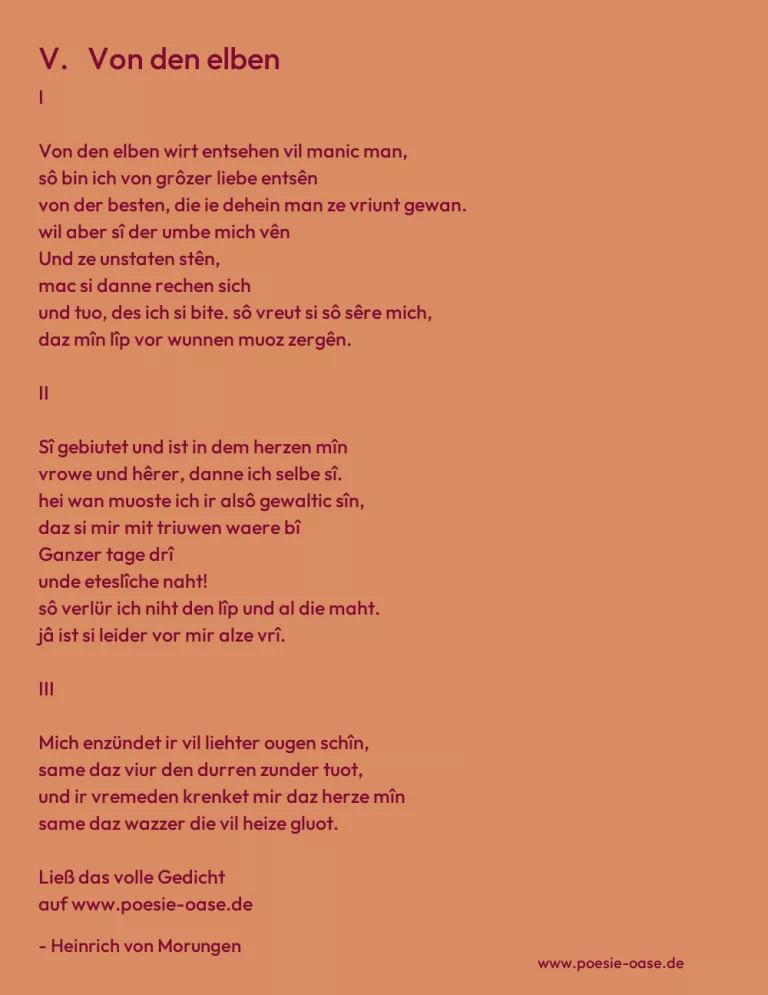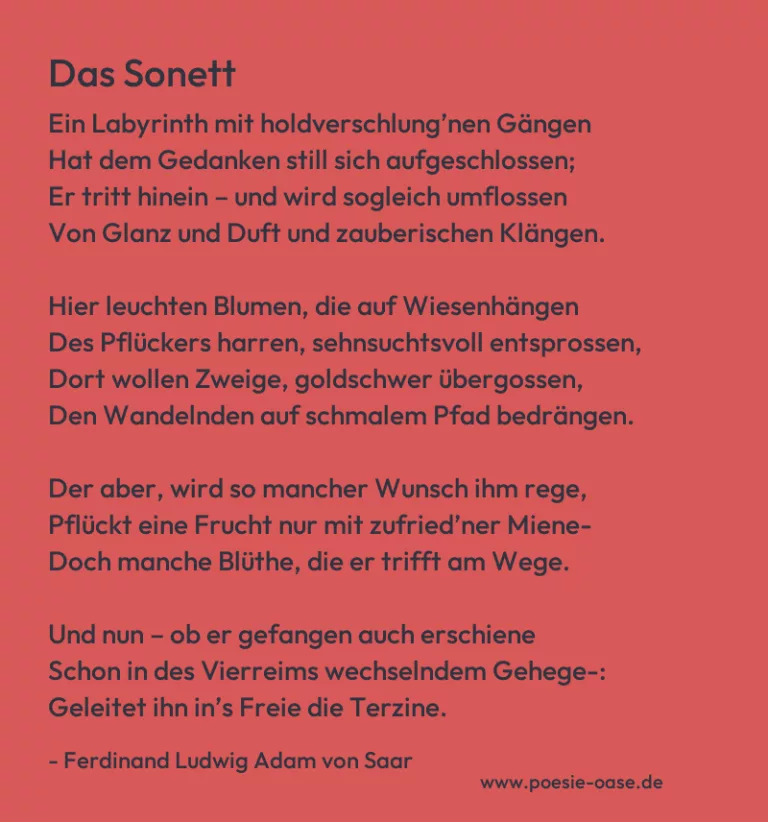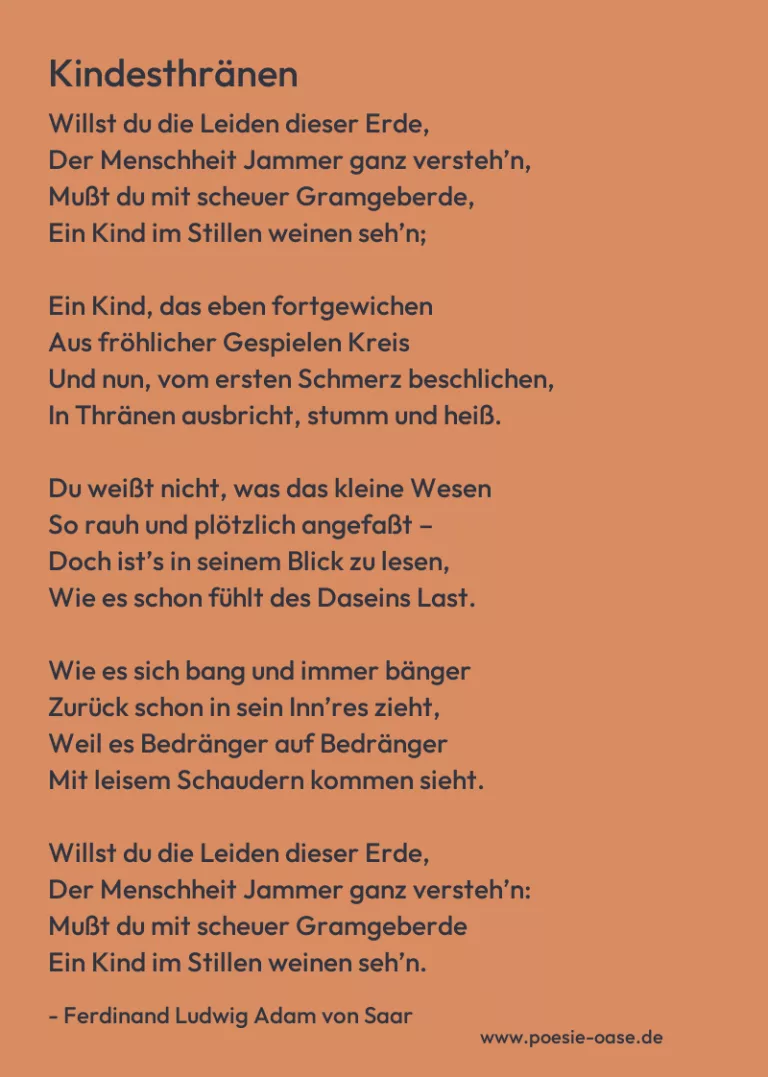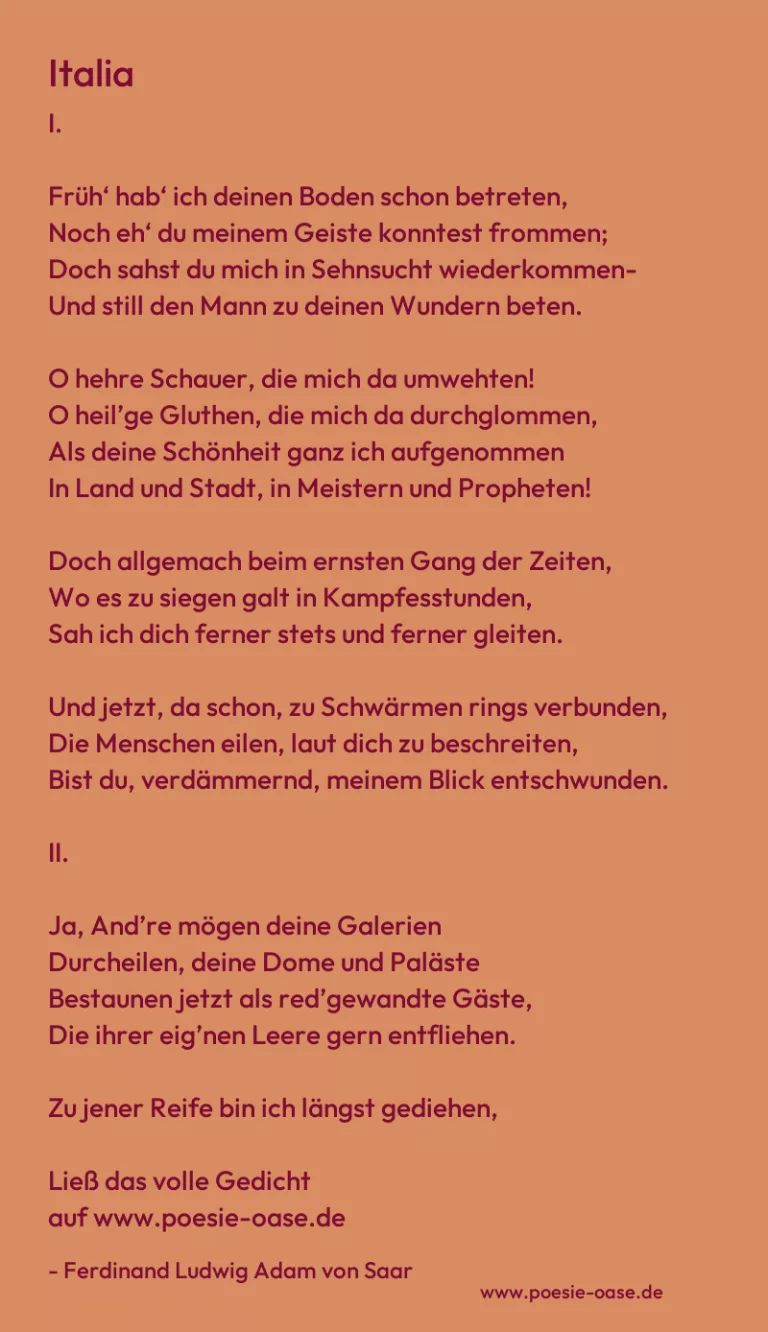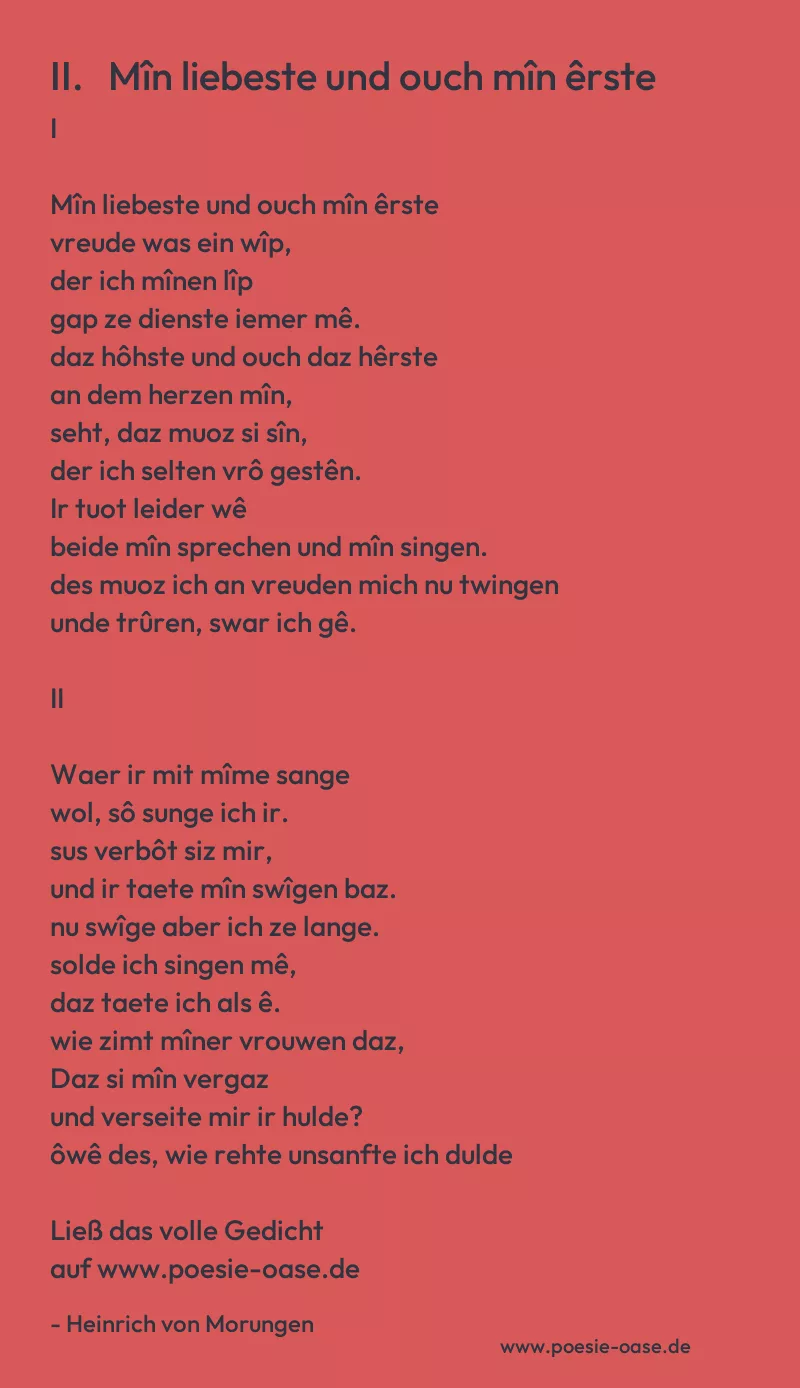I
Mîn liebeste und ouch mîn êrste
vreude was ein wîp,
der ich mînen lîp
gap ze dienste iemer mê.
daz hôhste und ouch daz hêrste
an dem herzen mîn,
seht, daz muoz si sîn,
der ich selten vrô gestên.
Ir tuot leider wê
beide mîn sprechen und mîn singen.
des muoz ich an vreuden mich nu twingen
unde trûren, swar ich gê.
II
Waer ir mit mîme sange
wol, sô sunge ich ir.
sus verbôt siz mir,
und ir taete mîn swîgen baz.
nu swîge aber ich ze lange.
solde ich singen mê,
daz taete ich als ê.
wie zimt mîner vrouwen daz,
Daz si mîn vergaz
und verseite mir ir hulde?
ôwê des, wie rehte unsanfte ich dulde
beide ir spot unde ouch ir haz!
III
Nu râtent, liebe vrouwen,
waz ich singen muge,
sô daz ez iuch tuge!
sanc ist âne vreude kranc.
ich enhân niht wan ein schouwen
von ir und den gruoz,
den si teilen muoz
al der welte sunder danc.
Diu zît ist ze lanc
âne vreude und âne wunne.
nû lâ sehen, wer mich gelêren kunne,
daz ich singe niuwen sanc!
IV
Vil wîplîch wîp, nu wende
mîne sende klage,
die ich tougen trage,
dû weist wol, wie lange zît.
ein saelden rîchez ende,
wirt mir daz von dir,
sô siht man an mir
vröide âne allen widerstrît,
Sît daz an der lît
mînes herzen hôchgemüete.
maht du troesten mich dur wîbes güete,
sît dîn trôst mir vröide gît?
V
Ich sihe wol, daz mîn vrouwe
mir ist vil gehaz.
doch versuoche ichz baz,
in verdiene ir werden gruoz.
des ich ir wol getrouwe,
daz hât sî versworn.
ir ist leider zorn,
daz ichz der werlte künden muoz,
Daz ich niemer vuoz
von ir dienste mich gescheide,
ez kom mir ze liebe alder ze leide.
lîhte wirt mir swaere buoz.