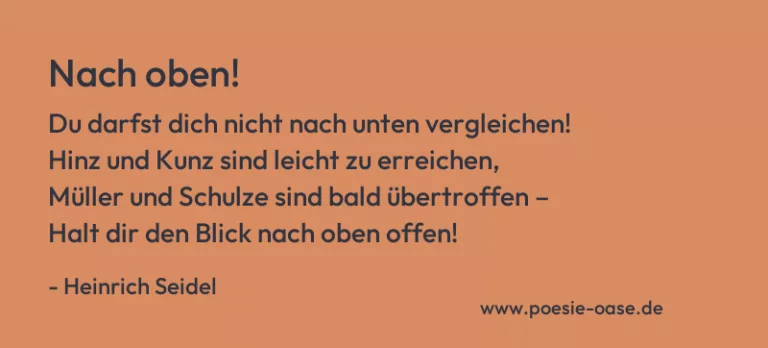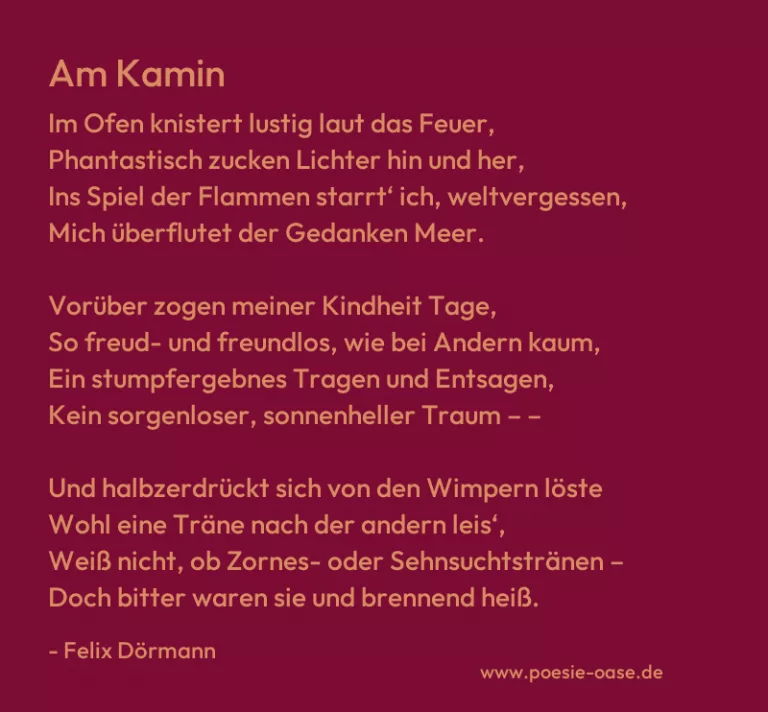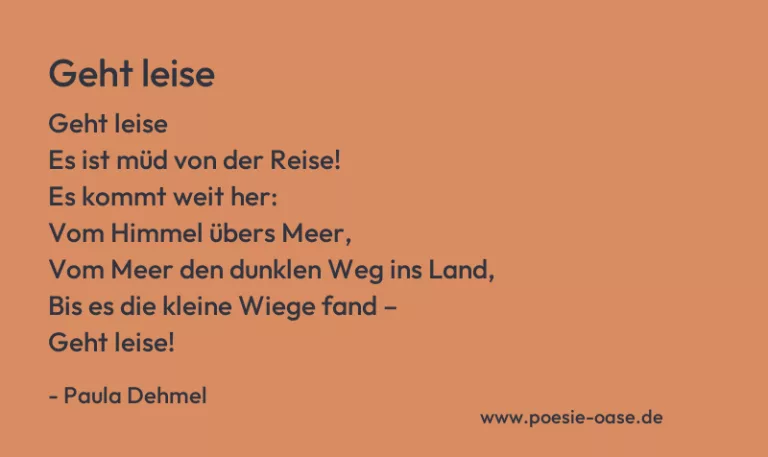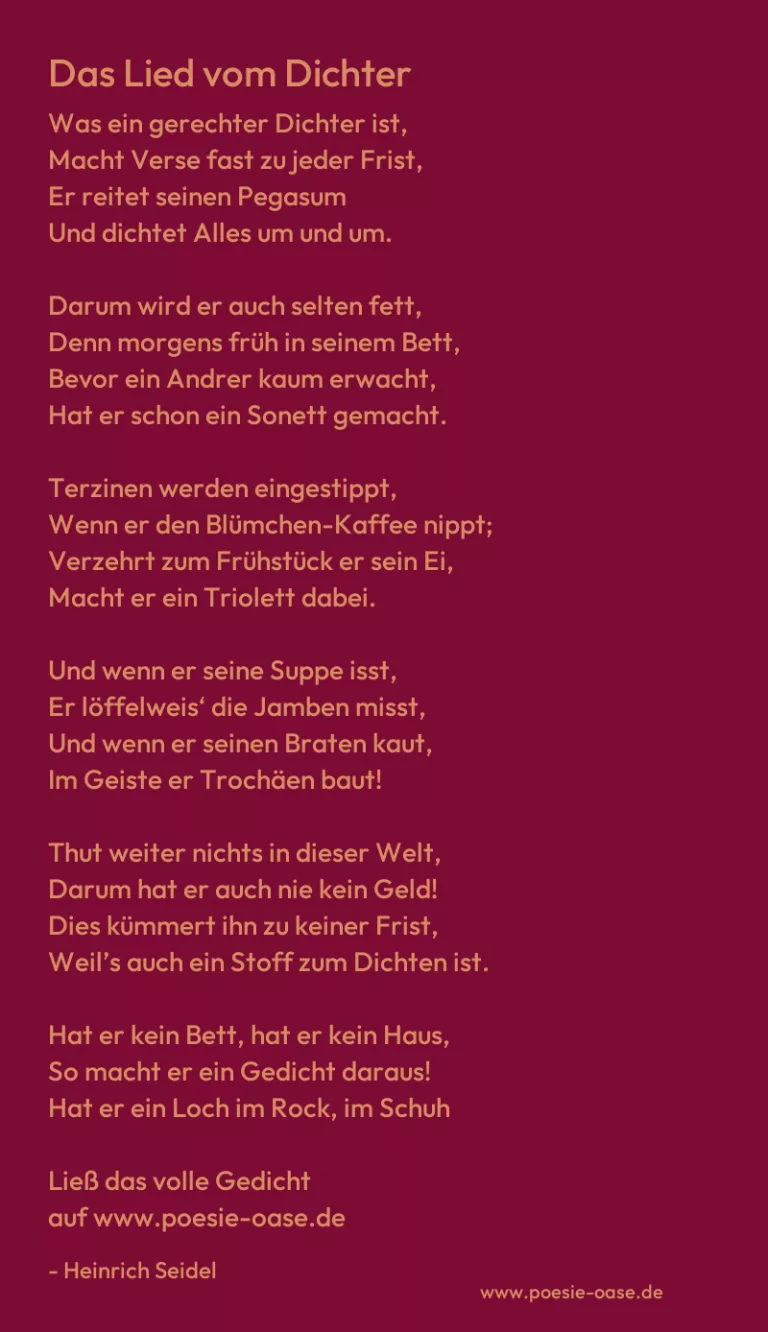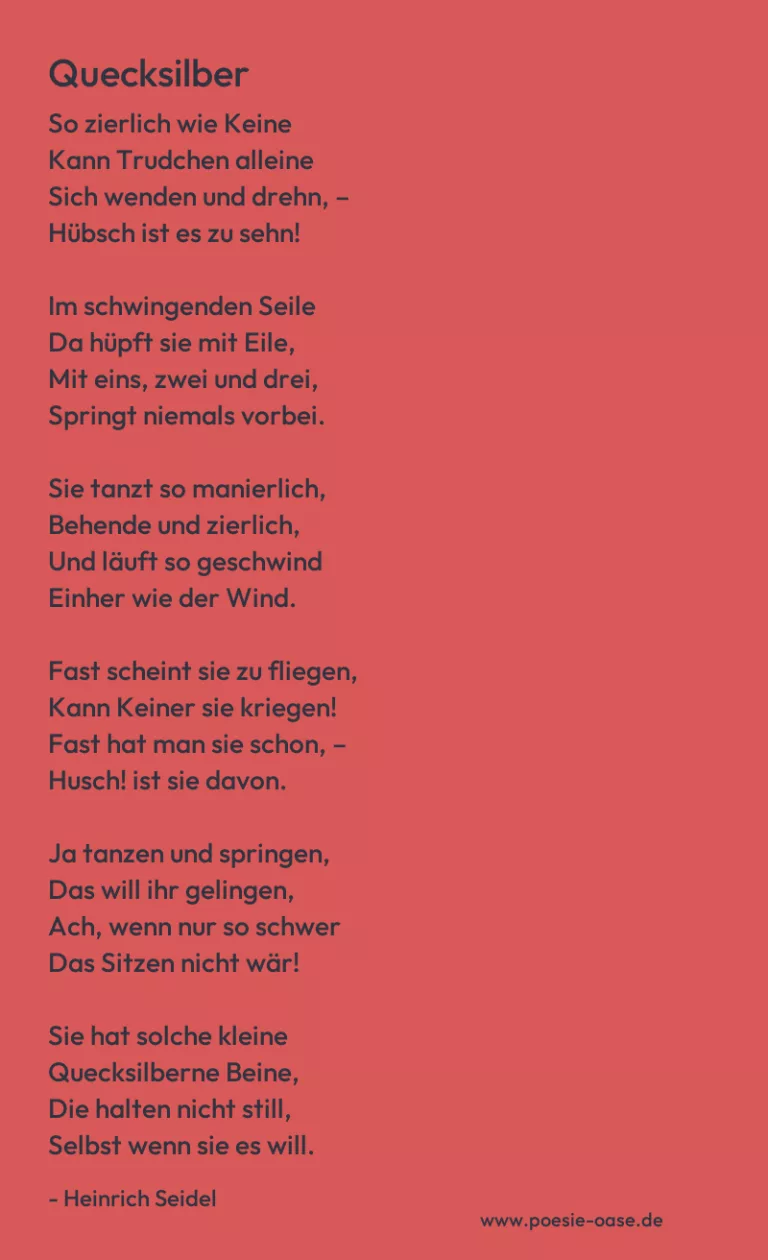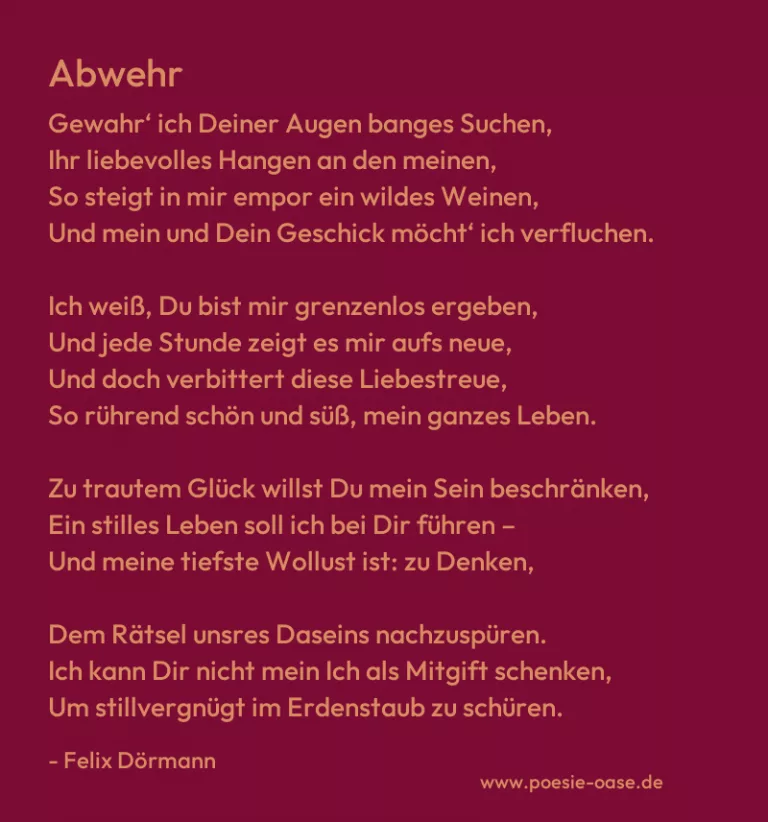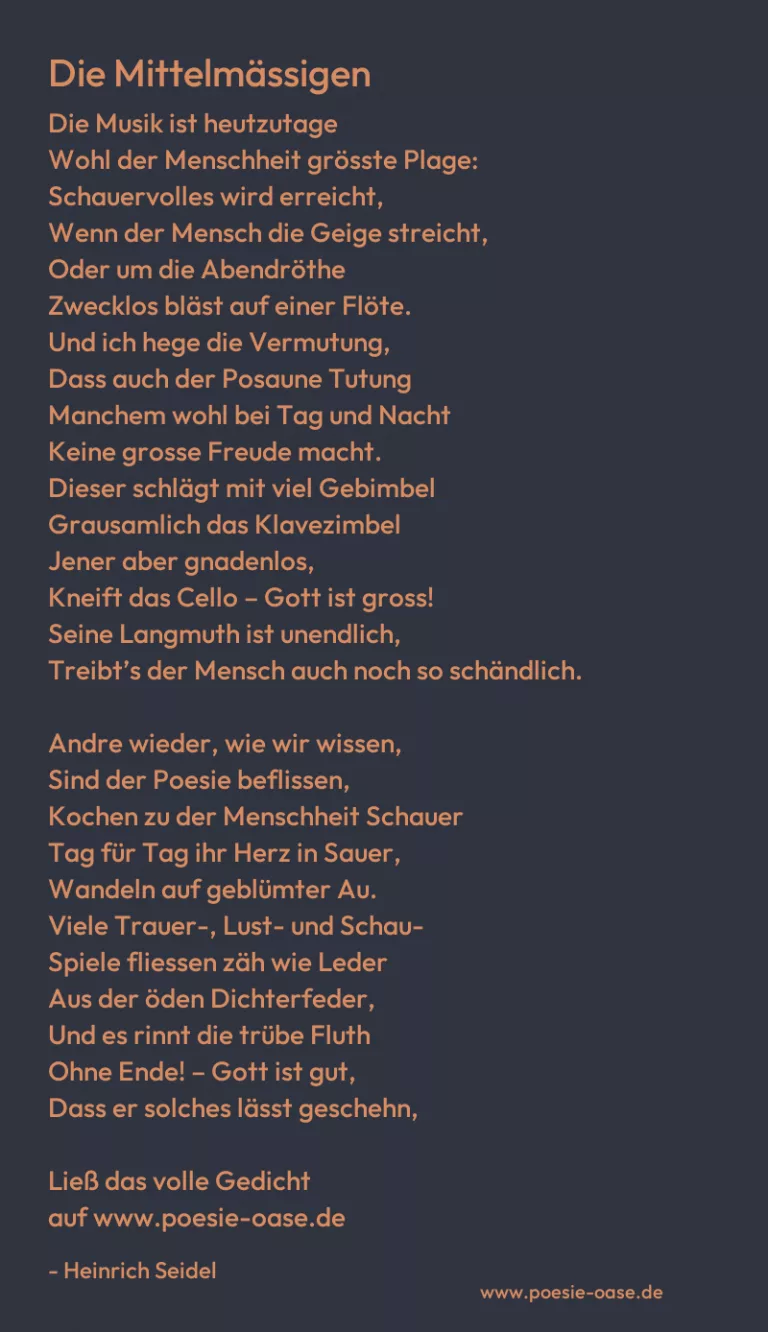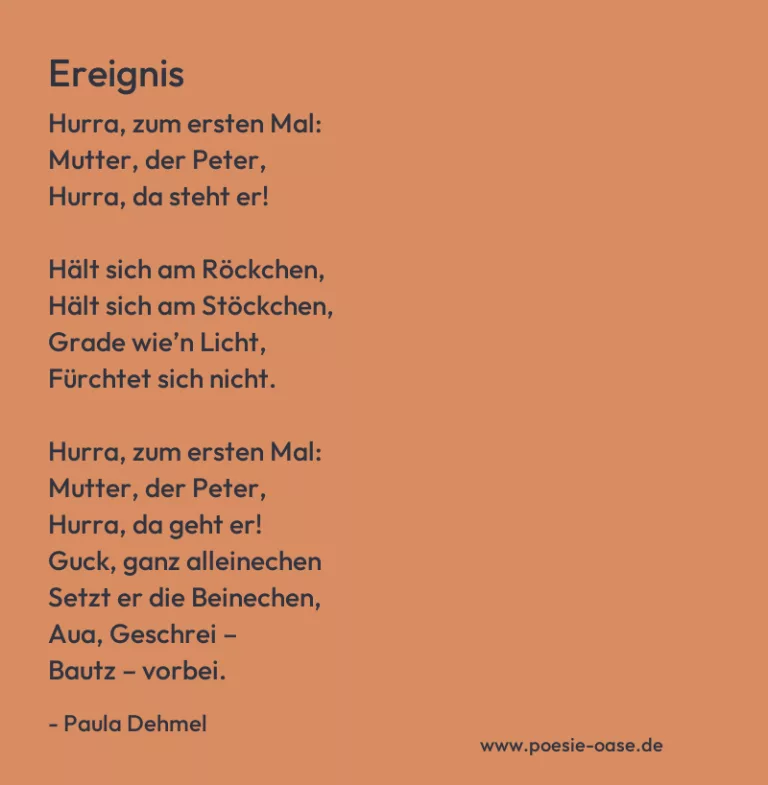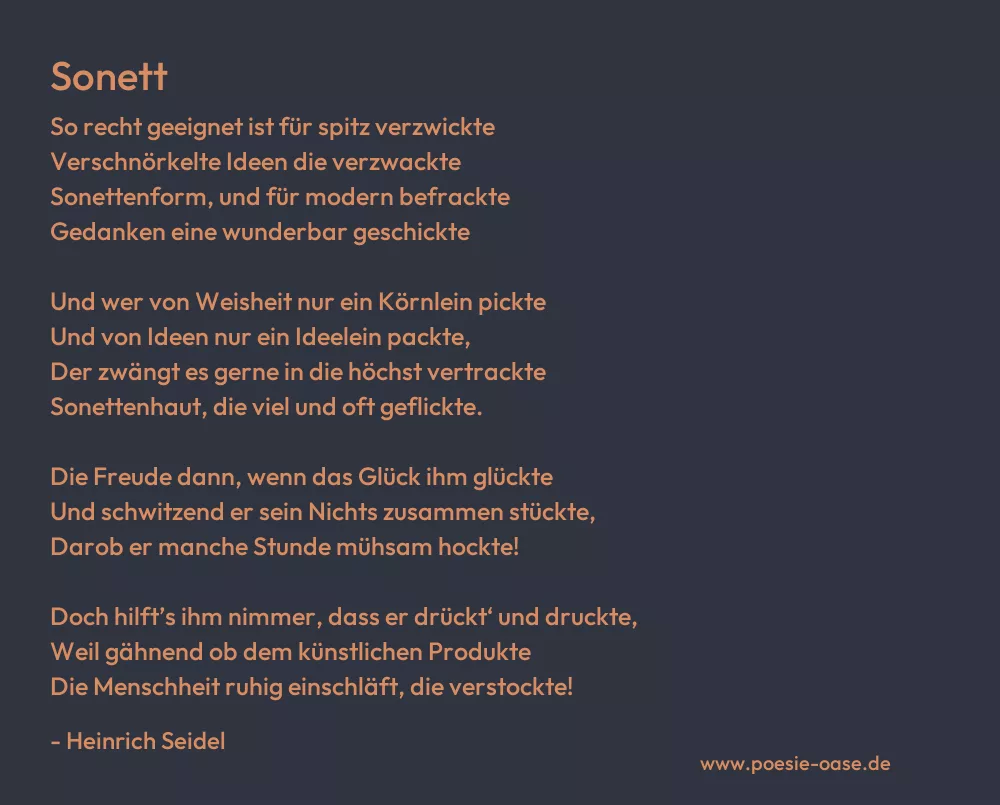Sonett
So recht geeignet ist für spitz verzwickte
Verschnörkelte Ideen die verzwackte
Sonettenform, und für modern befrackte
Gedanken eine wunderbar geschickte
Und wer von Weisheit nur ein Körnlein pickte
Und von Ideen nur ein Ideelein packte,
Der zwängt es gerne in die höchst vertrackte
Sonettenhaut, die viel und oft geflickte.
Die Freude dann, wenn das Glück ihm glückte
Und schwitzend er sein Nichts zusammen stückte,
Darob er manche Stunde mühsam hockte!
Doch hilft’s ihm nimmer, dass er drückt‘ und druckte,
Weil gähnend ob dem künstlichen Produkte
Die Menschheit ruhig einschläft, die verstockte!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
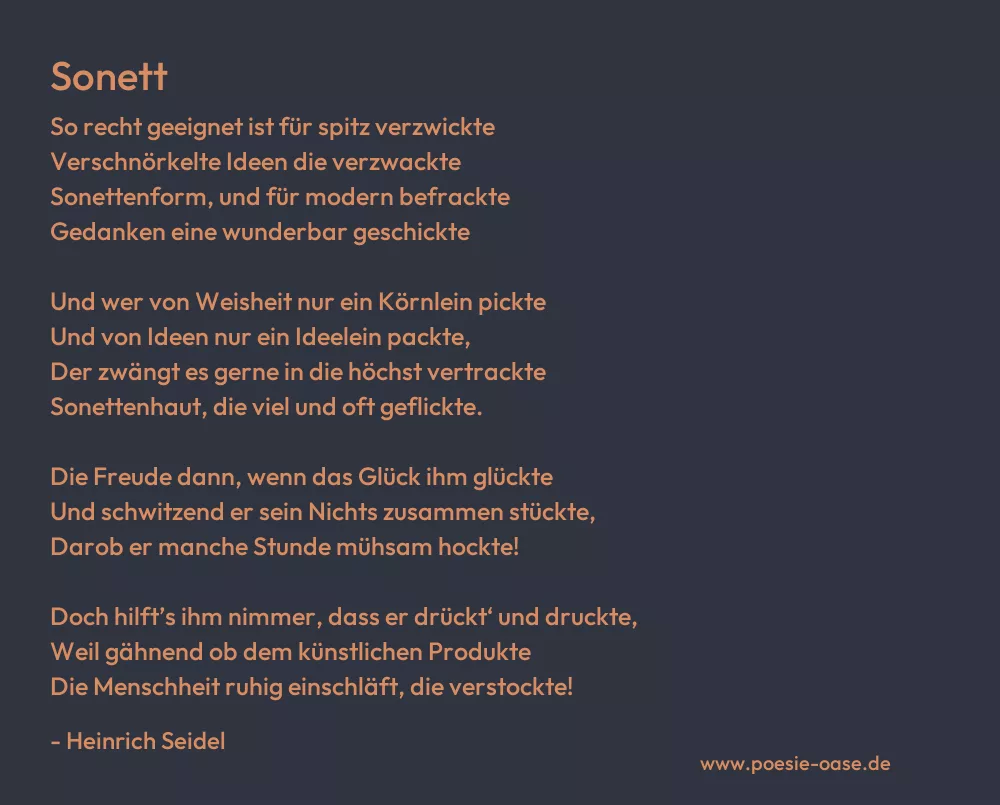
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sonett“ von Heinrich Seidel beschäftigt sich mit der Form des Sonetts selbst und setzt sich humorvoll und selbstreflexiv mit den Schwierigkeiten und der Bedeutung dieser poetischen Struktur auseinander. Es wird das Bild eines Dichters gezeichnet, der versucht, tiefgründige oder moderne Gedanken in die strenge und formale Struktur des Sonetts zu zwängen. Das Gedicht beginnt mit der Feststellung, dass die Sonettenform für „spitz verzwickte“ und „verschnörkelte Ideen“ geeignet sei – eine ironische Bemerkung, die auf die Komplexität und den scheinbaren Widerspruch der Form hinweist.
In der zweiten Strophe beschreibt der Sprecher den Dichter als jemanden, der „nur ein Körnlein“ Weisheit oder „ein Ideelein“ Idee hat, was den Eindruck eines kleinen, bescheidenen Gedankens vermittelt, der jedoch in das „hochvertrackte“ Sonett gezwängt wird. Diese Übertreibung betont die Schwierigkeit, in einer so rigiden Form etwas von echter Bedeutung zu schaffen, und stellt die Frage, ob es überhaupt möglich ist, tiefgründige Gedanken in eine solch enge Struktur zu pressen. Der Dichter ist wie ein Handwerker, der mit viel Mühe an seinem Werk arbeitet, ohne sicherzustellen, dass das Ergebnis von echter Relevanz ist.
Die dritte Strophe beschreibt die „Freude“ des Dichters, wenn er schließlich das „Nichts“ zusammenstückt, was auf das Gefühl der Selbstzufriedenheit hinweist, das der Dichter möglicherweise empfindet, wenn er sein Werk vollendet hat, auch wenn das Endprodukt nicht wirklich bedeutungsvoll oder tiefgründig ist. Das Bild des Dichters, der „schwitzend“ und „mühselig“ an seiner Arbeit sitzt, verstärkt das Gefühl des Aufwands und der Anstrengung, der in einer Form wie dem Sonett steckt.
Die letzte Strophe bringt schließlich das ernüchternde Ergebnis der Mühe des Dichters: Trotz aller Anstrengungen bleibt das Werk unbemerkt und uninteressant für die Menschheit. Die „Menschheit“ schläft „ruhig ein“ und ist „verstockt“ – eine Metapher für das Desinteresse der Welt an formalen und kunstvollen, aber möglicherweise leeren Gedichten. Es ist eine spöttische, humorvolle Bemerkung über die Wirkungslosigkeit von Kunst, die nicht authentisch oder relevant ist. Seidel stellt hier die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, sich in solch einer strengen Form abzuarbeiten, wenn die wahre Wirkung ausbleibt.
Das Gedicht „Sonett“ ist also sowohl eine humorvolle Auseinandersetzung mit der traditionellen Sonettenform als auch eine kritische Reflexion über die Relevanz und Wirkung von Poesie. Seidel nutzt die Struktur des Sonetts, um die Form selbst zu hinterfragen und den Aufwand, der in den Versuch gesteckt wird, formale Anforderungen zu erfüllen, als leer und unbefriedigend darzustellen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.