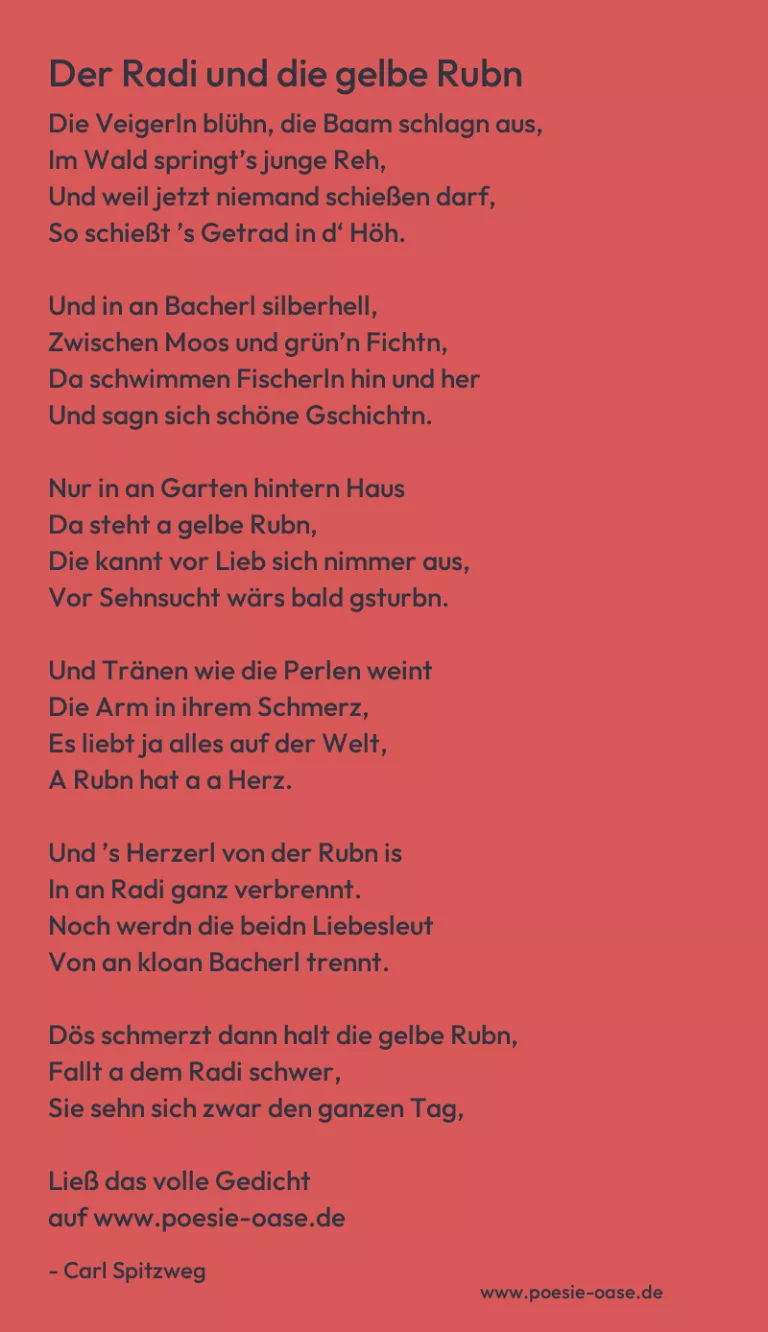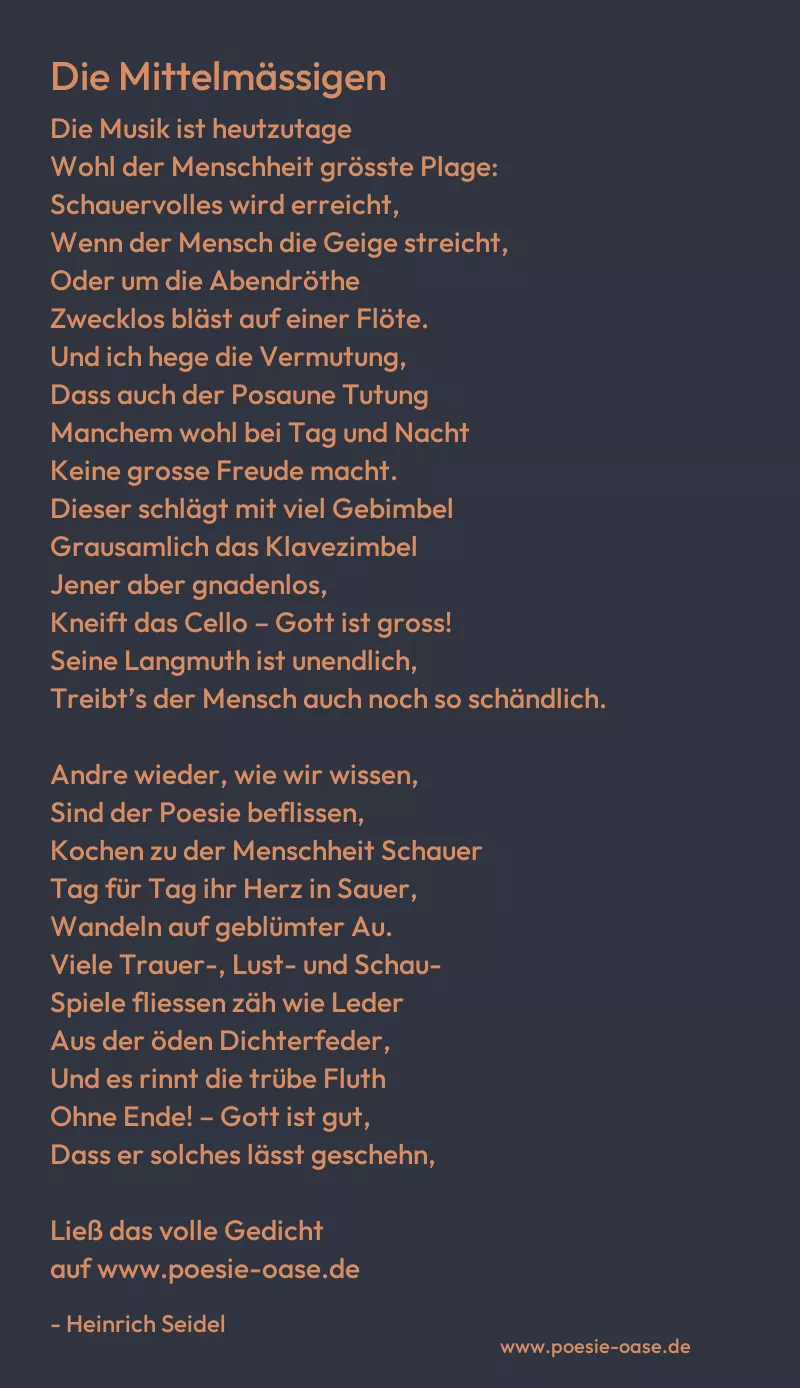Die Musik ist heutzutage
Wohl der Menschheit grösste Plage:
Schauervolles wird erreicht,
Wenn der Mensch die Geige streicht,
Oder um die Abendröthe
Zwecklos bläst auf einer Flöte.
Und ich hege die Vermutung,
Dass auch der Posaune Tutung
Manchem wohl bei Tag und Nacht
Keine grosse Freude macht.
Dieser schlägt mit viel Gebimbel
Grausamlich das Klavezimbel
Jener aber gnadenlos,
Kneift das Cello – Gott ist gross!
Seine Langmuth ist unendlich,
Treibt’s der Mensch auch noch so schändlich.
Andre wieder, wie wir wissen,
Sind der Poesie beflissen,
Kochen zu der Menschheit Schauer
Tag für Tag ihr Herz in Sauer,
Wandeln auf geblümter Au.
Viele Trauer-, Lust- und Schau-
Spiele fliessen zäh wie Leder
Aus der öden Dichterfeder,
Und es rinnt die trübe Fluth
Ohne Ende! – Gott ist gut,
Dass er solches lässt geschehn,
Ohne ins Gericht zu gehn!
Andre, zu der Menschheit Qualen,
Legen wieder sich aufs Malen
Und beschmieren ohne Ende
Viele schöne Leinewände
Und viel herrliches Papier,
Zum Erbarmen ist es schier! –
Wär‘ mit Rosen und Kamillen
Ihre Schmierwuth nur zu stillen
Nein, sie wagen frech und wild
Sich an Gottes Ebenbild,
Und sie pinseln und sie kratzen
Süsslich, wabblich ihre Fratzen,
Dass die liebe Sonne weint,
Wenn sie solchen Schund bescheint.
Und so reiht sich Bild zu Bilde
Unermesslich! – Gott ist milde,
Denn er warf noch nie mit Feuer
Unter solche Ungeheuer!
Doch, wenn mal ein grosser Geist
Sich empor zum Himmel reisst
Und vom ew’gen Born der Klarheit
Nieder bringt das Licht der Wahrheit,
Muss man sehen diese Ekel,
Diese krummgebeinten Teckel
Wie sie ihn herunter reissen
Und ihn in die Waden beissen,
Denn sie schätzen jeder Frist
Nur, was ihres Gleichen ist!