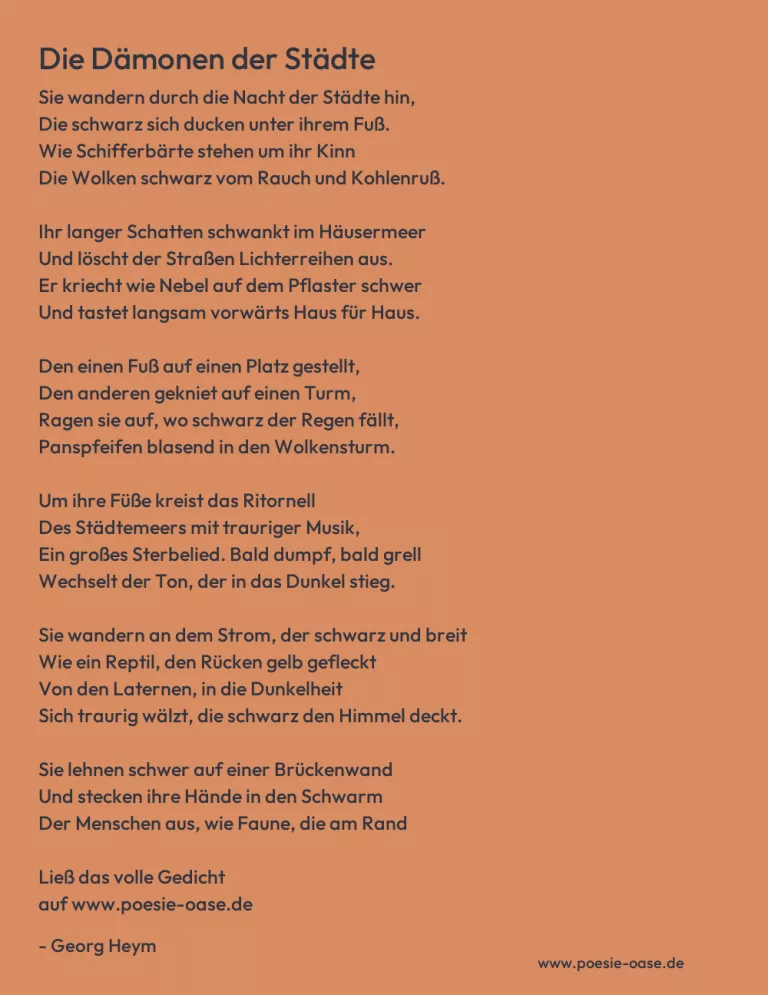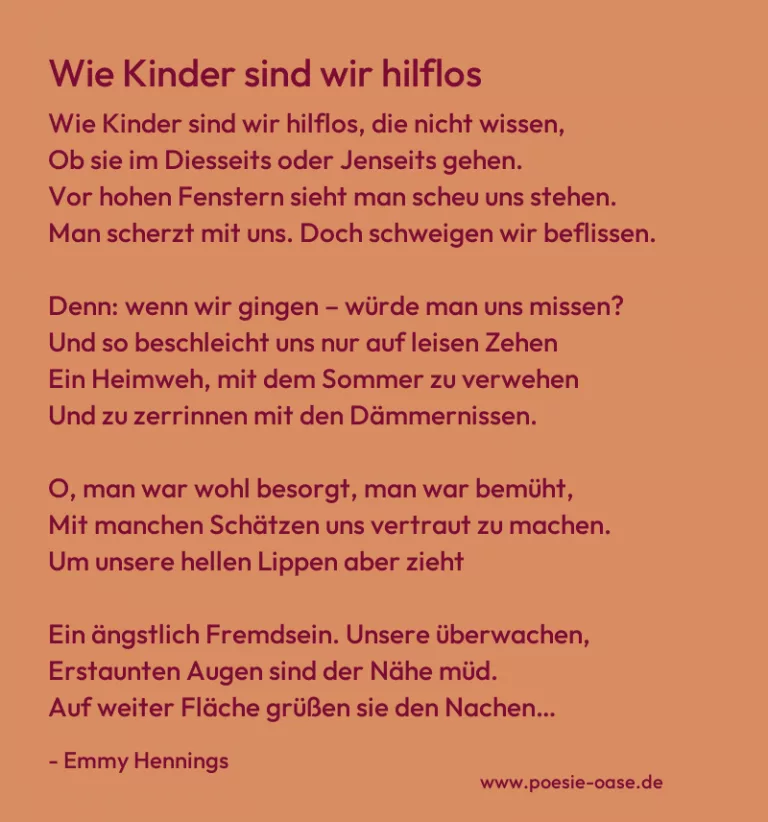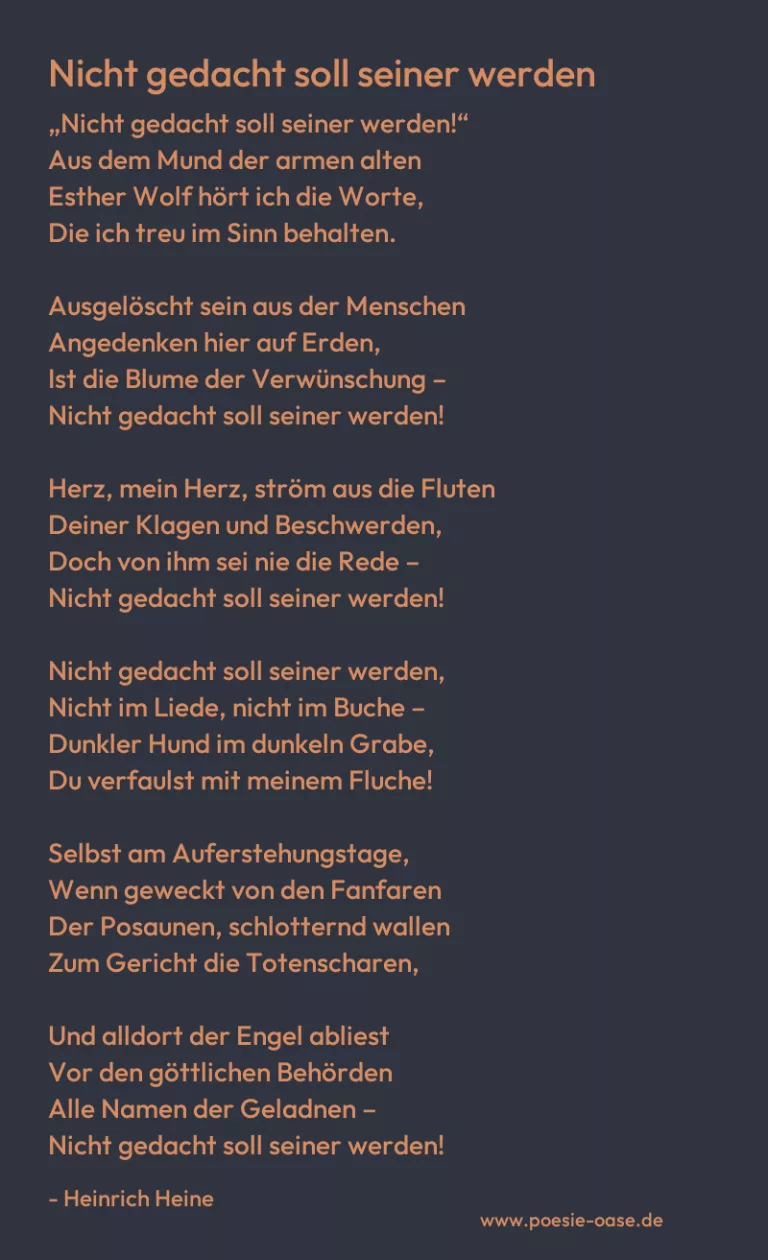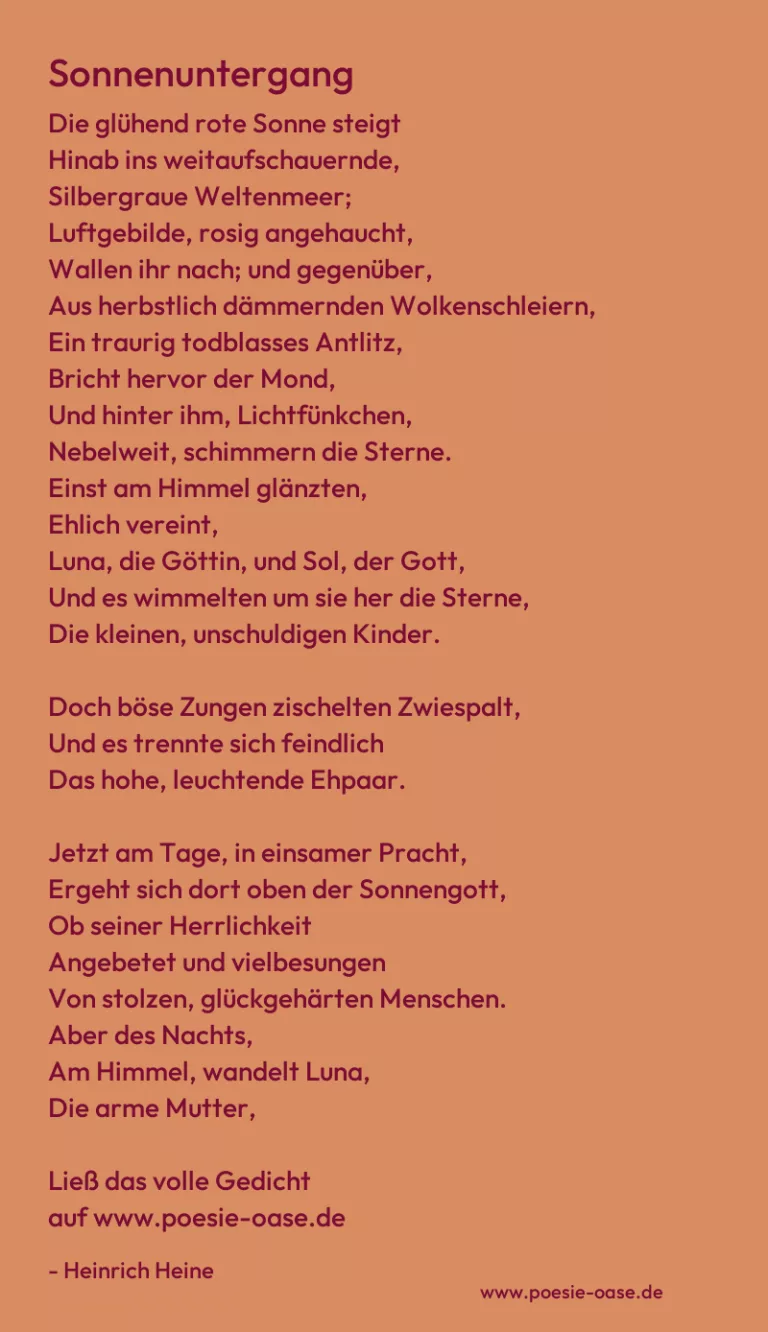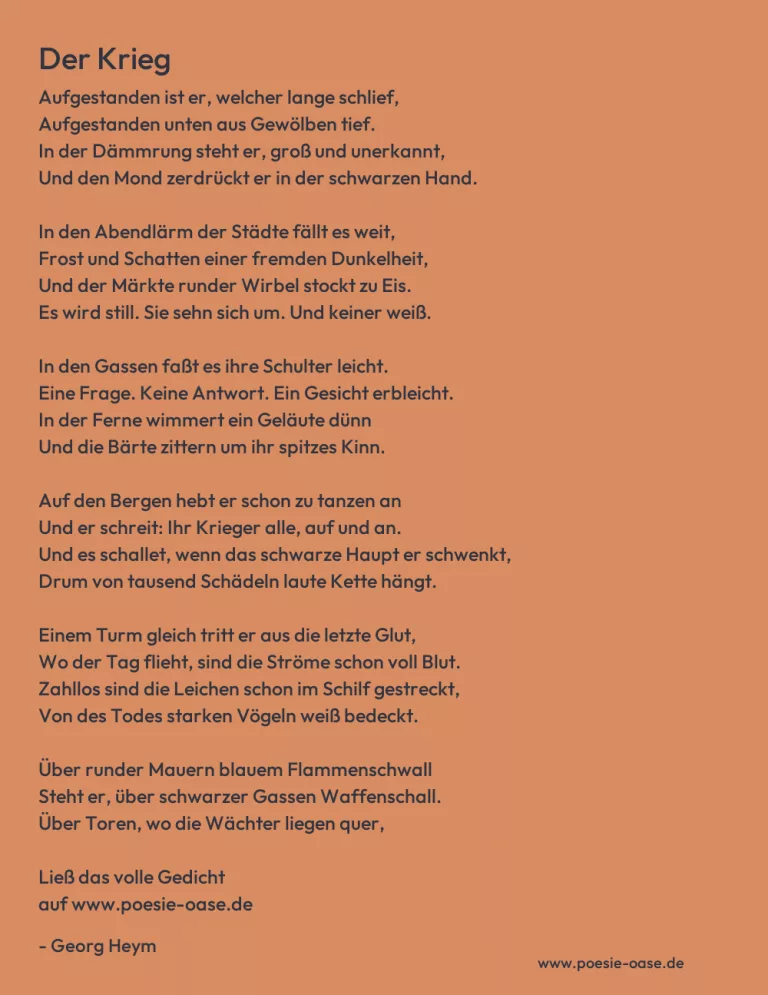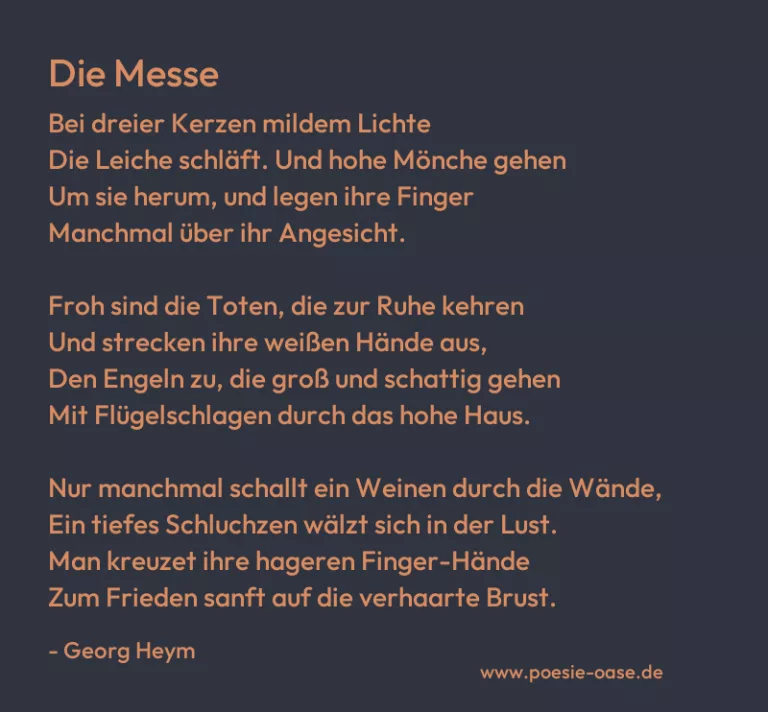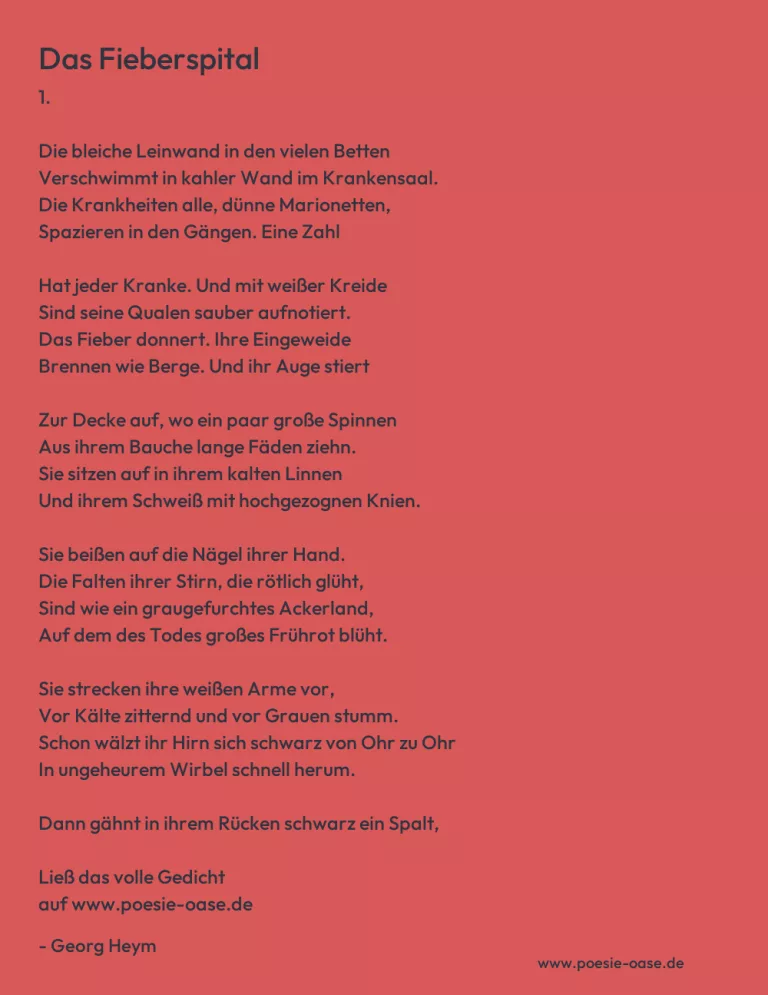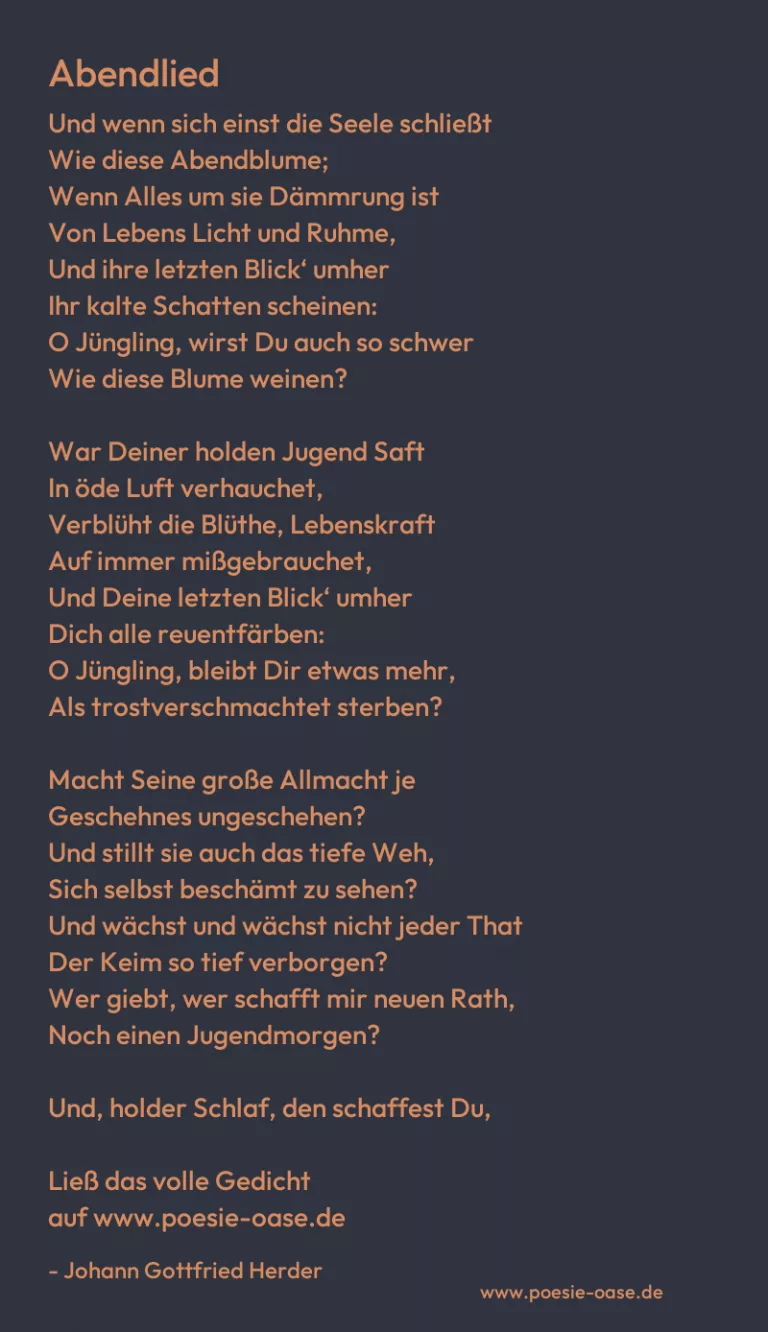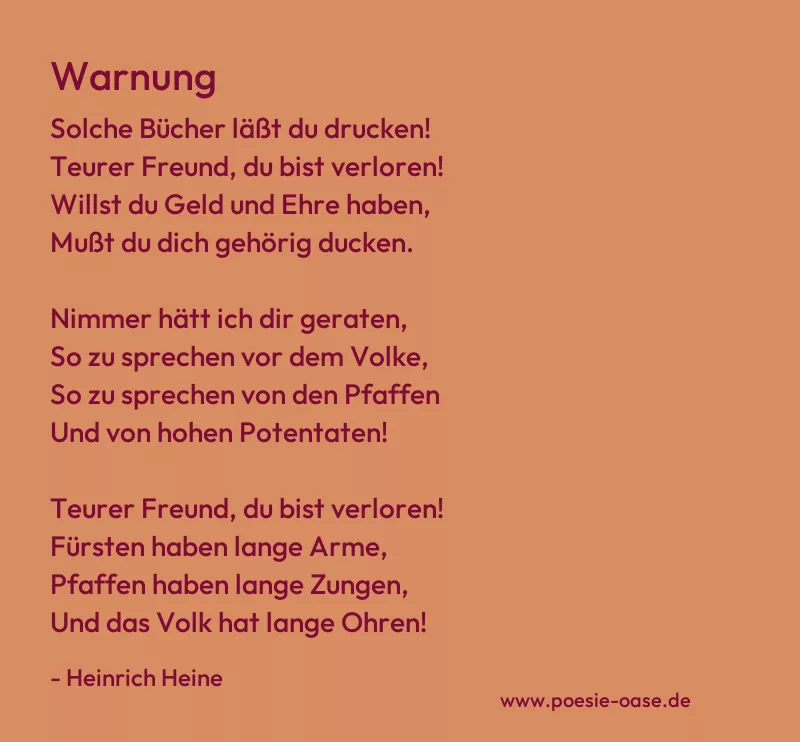Warnung
Solche Bücher läßt du drucken!
Teurer Freund, du bist verloren!
Willst du Geld und Ehre haben,
Mußt du dich gehörig ducken.
Nimmer hätt ich dir geraten,
So zu sprechen vor dem Volke,
So zu sprechen von den Pfaffen
Und von hohen Potentaten!
Teurer Freund, du bist verloren!
Fürsten haben lange Arme,
Pfaffen haben lange Zungen,
Und das Volk hat lange Ohren!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
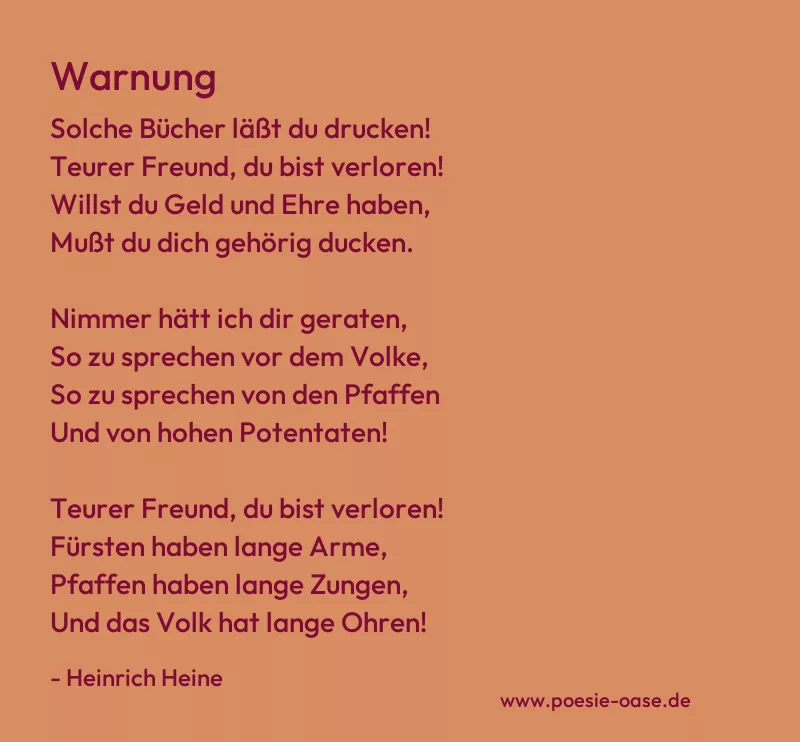
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Warnung“ von Heinrich Heine thematisiert auf satirisch-ironische Weise die Gefahr, die mit freier Meinungsäußerung und Kritik an gesellschaftlichen und politischen Autoritäten verbunden ist. Das lyrische Ich spricht einen „teuren Freund“ an, der durch das Veröffentlichen kritischer Bücher sein Ansehen und seine Sicherheit riskiert. Bereits in der ersten Strophe wird angedeutet, dass Anpassung („ducken“) notwendig sei, um „Geld und Ehre“ zu erlangen – eine Kritik an Opportunismus und der Unterdrückung freier Gedanken.
In der zweiten Strophe wird deutlich, worauf sich die Warnung bezieht: Der Freund habe es gewagt, offen vor dem Volk über „Pfaffen“ (eine abwertende Bezeichnung für Kleriker) und „hohe Potentaten“ (Mächtige, Herrscher) zu sprechen. Damit spielt Heine auf die Machtstrukturen von Kirche und Staat an, die gegen kritische Stimmen repressiv vorgehen. Das Gedicht verweist hier auf die Zensur und Verfolgung von Intellektuellen, die im 19. Jahrhundert gängige Praxis war – auch Heine selbst war davon betroffen.
Die letzte Strophe fasst die Gefahr nochmals zugespitzt zusammen: „Fürsten haben lange Arme“ steht für die weitreichende Macht der Herrschenden, „Pfaffen haben lange Zungen“ für ihre Einflussnahme auf Meinungen und Moral, und „das Volk hat lange Ohren“ für die Empfänglichkeit und Neugier der breiten Masse, die schnell zum Mitwisser oder Denunzianten werden kann. Diese Bilder betonen die Bedrohung durch verschiedene gesellschaftliche Kräfte.
Heines „Warnung“ ist eine bitter-ironische Mahnung vor den Konsequenzen kritischen Denkens in einer autoritären Gesellschaft. Gleichzeitig entlarvt das Gedicht die Mechanismen der Unterdrückung und die Anpassungsbereitschaft, die von vielen erwartet wird. Trotz des spielerischen Tons schwingt eine ernste Kritik an der fehlenden Redefreiheit und der Macht der Herrschenden mit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.