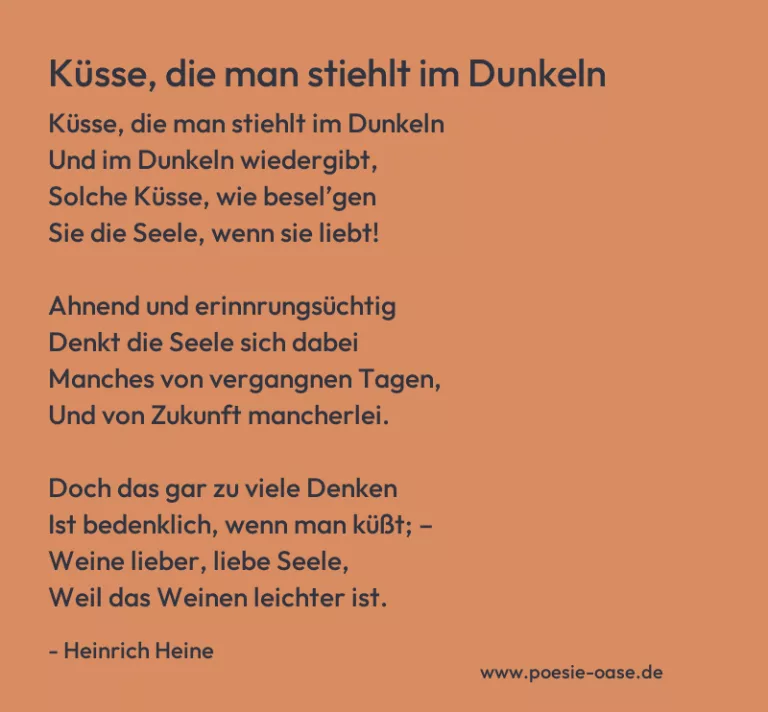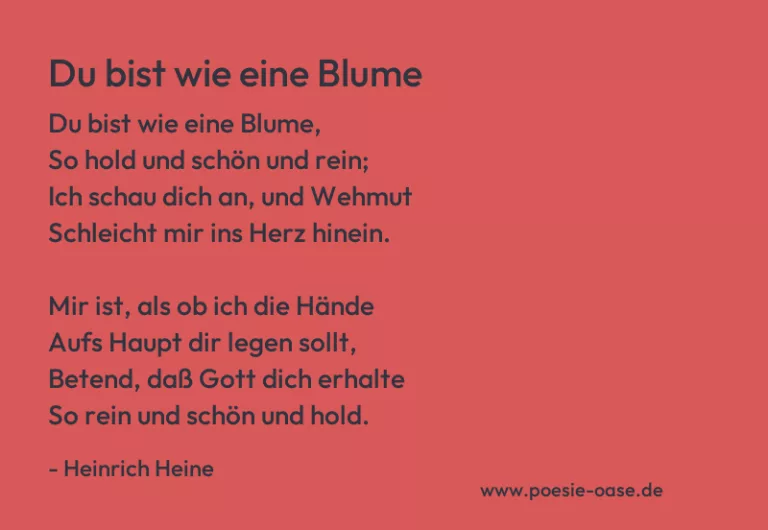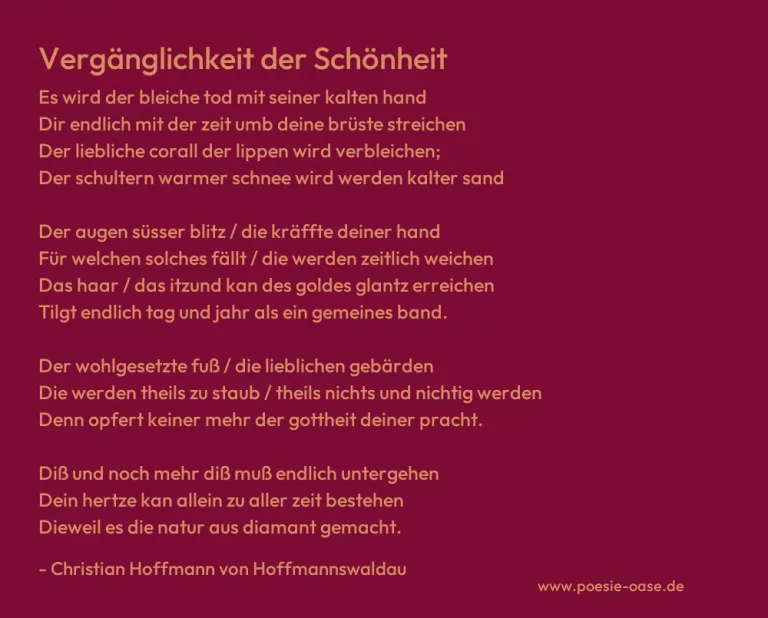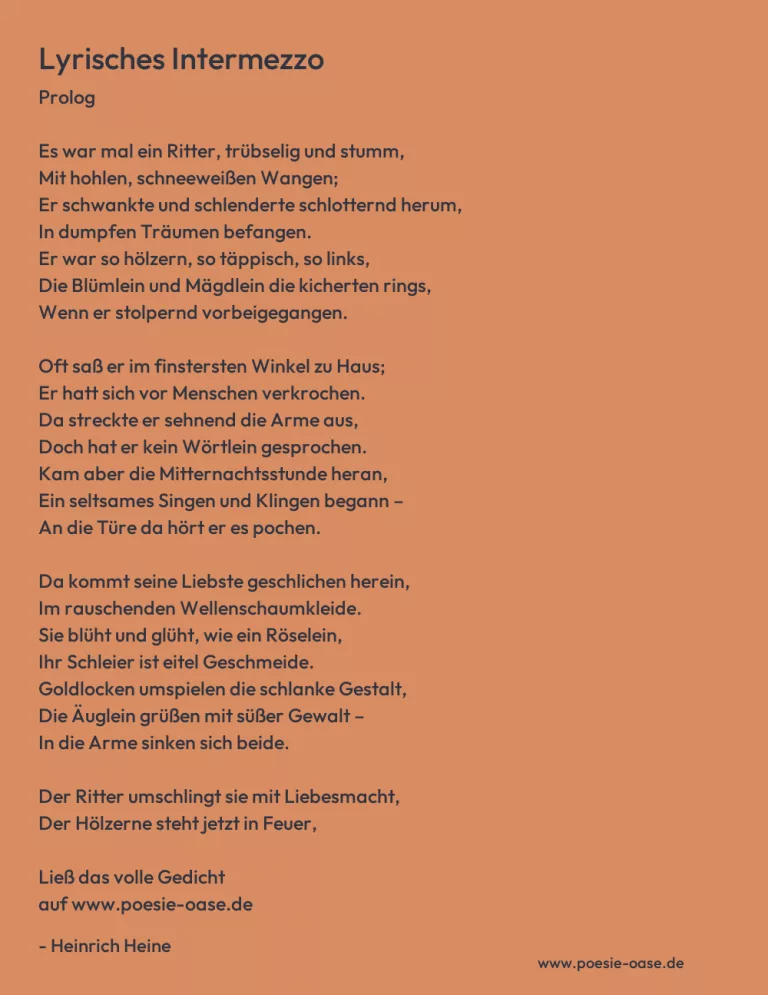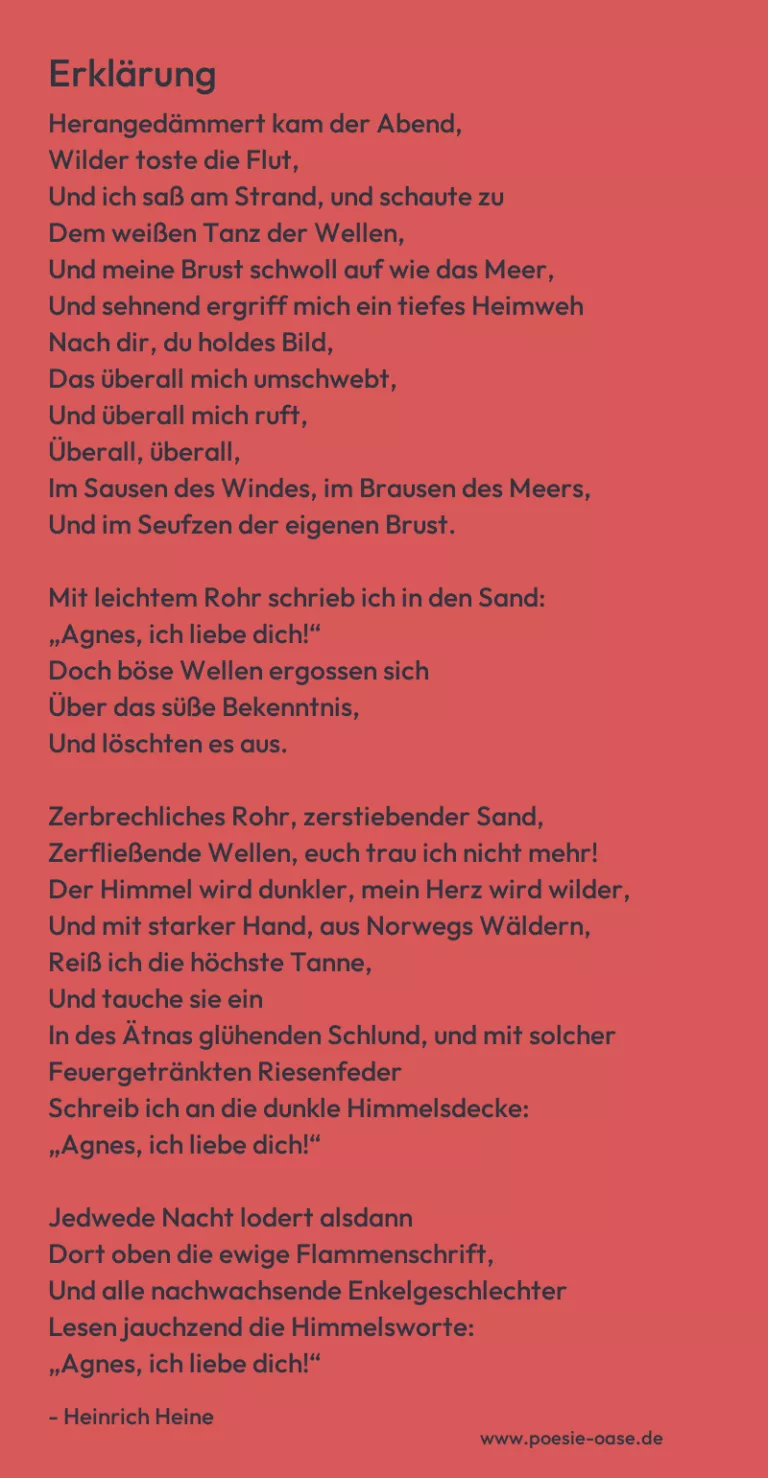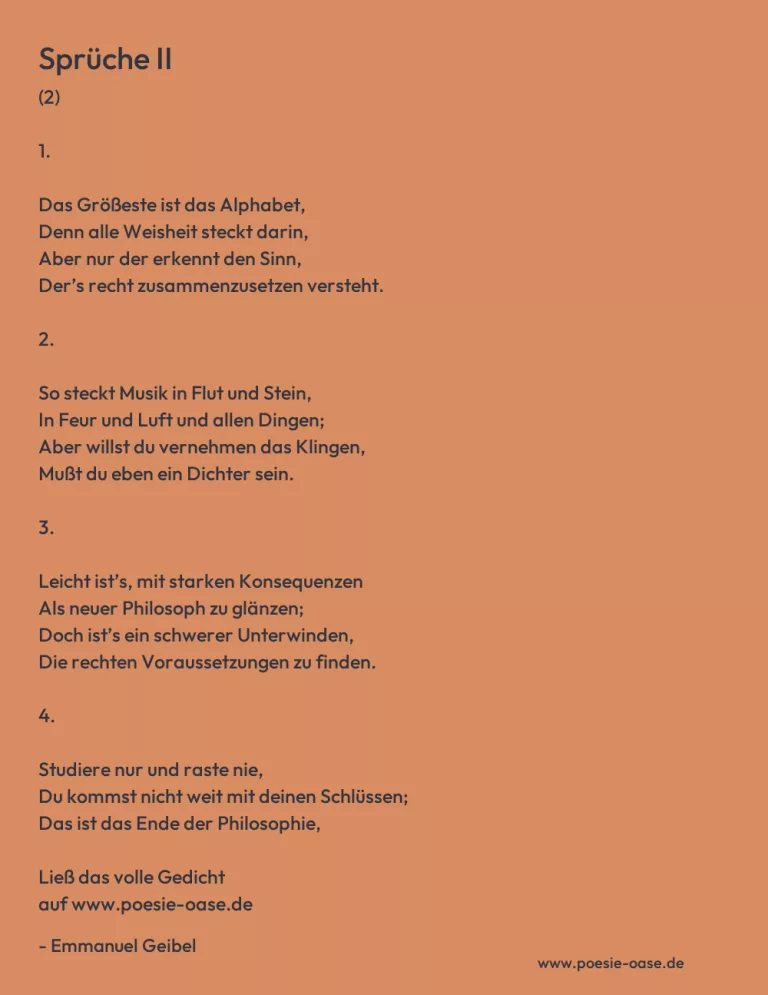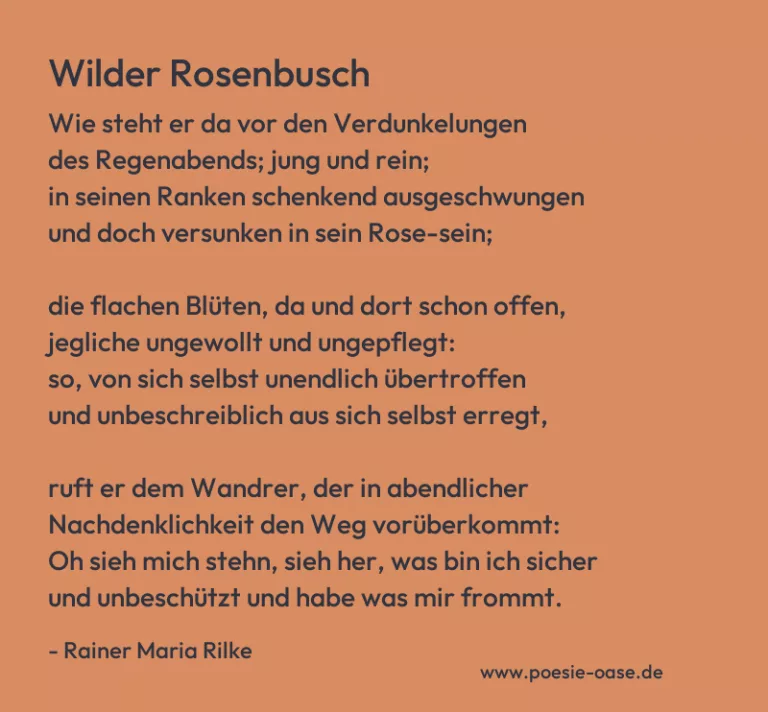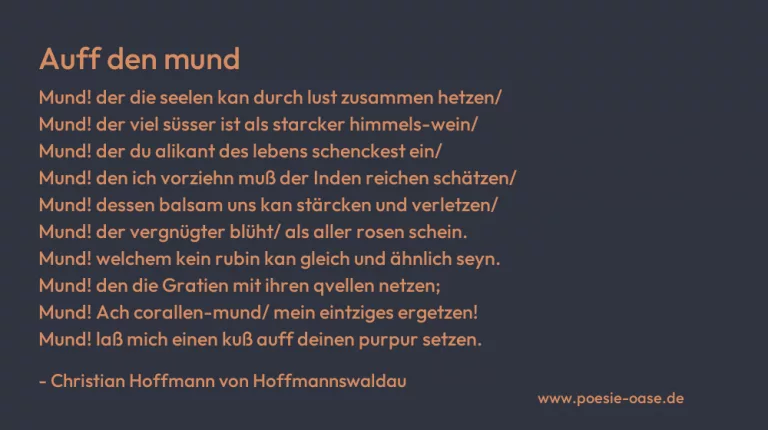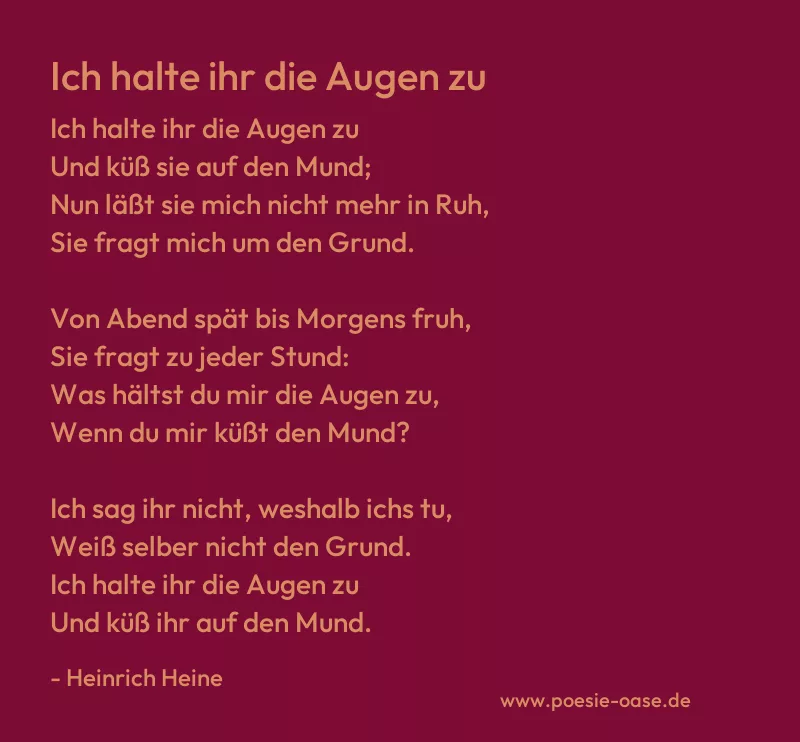Ich halte ihr die Augen zu
Ich halte ihr die Augen zu
Und küß sie auf den Mund;
Nun läßt sie mich nicht mehr in Ruh,
Sie fragt mich um den Grund.
Von Abend spät bis Morgens fruh,
Sie fragt zu jeder Stund:
Was hältst du mir die Augen zu,
Wenn du mir küßt den Mund?
Ich sag ihr nicht, weshalb ichs tu,
Weiß selber nicht den Grund.
Ich halte ihr die Augen zu
Und küß ihr auf den Mund.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
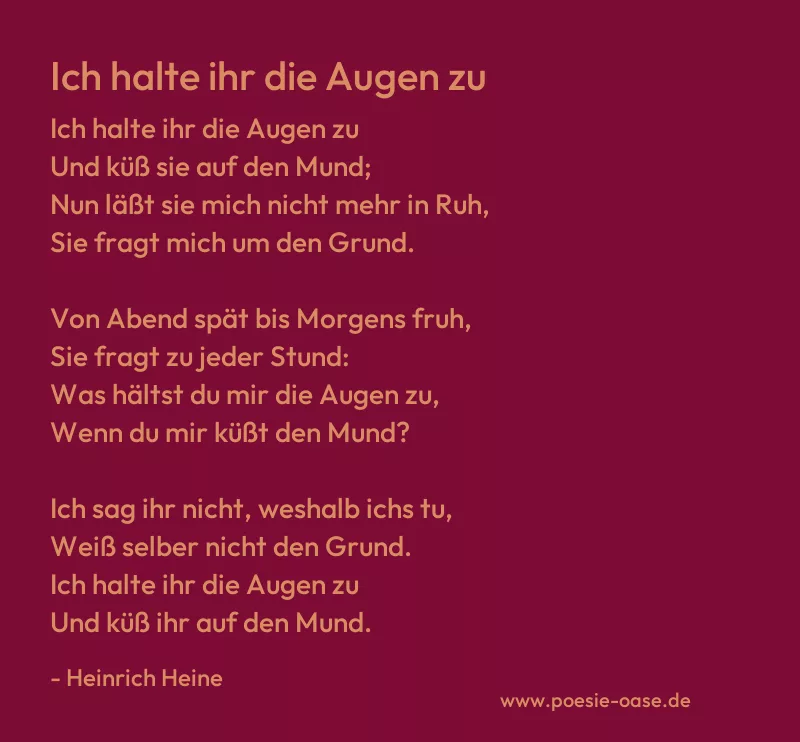
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich halte ihr die Augen zu“ von Heinrich Heine ist ein spielerisches, zugleich rätselhaftes Liebesgedicht, das in wenigen Strophen eine zarte, intime Szene zwischen zwei Liebenden beschreibt. Im Mittelpunkt steht eine einfache, wiederkehrende Geste: Der Sprecher bedeckt ihrer Geliebten die Augen und küsst sie auf den Mund. Diese Handlung wirkt zunächst sinnlich und verspielt, doch die wiederholte Frage nach dem „Warum“ verleiht ihr eine tiefere Bedeutungsebene.
Die Geliebte ist irritiert und neugierig: Sie sucht nach dem Motiv hinter dem Verhalten des lyrischen Ichs und lässt ihm, wie er sagt, „keine Ruh“. Doch der Sprecher verweigert ihr eine Erklärung – nicht aus Bosheit, sondern, wie er sagt, weil er selbst den Grund nicht kennt. Diese Ahnungslosigkeit kann als Ausdruck emotionaler Spontaneität verstanden werden: Das Verhalten entspringt keinem bewussten Kalkül, sondern einem unwillkürlichen Impuls der Nähe und Zärtlichkeit.
Gleichzeitig liegt im Motiv des Augenbedeckens eine symbolische Bedeutung. Indem der Sprecher ihr die Augen zuhält, nimmt er ihr die Möglichkeit des Sehens – vielleicht, um in diesem Moment Kontrolle, Geheimnis oder auch reine Empfindung über das Sehen zu stellen. Es könnte der Wunsch sein, das Körperliche vom Blick zu lösen, das Gefühl von der Reflexion zu trennen – oder auch eine spielerische Form des Vertrauens, bei der die Geliebte sich dem Moment hingibt, ohne zu wissen, was kommt.
Die Schlichtheit der Sprache, die wiederholten Verse und der fast kreisförmige Aufbau verleihen dem Gedicht eine ruhige, fast meditative Form. Inhaltlich oszilliert es zwischen Leichtigkeit und leiser Tiefe – zwischen kindlichem Spiel, erotischer Nähe und der unaussprechlichen Natur von Gefühlen. Heine zeigt hier in typischer Manier, wie aus einer kleinen Szene eine poetische Spannung entsteht, in der Liebe, Rätsel und Schweigen eng verwoben sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.