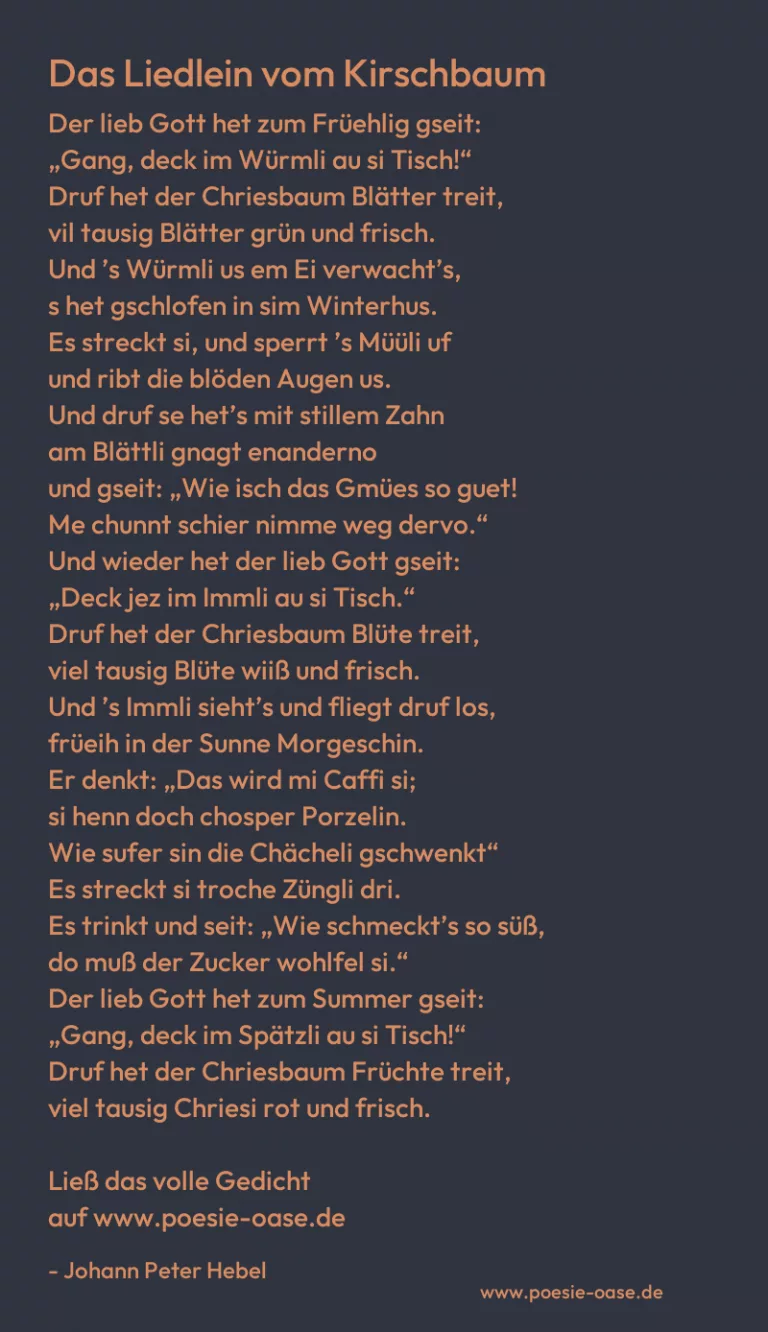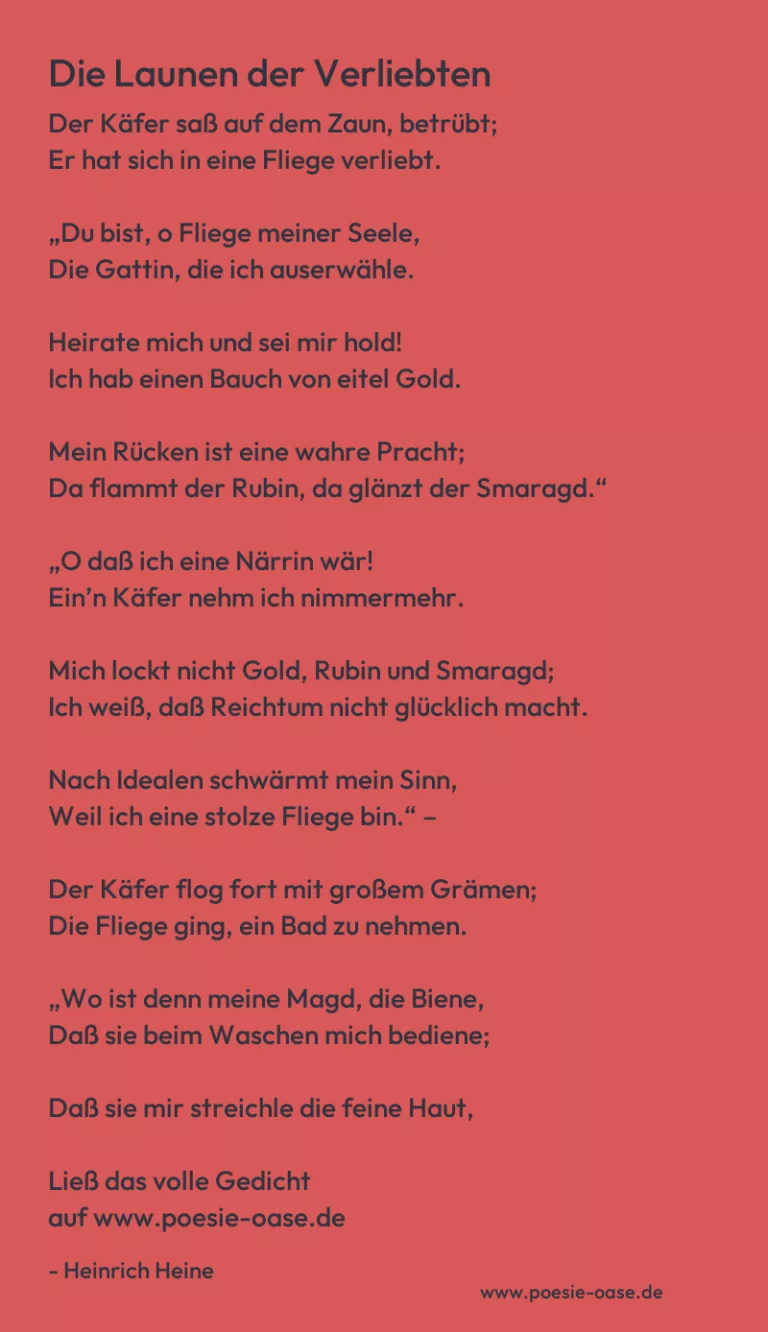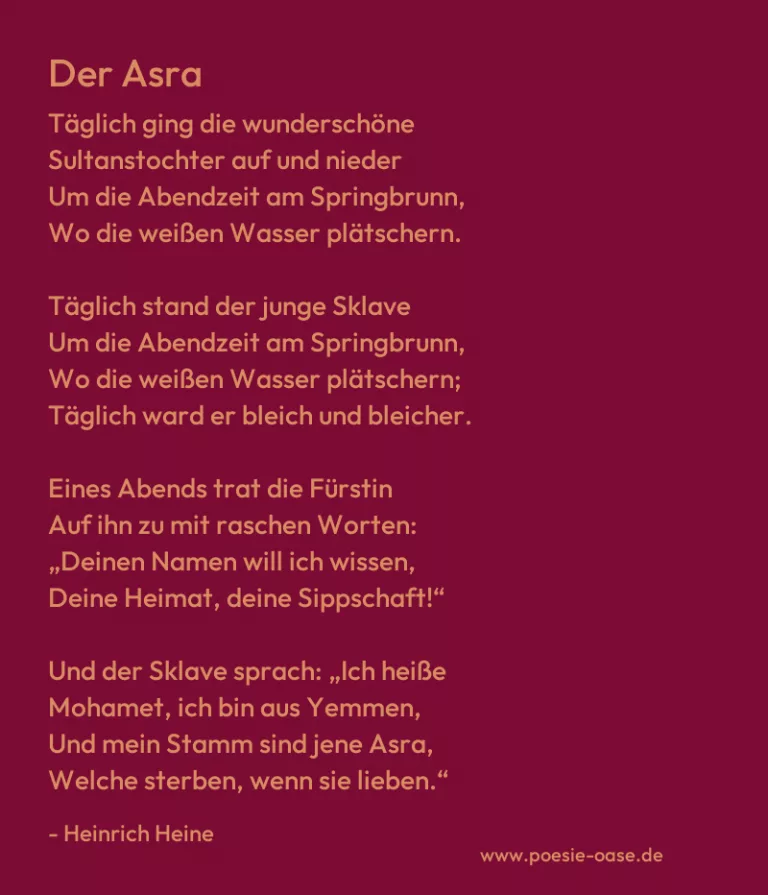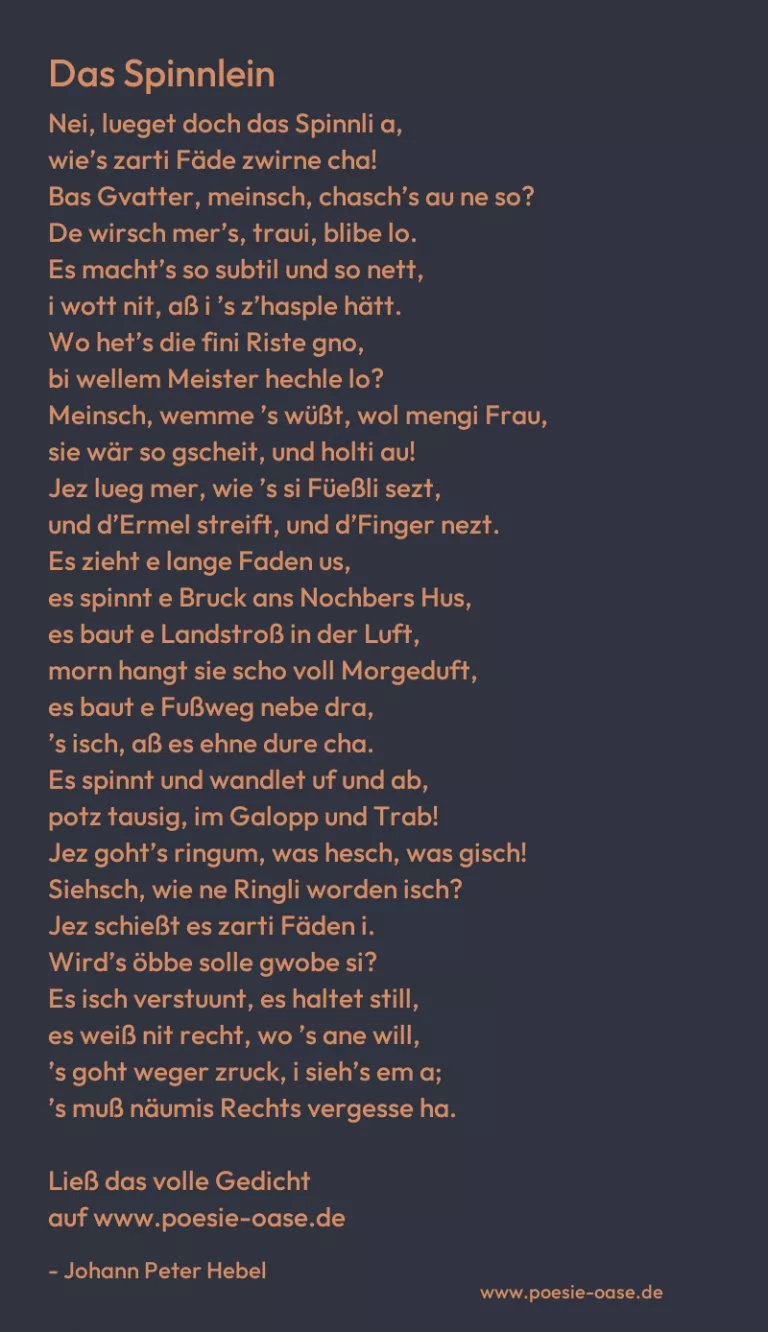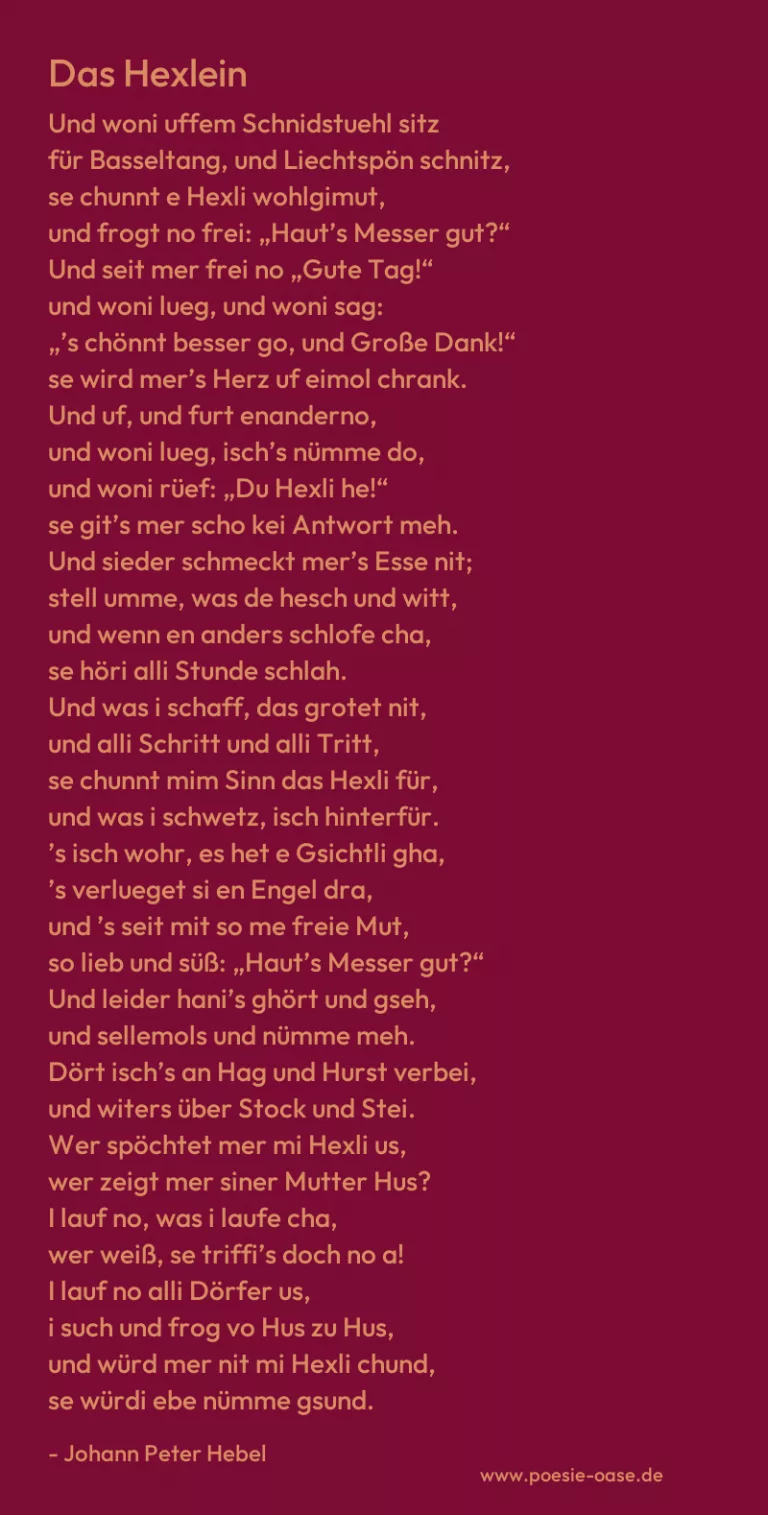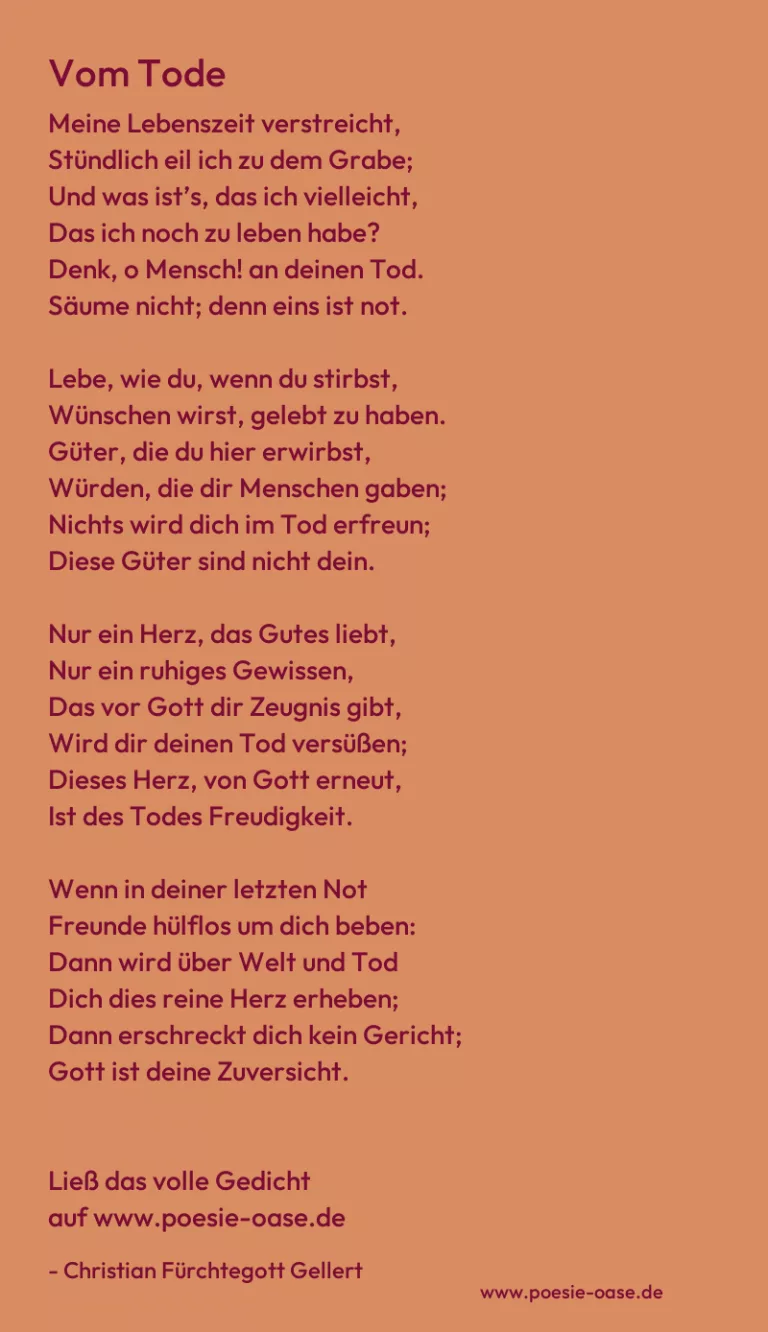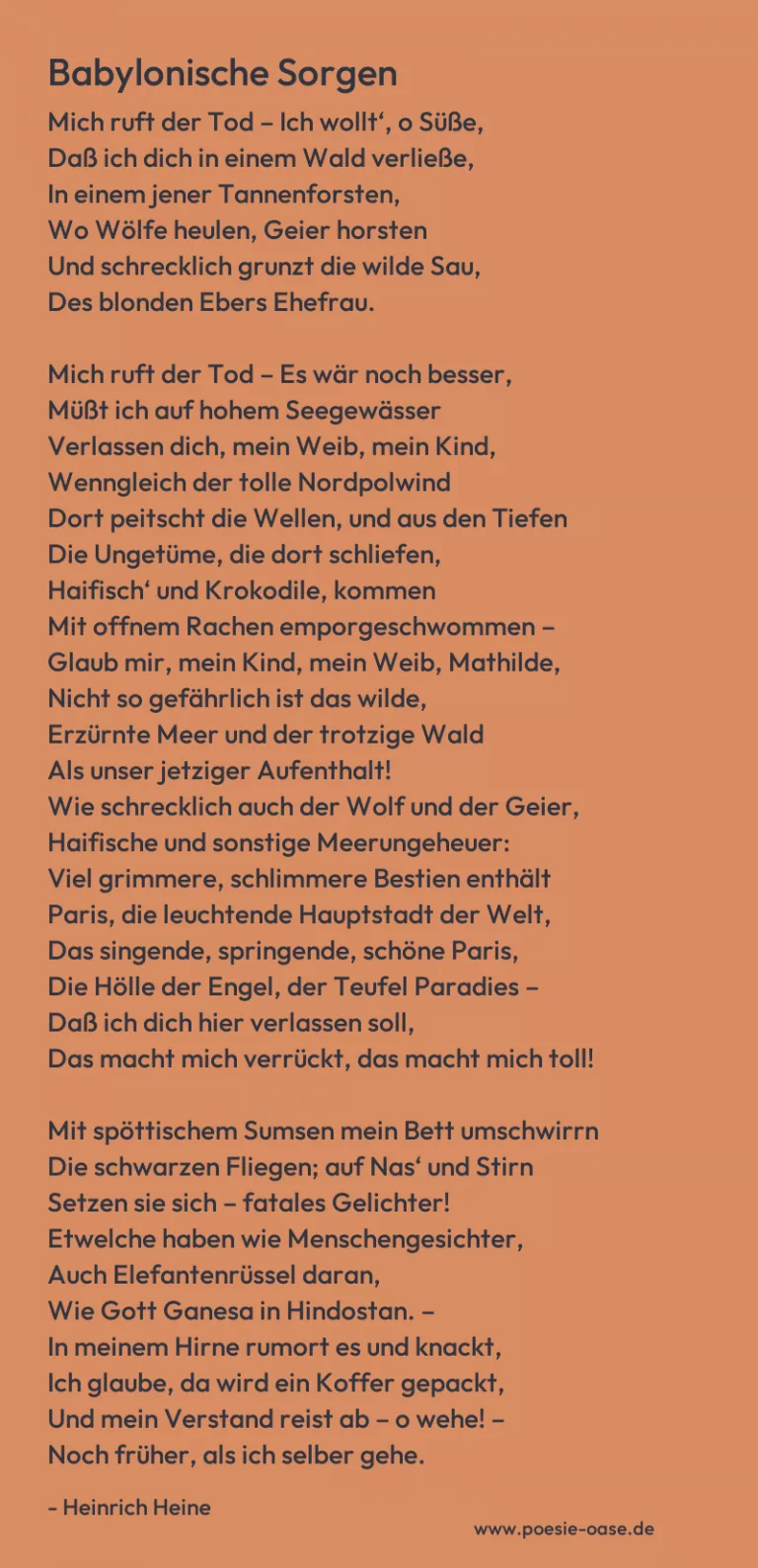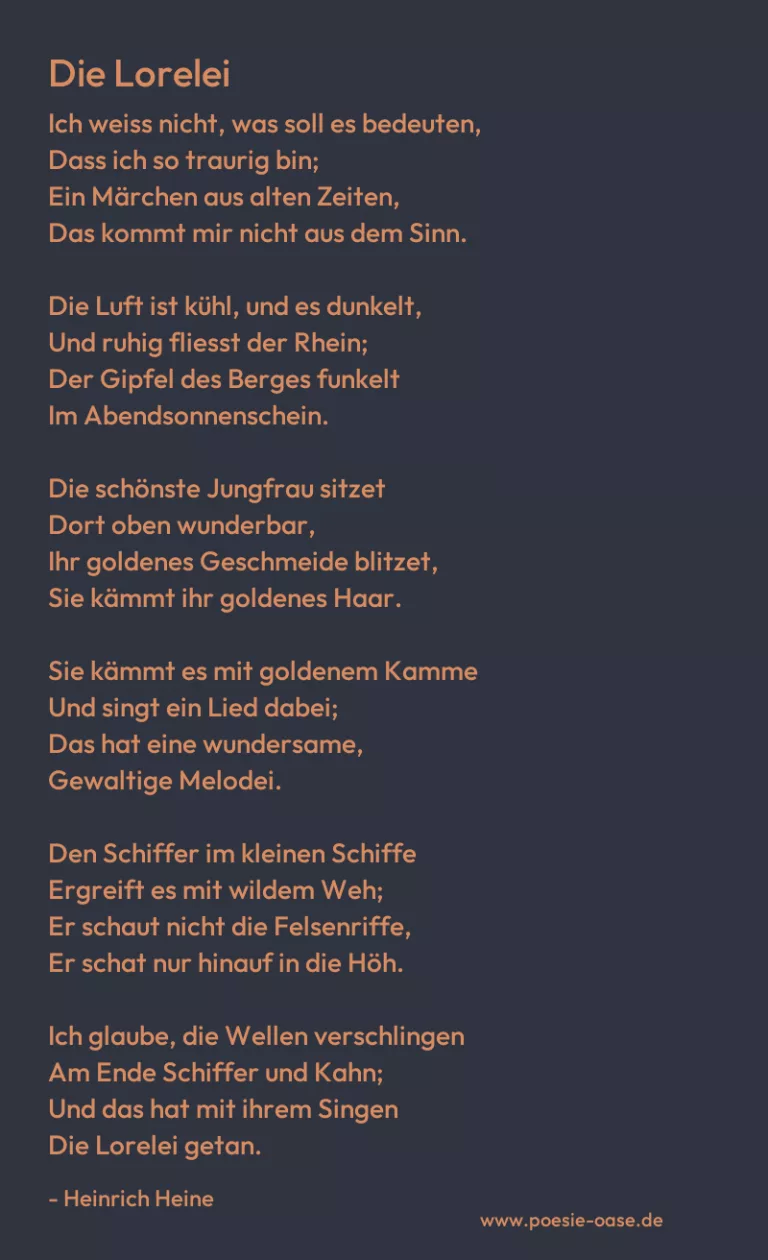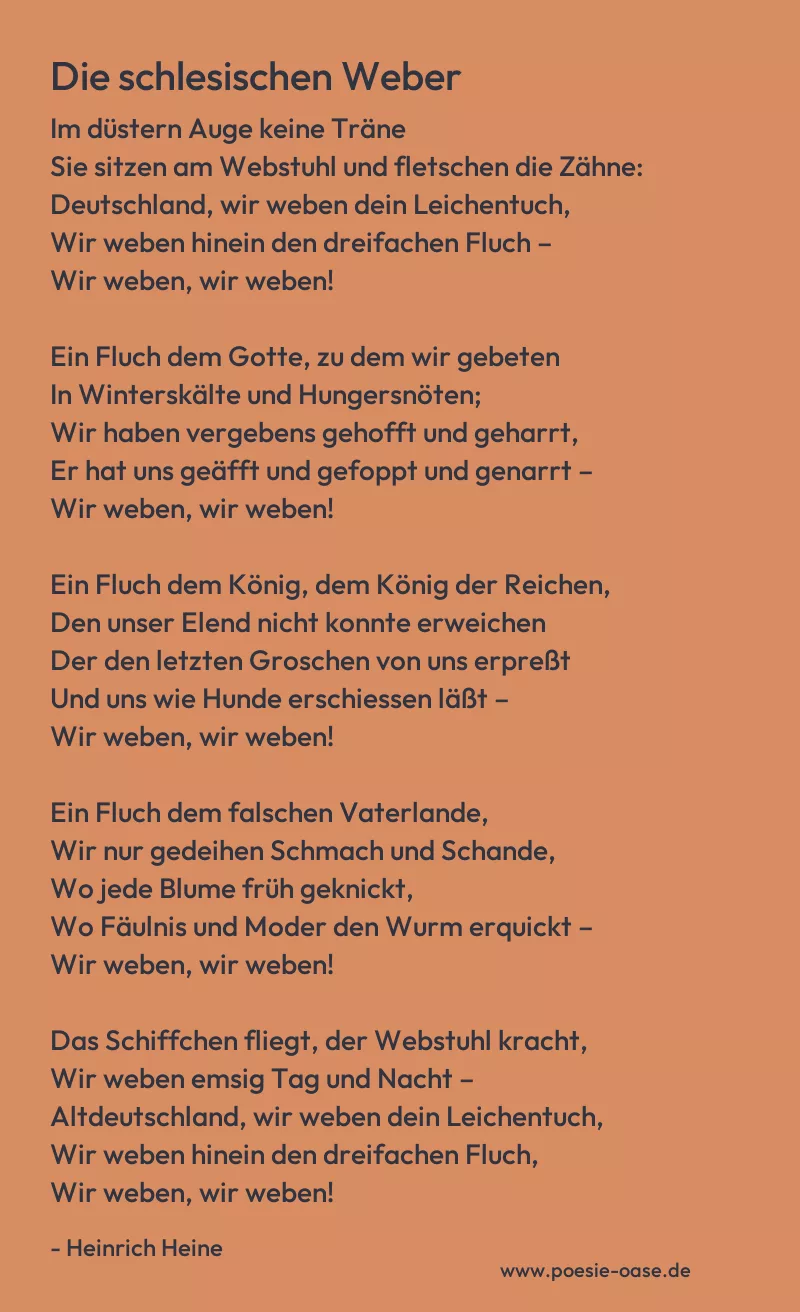Die schlesischen Weber
Im düstern Auge keine Träne
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne:
Deutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch –
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten
In Winterskälte und Hungersnöten;
Wir haben vergebens gehofft und geharrt,
Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt –
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem König, dem König der Reichen,
Den unser Elend nicht konnte erweichen
Der den letzten Groschen von uns erpreßt
Und uns wie Hunde erschiessen läßt –
Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
Wir nur gedeihen Schmach und Schande,
Wo jede Blume früh geknickt,
Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt –
Wir weben, wir weben!
Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
Wir weben emsig Tag und Nacht –
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreifachen Fluch,
Wir weben, wir weben!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
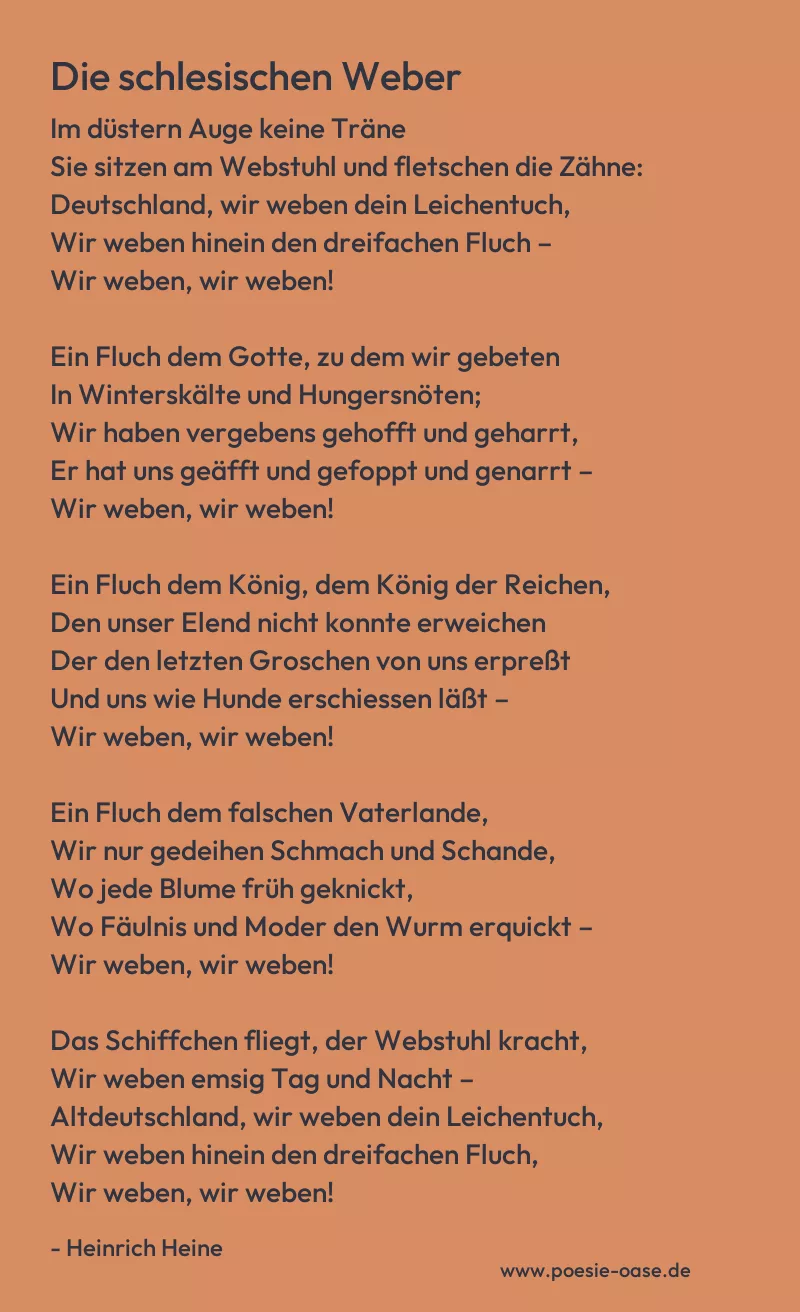
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die schlesischen Weber“ von Heinrich Heine thematisiert die Verzweiflung und den Widerstand der Weber im Schlesischen Aufstand von 1844, wobei es die sozialen und politischen Missstände der Zeit scharf kritisiert. Die Weber, die unter entsetzlichen Arbeitsbedingungen litten, sind von Hoffnungslosigkeit geprägt, was sich in der wiederholten Phrase „Wir weben, wir weben“ widerspiegelt, die eine düstere Determiniertheit vermittelt. Ihr Handeln, das Weben, wird zur Metapher für den schicksalhaften Prozess des Vergehens, das sie in der Hoffnungslosigkeit selbst herbeiführen.
Die drei Verse, in denen die Weber ihre Flüche aussprechen, richten sich gegen Gott, den König und das Vaterland. Sie empfinden den Mangel an Hilfe von Gott als Verrat und verspüren keine Erhörung ihrer Gebete, was ihre Zorn und Enttäuschung noch verstärkt. Der König, als Symbol der herrschenden Klasse, wird für die wirtschaftliche Ausbeutung und die Ungerechtigkeit gegenüber den Armen verantwortlich gemacht. Er wird als grausam und gleichgültig gegenüber dem Leid der Weber dargestellt, was sich in der harten Zeile „der den letzten Groschen von uns erpreßt“ zeigt.
Der letzte Fluch des Gedichts richtet sich gegen das „falsche Vaterland“, das die Weber als korrupt und verrottet empfinden. Die Verwendung von Bildern wie „Fäulnis und Moder“ und „Wurm erquickt“ unterstreicht die düstere und zerstörerische Sicht der Weber auf ihre Heimat, die sie nicht mehr als Ort des Wohlstands, sondern als Ort der Verarmung und des Verfalls wahrnehmen. Die wiederholte Betonung des Webens symbolisiert nicht nur den fortwährenden, kräftezehrenden Kampf der Arbeiter, sondern auch die Zwangsläufigkeit ihrer Situation, die sie als eine Art „Lebensbejahung“ in einer Welt der Unterdrückung verstehen.
Die Sprache des Gedichts ist von einer kraftvollen und leidenschaftlichen Wut durchzogen. Heine verwendet eine einfache, aber eindrucksvolle Wortwahl, die die Wut und den Widerstand der Weber gegen das System widerspiegelt. Die symbolische Bedeutung des Leichentuchs, das sie weben, verstärkt die Vorstellung von Tod und Zerstörung und deutet auf die Opferbereitschaft der Weber hin, die den Untergang des alten Systems herbeiführen wollen. Das Gedicht ist somit nicht nur eine Anklage gegen die ungerechten sozialen Bedingungen, sondern auch ein kraftvolles politisches Manifest, das die Notwendigkeit eines Umsturzes fordert.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.