Das Fräulein stand am Meere
Und seufzte lang und bang,
Es rührte sie so sehre
Der Sonnenuntergang.
Mein Fräulein! sein Sie munter,
Das ist ein altes Stück;
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zurück.
Das Fräulein stand am Meere
Und seufzte lang und bang,
Es rührte sie so sehre
Der Sonnenuntergang.
Mein Fräulein! sein Sie munter,
Das ist ein altes Stück;
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zurück.
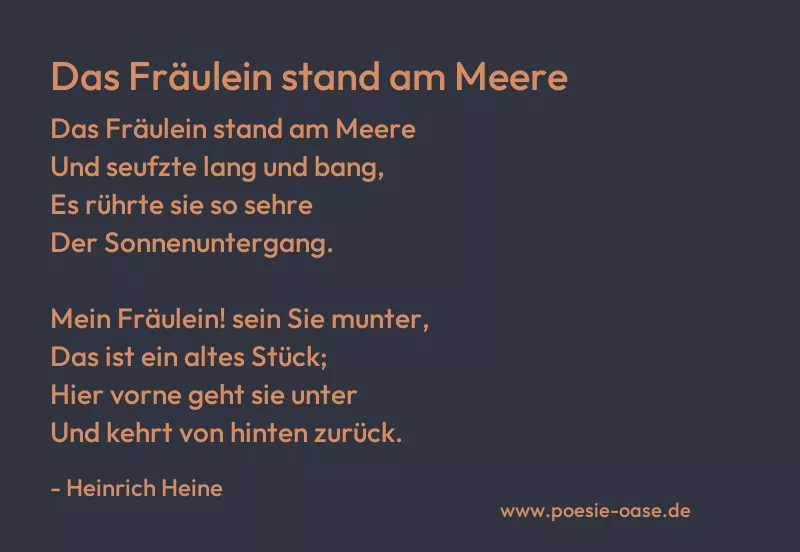
Das Gedicht „Das Fräulein stand am Meere“ von Heinrich Heine verbindet auf typische Weise Romantik und Ironie. In der ersten Strophe wird eine melancholische Szene beschrieben: Ein Fräulein steht am Meer, ergriffen von der Schönheit und Traurigkeit des Sonnenuntergangs. Das Seufzen und die „bange“ Stimmung spiegeln eine romantische Empfindsamkeit und das Erleben der Natur als Spiegel innerer Gefühle.
Die zweite Strophe bringt jedoch eine überraschende Wendung. Anstelle einer einfühlsamen Antwort folgt eine nüchterne, fast spöttische Bemerkung, die das Naturereignis rational erklärt: Die Sonne geht nur vorn unter und „kehrt von hinten zurück“. Diese banale Feststellung wirkt wie eine ironische Brechung der vorher aufgebauten romantischen Stimmung. Heine spielt hier mit der Gegenüberstellung von Gefühlstiefe und nüchterner Vernunft.
Das Gedicht thematisiert damit auf humorvolle Weise die Spannung zwischen romantischer Schwärmerei und der Realität. Während das Fräulein sich emotional vom Anblick der Natur ergreifen lässt, antwortet das lyrische Ich mit einer desillusionierenden Bemerkung, die das Erhabene ins Alltägliche zurückholt. Diese ironische Distanz ist typisch für Heines Lyrik, die oft zwischen romantischer Tradition und moderner Skepsis oszilliert.
In wenigen Zeilen gelingt es Heine, mit schlichter Sprache eine ganze Haltung gegenüber romantischen Idealen zu zeigen: die Mischung aus Mitgefühl und kritischer Distanz, die seine Lyrik so prägnant und zeitlos wirken lässt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.