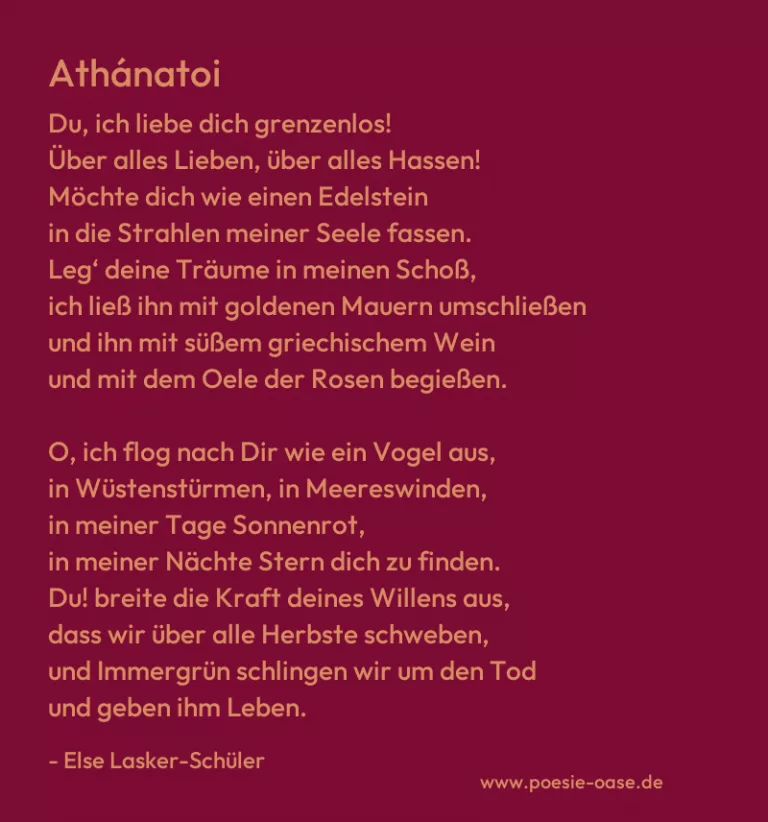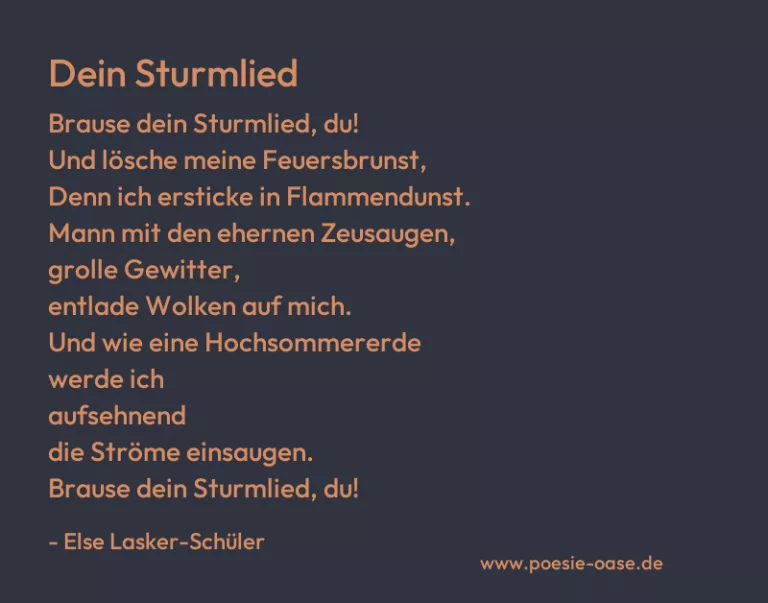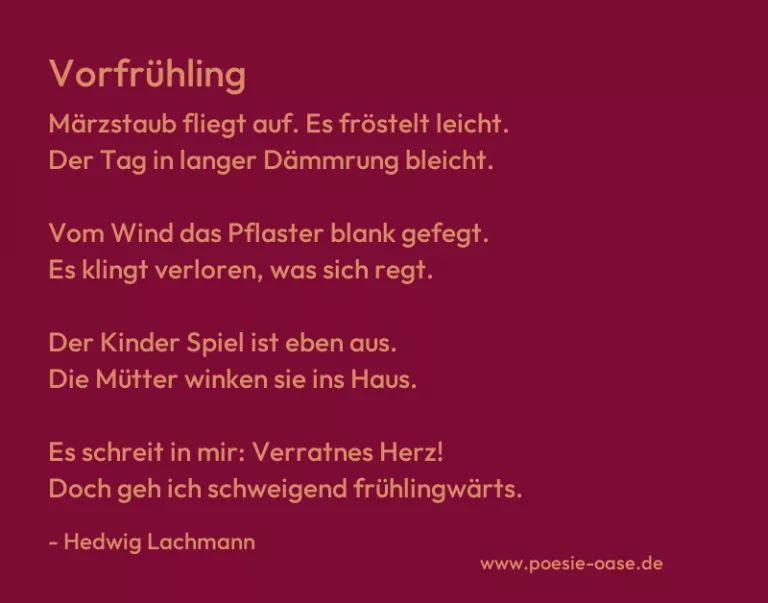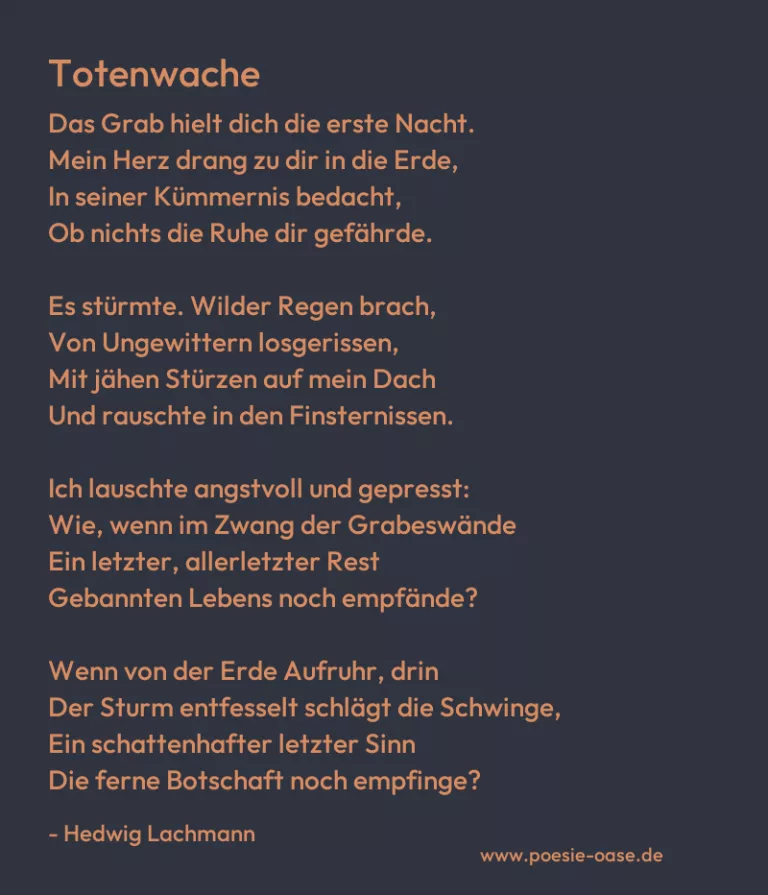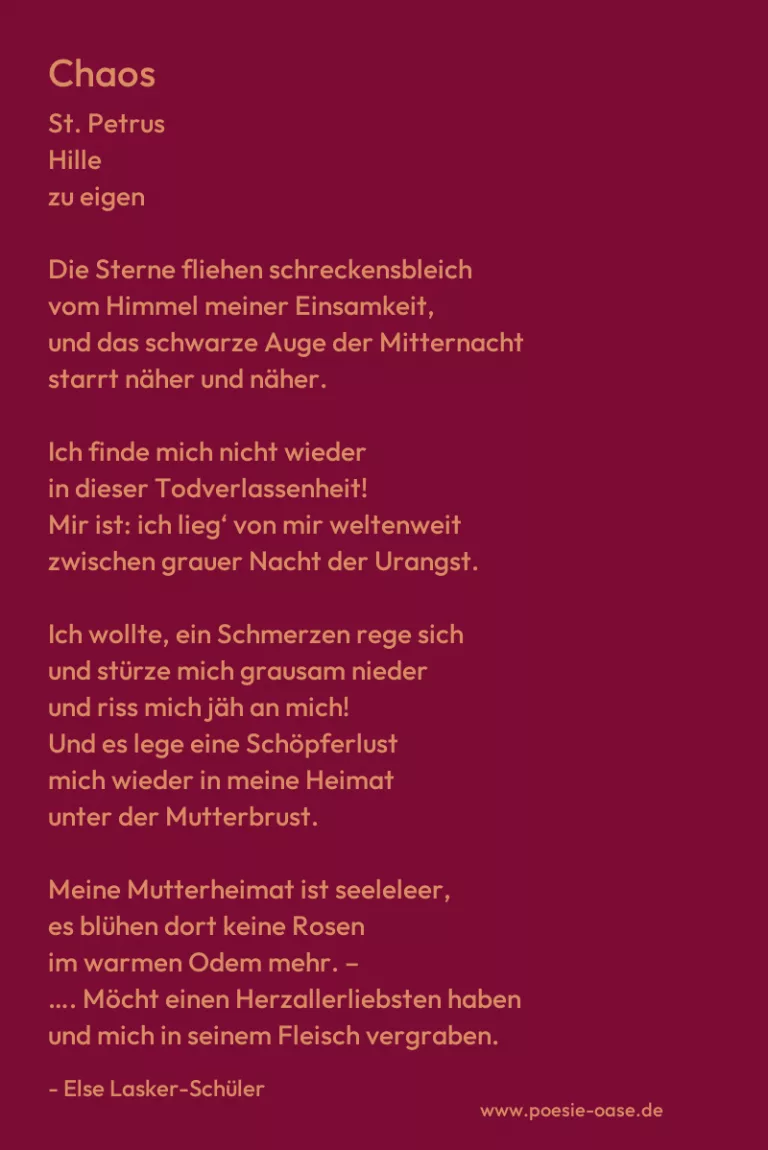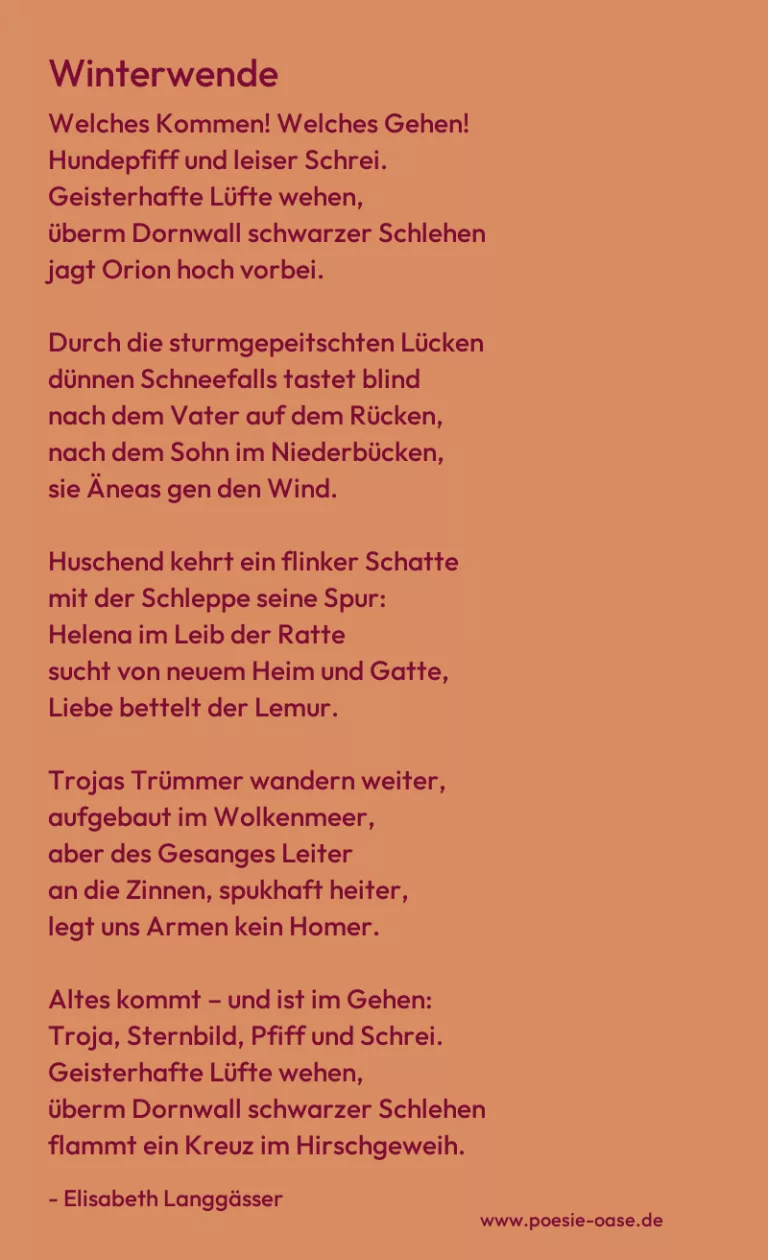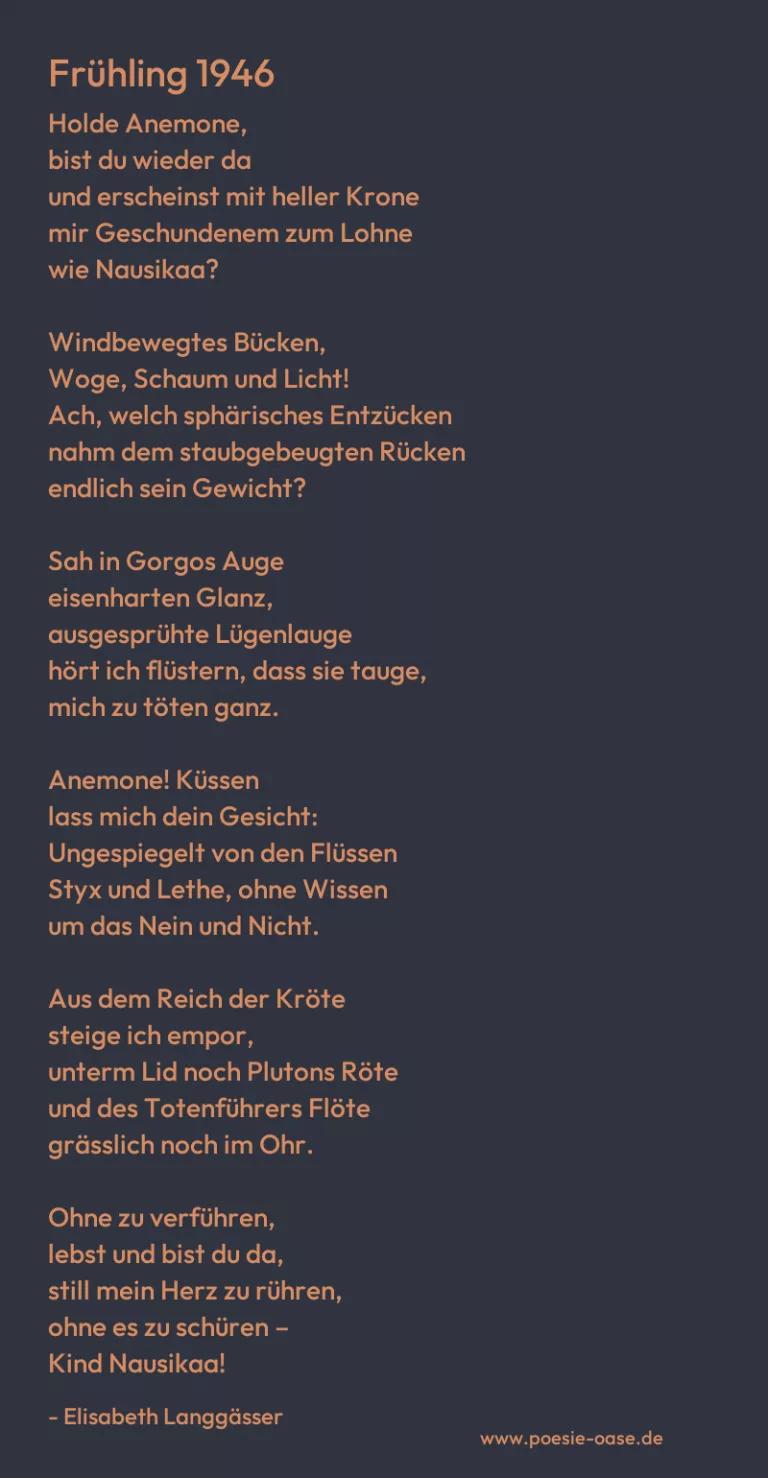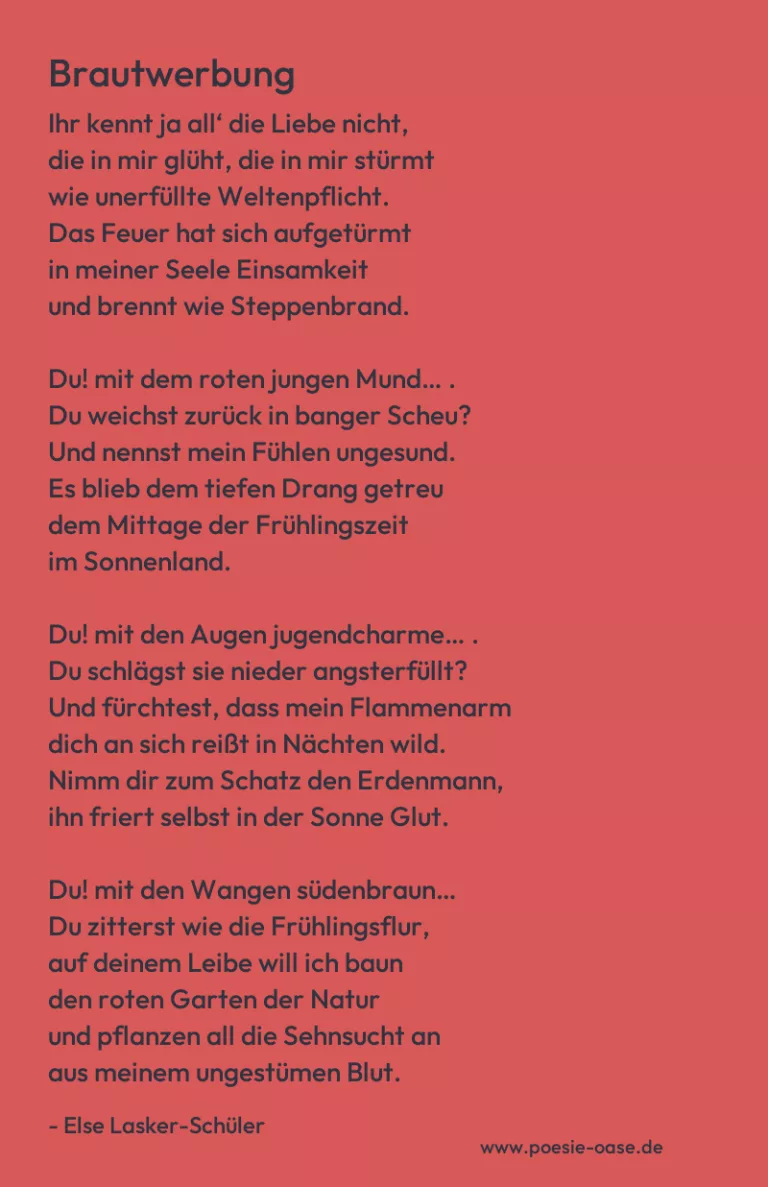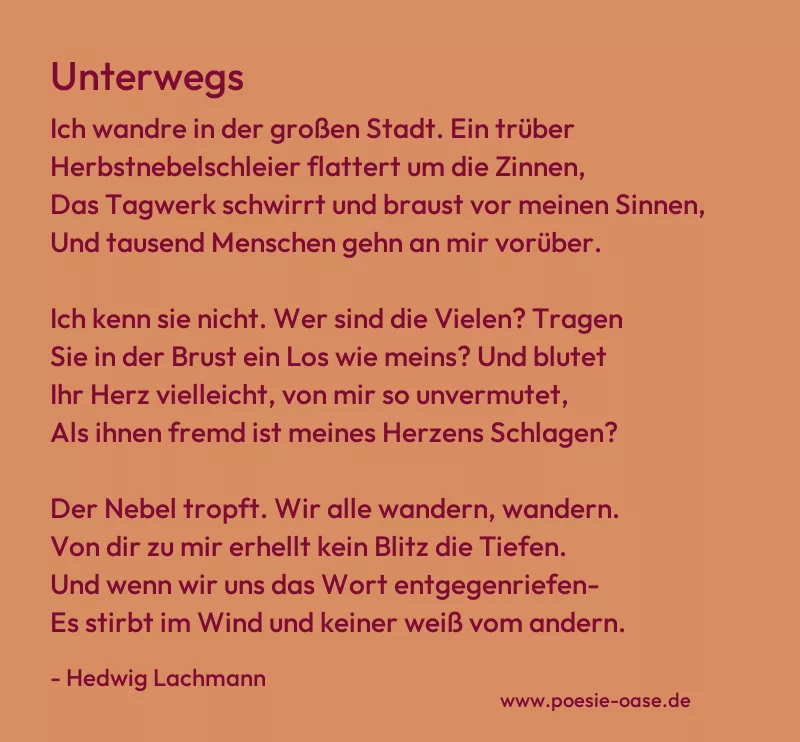Unterwegs
Ich wandre in der großen Stadt. Ein trüber
Herbstnebelschleier flattert um die Zinnen,
Das Tagwerk schwirrt und braust vor meinen Sinnen,
Und tausend Menschen gehn an mir vorüber.
Ich kenn sie nicht. Wer sind die Vielen? Tragen
Sie in der Brust ein Los wie meins? Und blutet
Ihr Herz vielleicht, von mir so unvermutet,
Als ihnen fremd ist meines Herzens Schlagen?
Der Nebel tropft. Wir alle wandern, wandern.
Von dir zu mir erhellt kein Blitz die Tiefen.
Und wenn wir uns das Wort entgegenriefen-
Es stirbt im Wind und keiner weiß vom andern.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
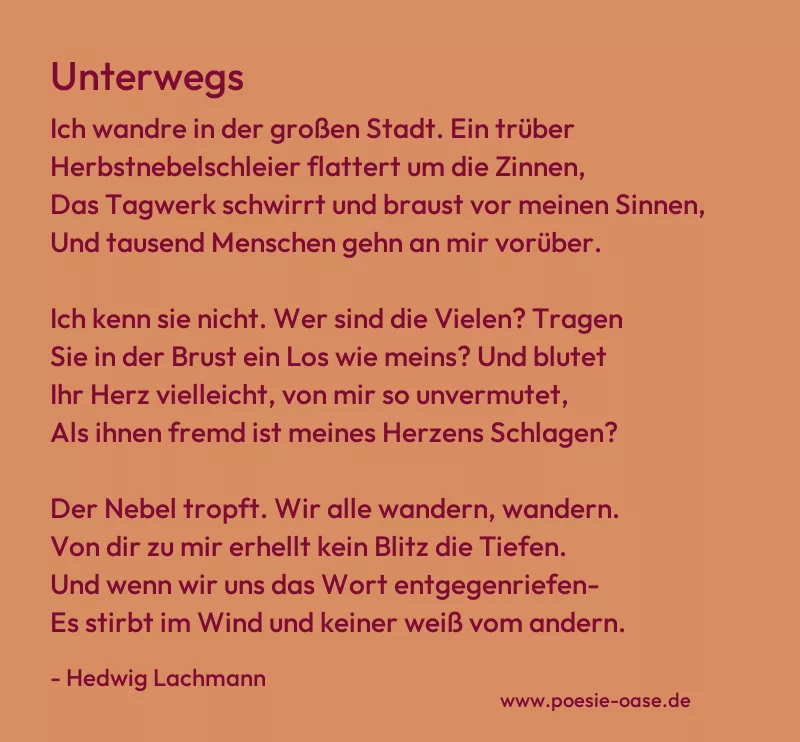
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Unterwegs“ von Hedwig Lachmann stellt die Entfremdung und Isolation des modernen Lebens in einer anonymen Großstadt dar. Die erste Strophe zeigt die Sprecherin, die in der trüben Atmosphäre einer „großen Stadt“ umherwandert, während der Nebel die Zinnen der Gebäude umhüllt. Der „Herbstnebelschleier“ kann als Symbol für Unsicherheit und Entfremdung gedeutet werden, da er die Sicht auf die Welt verwischt und die Distanz zwischen der Sprecherin und ihrer Umgebung betont. Das „Tagwerk“ und das „Brausen“ der Menschen, die an ihr vorbeigehen, vermitteln eine Hektik und Unruhe, die die Einsamkeit inmitten der Masse verstärken.
In der zweiten Strophe reflektiert die Sprecherin über die Unbekanntheit der vielen Menschen, die sie auf ihrem Weg begegnen. Ihre Frage „Wer sind die Vielen?“ verdeutlicht das Gefühl der Entfremdung und das Fehlen von persönlichen Verbindungen in einer belebten Stadt. Die Vorstellung, dass diese Fremden vielleicht ein ähnliches „Los“ tragen wie sie, zeigt eine Hoffnung auf Gemeinsamkeit und ein tiefes, aber unerfülltes Bedürfnis nach Empathie. Doch auch wenn ihr „Herz vielleicht blutet“, bleibt es unverbunden mit dem der anderen, was die Isolation der Sprecherin noch deutlicher macht.
Die wiederholte Verwendung des Verbs „wandern“ in der letzten Strophe verstärkt das Bild der endlosen Reise und des Suchens, ohne je anzukommen. Der „Nebel tropft“ – ein Bild, das sowohl die Zeit als auch das fortwährende Streben symbolisiert. Die Sprecherin und die anderen „wandern“ weiter, ohne dass es einen erhellenden Moment der Verbindung oder des Verständnisses gibt. Die Unfähigkeit, sich „das Wort entgegenzurufen“ und das Sterben der Worte im Wind unterstreichen das Fehlen von Kommunikation und echten Begegnungen. Diese Zeilen betonen die vergebliche Suche nach Nähe in einer Welt, in der Menschen aneinander vorbeiziehen, ohne wirklich in Kontakt zu treten.
Das Gedicht thematisiert die Vergänglichkeit von Momenten und das Gefühl der inneren Leere, das in einer anonymen Gesellschaft entstehen kann. Es schildert eine existenzielle Sehnsucht nach Verbindung, die jedoch durch die Entfremdung und das Fehlen von Bedeutung in der Begegnung mit anderen nicht erfüllt wird. Die Sprecherin bleibt ein Einzelner in der Masse, auf einer Reise, die nie ein Ende findet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.