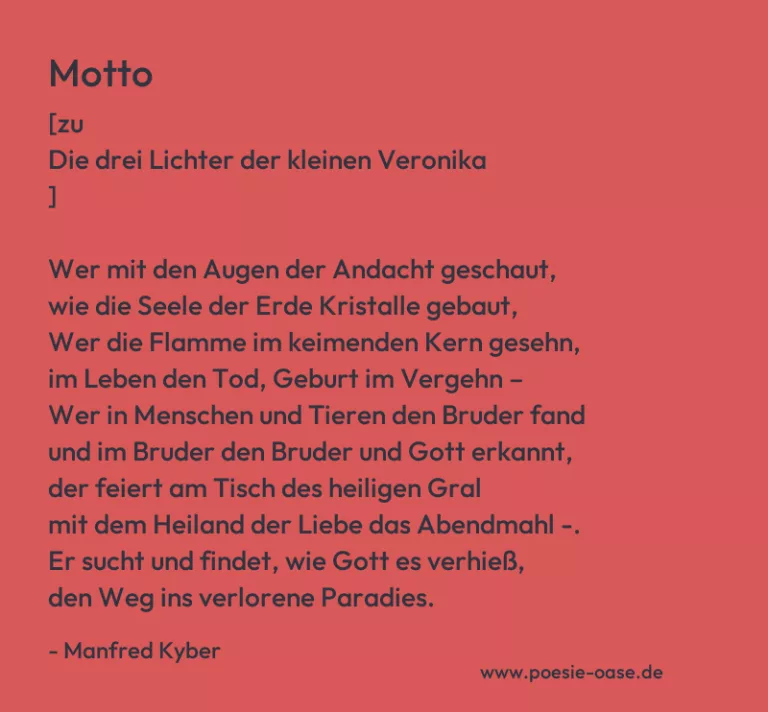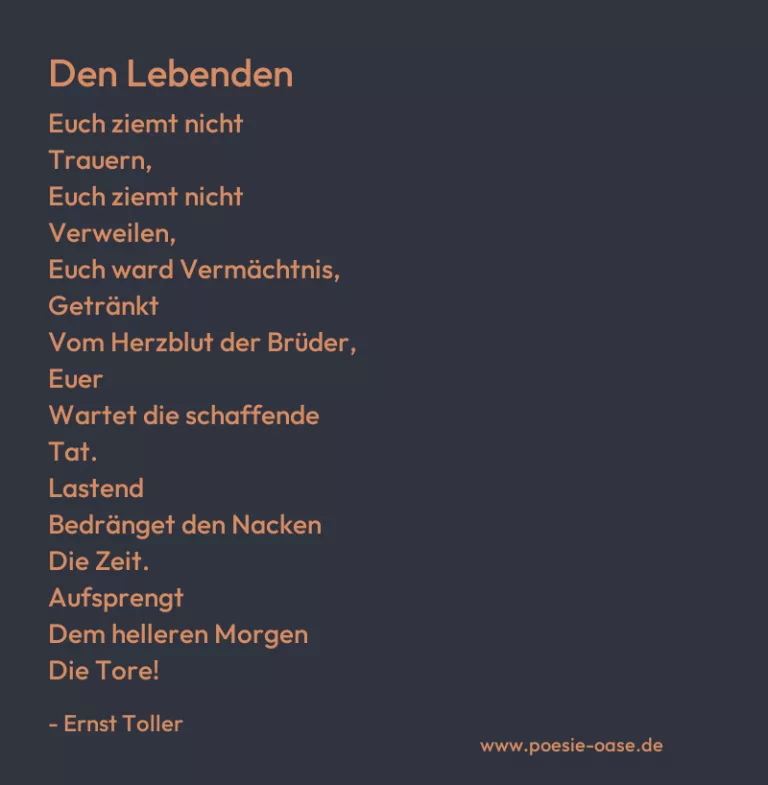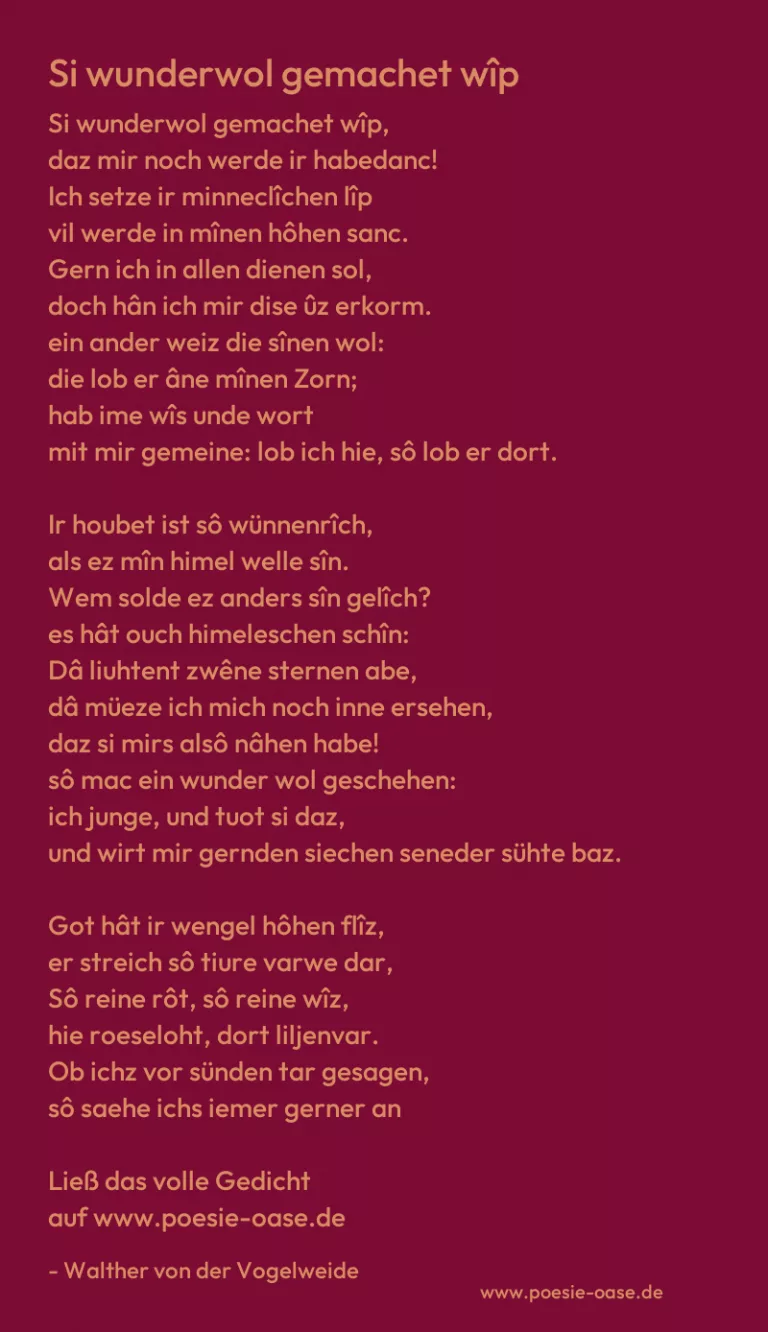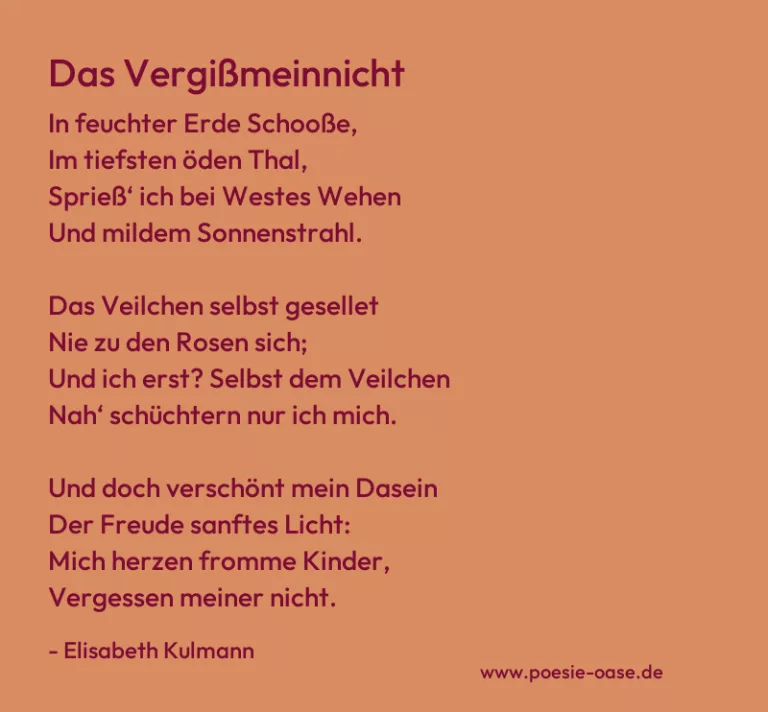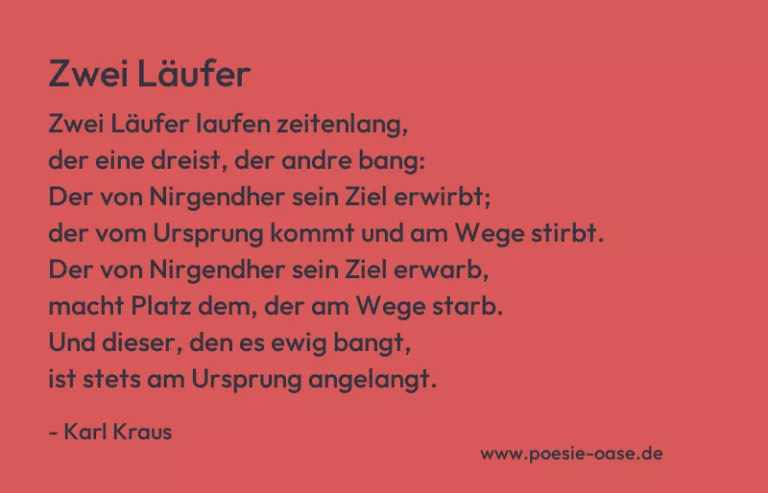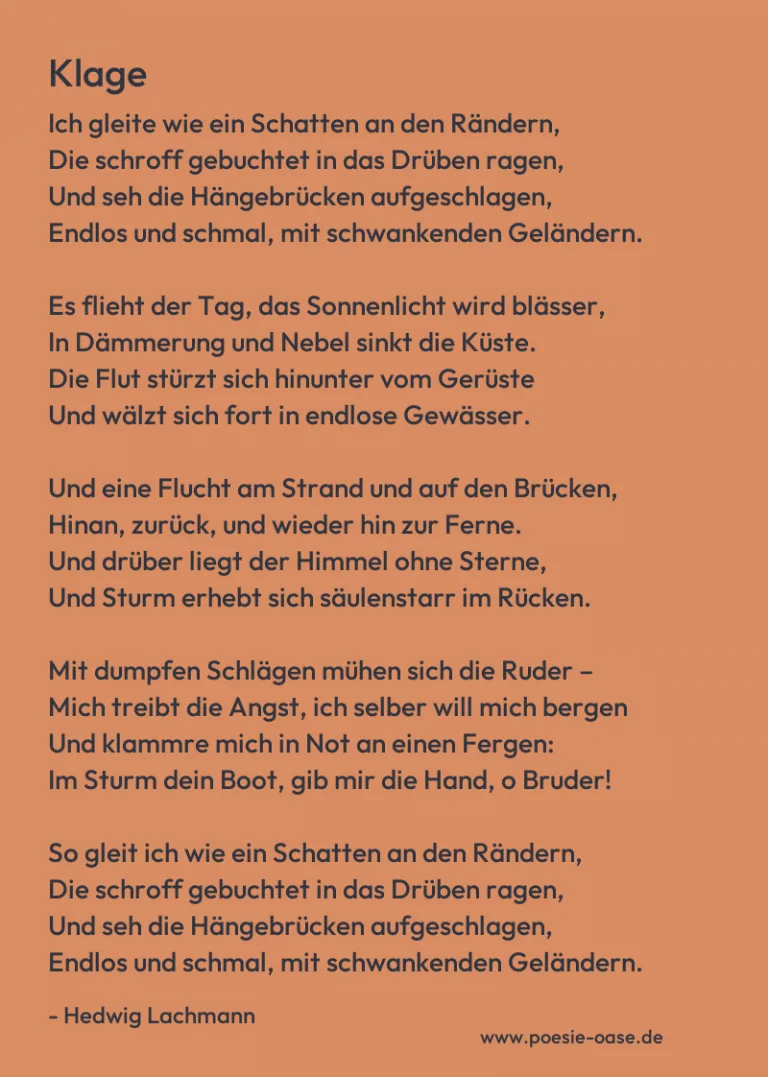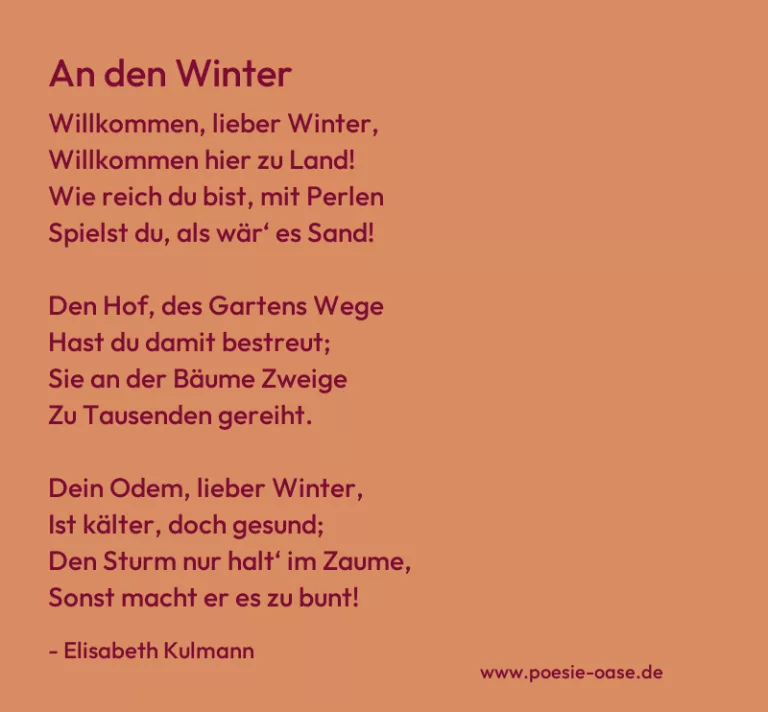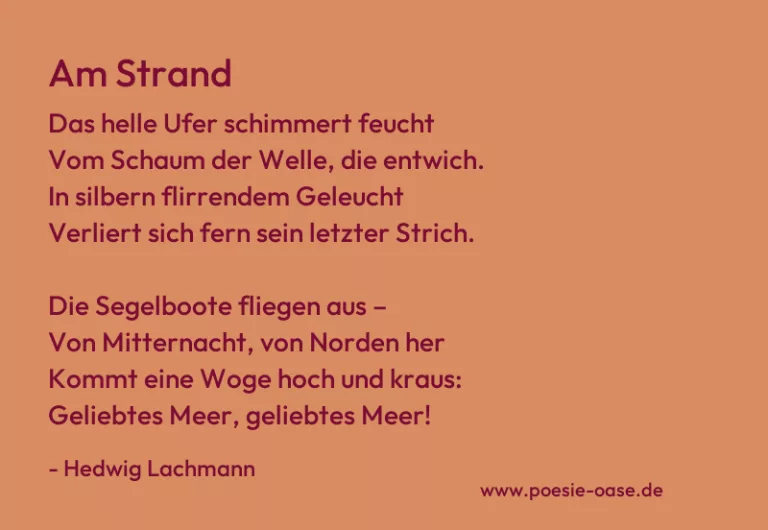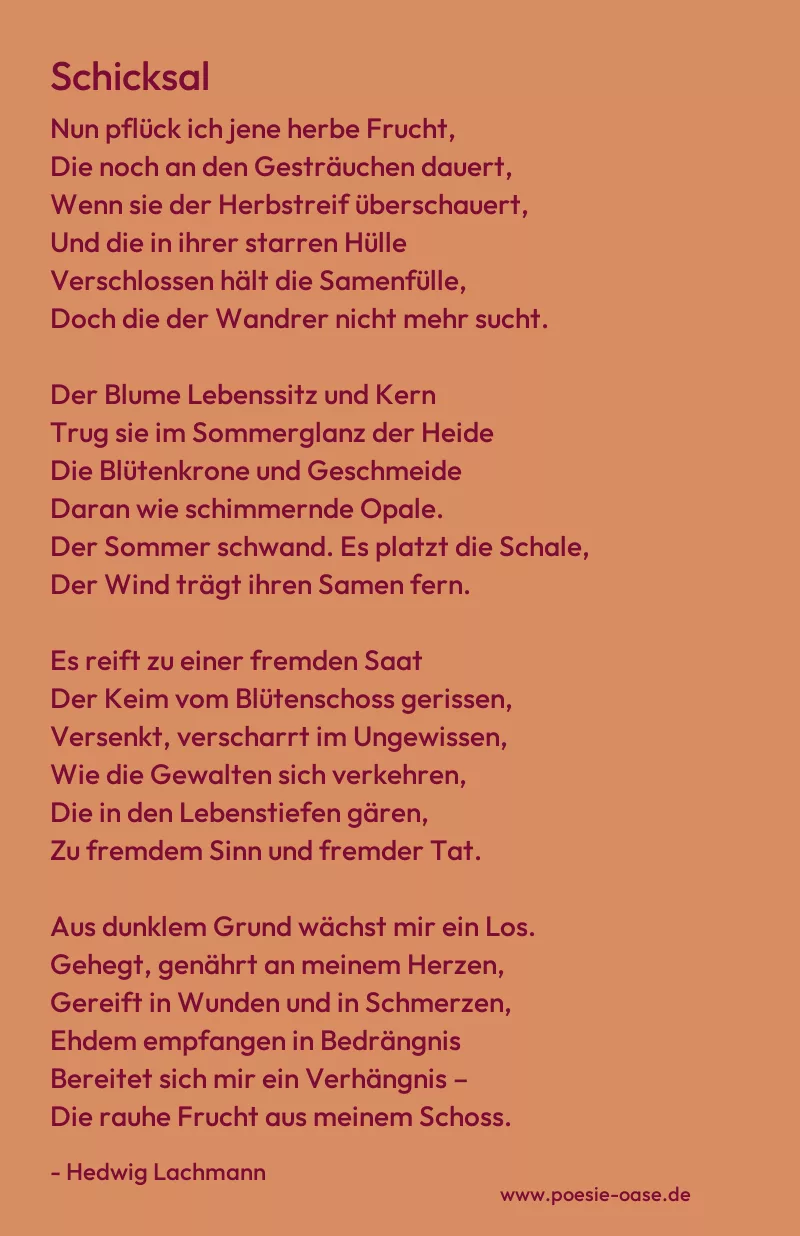Schicksal
Nun pflück ich jene herbe Frucht,
Die noch an den Gesträuchen dauert,
Wenn sie der Herbstreif überschauert,
Und die in ihrer starren Hülle
Verschlossen hält die Samenfülle,
Doch die der Wandrer nicht mehr sucht.
Der Blume Lebenssitz und Kern
Trug sie im Sommerglanz der Heide
Die Blütenkrone und Geschmeide
Daran wie schimmernde Opale.
Der Sommer schwand. Es platzt die Schale,
Der Wind trägt ihren Samen fern.
Es reift zu einer fremden Saat
Der Keim vom Blütenschoss gerissen,
Versenkt, verscharrt im Ungewissen,
Wie die Gewalten sich verkehren,
Die in den Lebenstiefen gären,
Zu fremdem Sinn und fremder Tat.
Aus dunklem Grund wächst mir ein Los.
Gehegt, genährt an meinem Herzen,
Gereift in Wunden und in Schmerzen,
Ehdem empfangen in Bedrängnis
Bereitet sich mir ein Verhängnis –
Die rauhe Frucht aus meinem Schoss.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
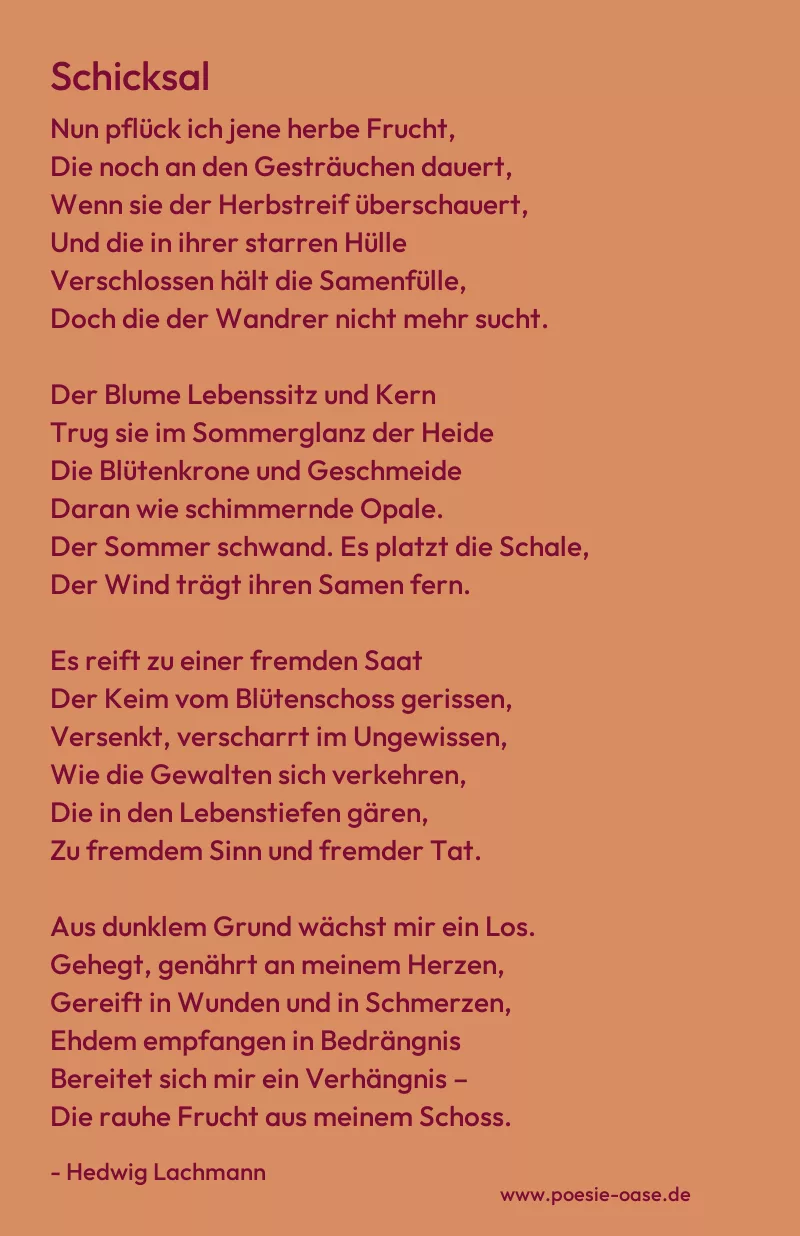
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Schicksal“ von Hedwig Lachmann ist eine tiefgründige Reflexion über das Leben, das Schicksal und die schmerzliche Akzeptanz von Unvermeidlichem. Zu Beginn beschreibt die Sprecherin, wie sie die „herbe Frucht“ pflückt, die nach dem Sommer übrig bleibt und in „starrern Hüllen“ die „Samenfülle“ verbirgt. Diese Frucht ist ein Symbol für etwas, das am Ende eines Zyklus verbleibt und in sich das Potenzial für Neues enthält, jedoch auch eine gewisse Härte und Unzugänglichkeit aufweist. Das Bild der „starren Hülle“ und des „Wandrer[s], der nicht mehr sucht“, deutet darauf hin, dass das, was einmal lebendig und strahlend war, nun in eine Phase der Ungewissheit und des Verborgenen übergeht.
In der zweiten Strophe wird die Blume des Sommers beschrieben, die in ihrer vollen Pracht „Blütenkrone und Geschmeide“ trug. Doch mit dem Sommer schwindet auch die Schönheit und die Blüte, und die Frucht „platzt“ auf. Der Wind trägt den Samen fort, was das Ende eines Zyklus und den Beginn eines neuen, unbekannten Prozesses symbolisiert. Der Samen, der von der Pflanze „gerissen“ und in die Ungewissheit verscharrt wird, steht für das Verlassen der sicheren, vertrauten Umgebung und das Überlassen an die Kräfte des Lebens, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen.
Die dritte Strophe zeigt den Prozess der Reifung einer „fremden Saat“, die aus dem ursprünglichen Leben hervorgeht, aber nun eine eigene, unbekannte Form annimmt. Der „Keim vom Blütenschoss gerissen“ und „versenkt im Ungewissen“ ist ein Bild für das Unbekannte und das Unerforschte, das in jedem Leben steckt. Hier wird das Schicksal als eine sich wandelnde und unvorhersehbare Kraft dargestellt, die in den Tiefen des Lebens gärt und zu „fremdem Sinn und fremder Tat“ wird – Handlungen, die sich aus Umständen entwickeln, die der Mensch nicht immer versteht.
In der letzten Strophe wird das Schicksal noch persönlicher und konkreter. Die Sprecherin spricht von einem „Los“, das aus dem „dunklen Grund“ wächst und an ihrem Herzen genährt wird. Diese „Frucht“ ist das Ergebnis von „Wunden und Schmerzen“, die in der Vergangenheit erlitten wurden. Sie verweist auf die Tatsache, dass das Leben oft von Leiden und Schwierigkeiten geprägt ist, die den Verlauf und die Form des Schicksals bestimmen. Die „raue Frucht aus meinem Schoss“ stellt die eigene, schicksalhafte Entwicklung dar – die Frucht des Lebens, die aus eigenen Erfahrungen und inneren Kämpfen hervorgeht, um schließlich das unvermeidliche „Verhängnis“ zu bereiten.
Das Gedicht thematisiert die Idee, dass das Leben und das Schicksal eine unausweichliche Entwicklung durchlaufen, die oft von Schmerz und Wunden begleitet wird. Es zeigt die Unabwendbarkeit der Veränderungen und den schmerzhaften, aber notwendigen Prozess der Reifung und des Wandels. Lachmanns Gedicht reflektiert über die tiefere Bedeutung des Lebenszyklus und die Akzeptanz des Schicksals als Teil des eigenen Weges.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.