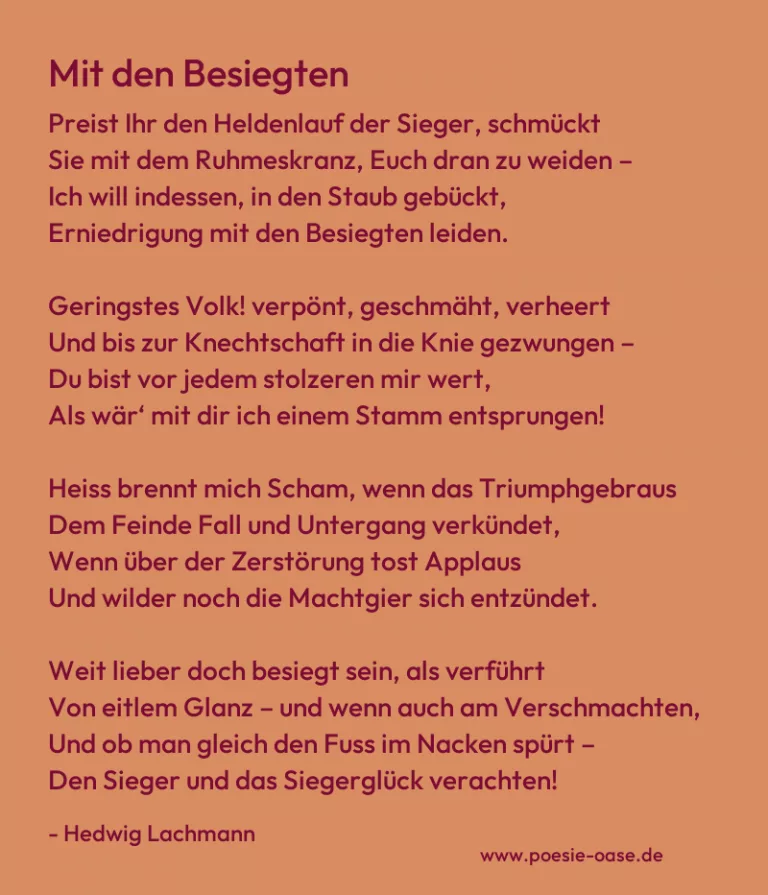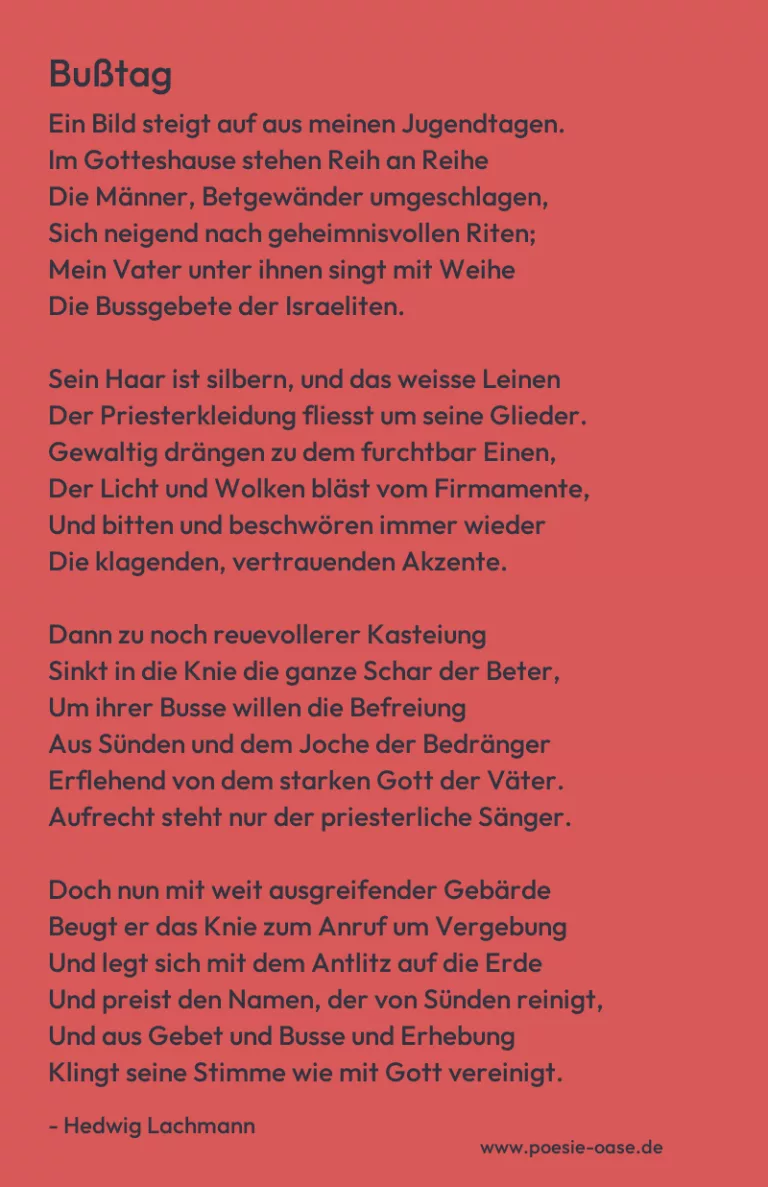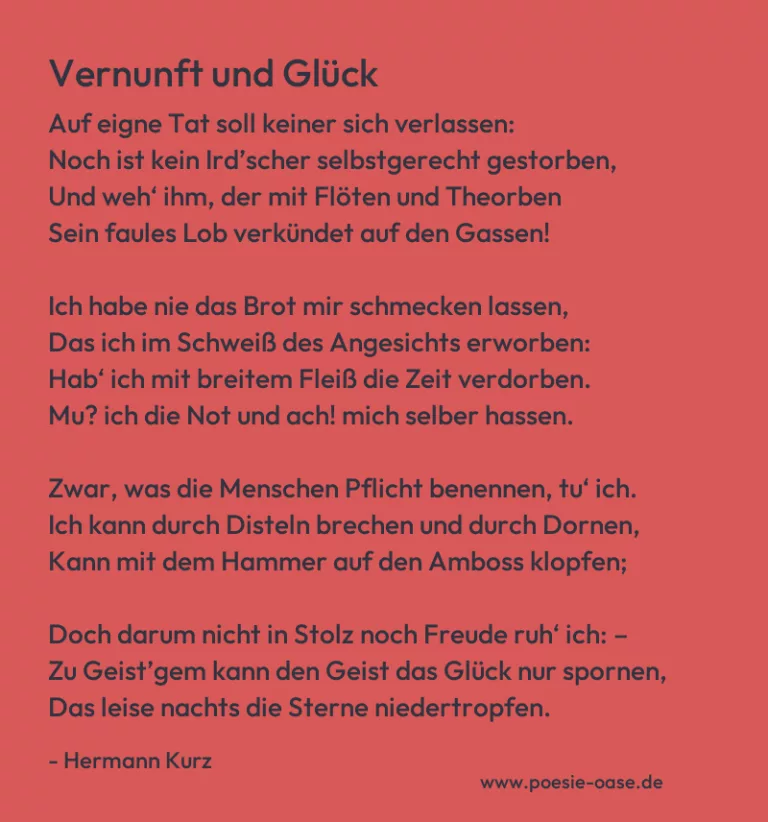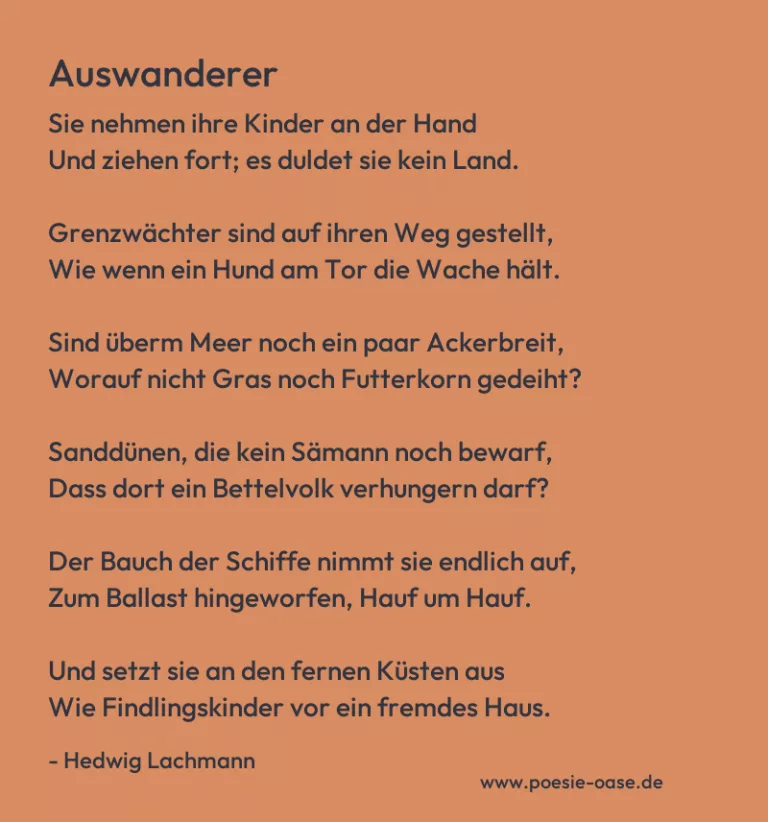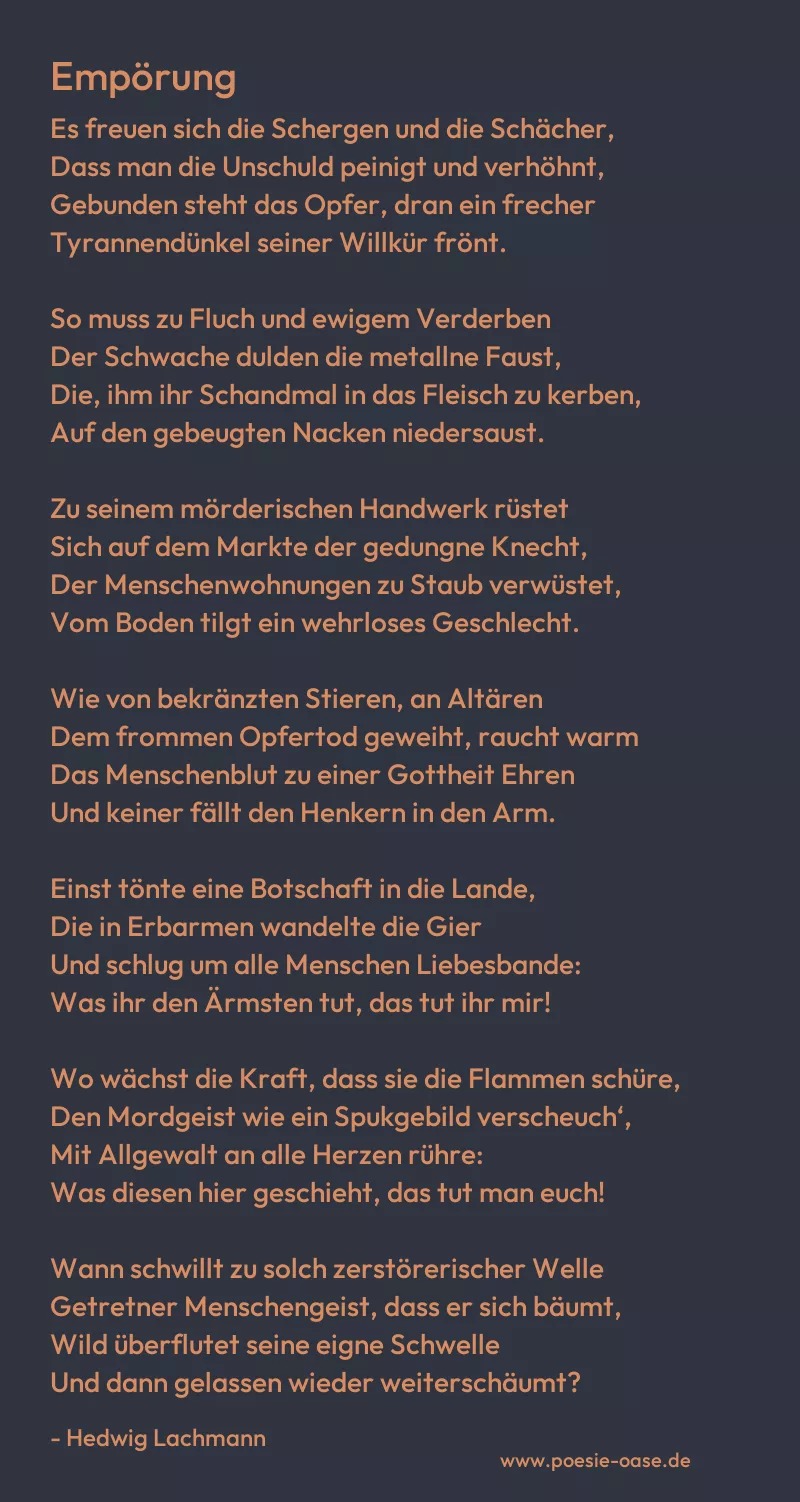Empörung
Es freuen sich die Schergen und die Schächer,
Dass man die Unschuld peinigt und verhöhnt,
Gebunden steht das Opfer, dran ein frecher
Tyrannendünkel seiner Willkür frönt.
So muss zu Fluch und ewigem Verderben
Der Schwache dulden die metallne Faust,
Die, ihm ihr Schandmal in das Fleisch zu kerben,
Auf den gebeugten Nacken niedersaust.
Zu seinem mörderischen Handwerk rüstet
Sich auf dem Markte der gedungne Knecht,
Der Menschenwohnungen zu Staub verwüstet,
Vom Boden tilgt ein wehrloses Geschlecht.
Wie von bekränzten Stieren, an Altären
Dem frommen Opfertod geweiht, raucht warm
Das Menschenblut zu einer Gottheit Ehren
Und keiner fällt den Henkern in den Arm.
Einst tönte eine Botschaft in die Lande,
Die in Erbarmen wandelte die Gier
Und schlug um alle Menschen Liebesbande:
Was ihr den Ärmsten tut, das tut ihr mir!
Wo wächst die Kraft, dass sie die Flammen schüre,
Den Mordgeist wie ein Spukgebild verscheuch‘,
Mit Allgewalt an alle Herzen rühre:
Was diesen hier geschieht, das tut man euch!
Wann schwillt zu solch zerstörerischer Welle
Getretner Menschengeist, dass er sich bäumt,
Wild überflutet seine eigne Schwelle
Und dann gelassen wieder weiterschäumt?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
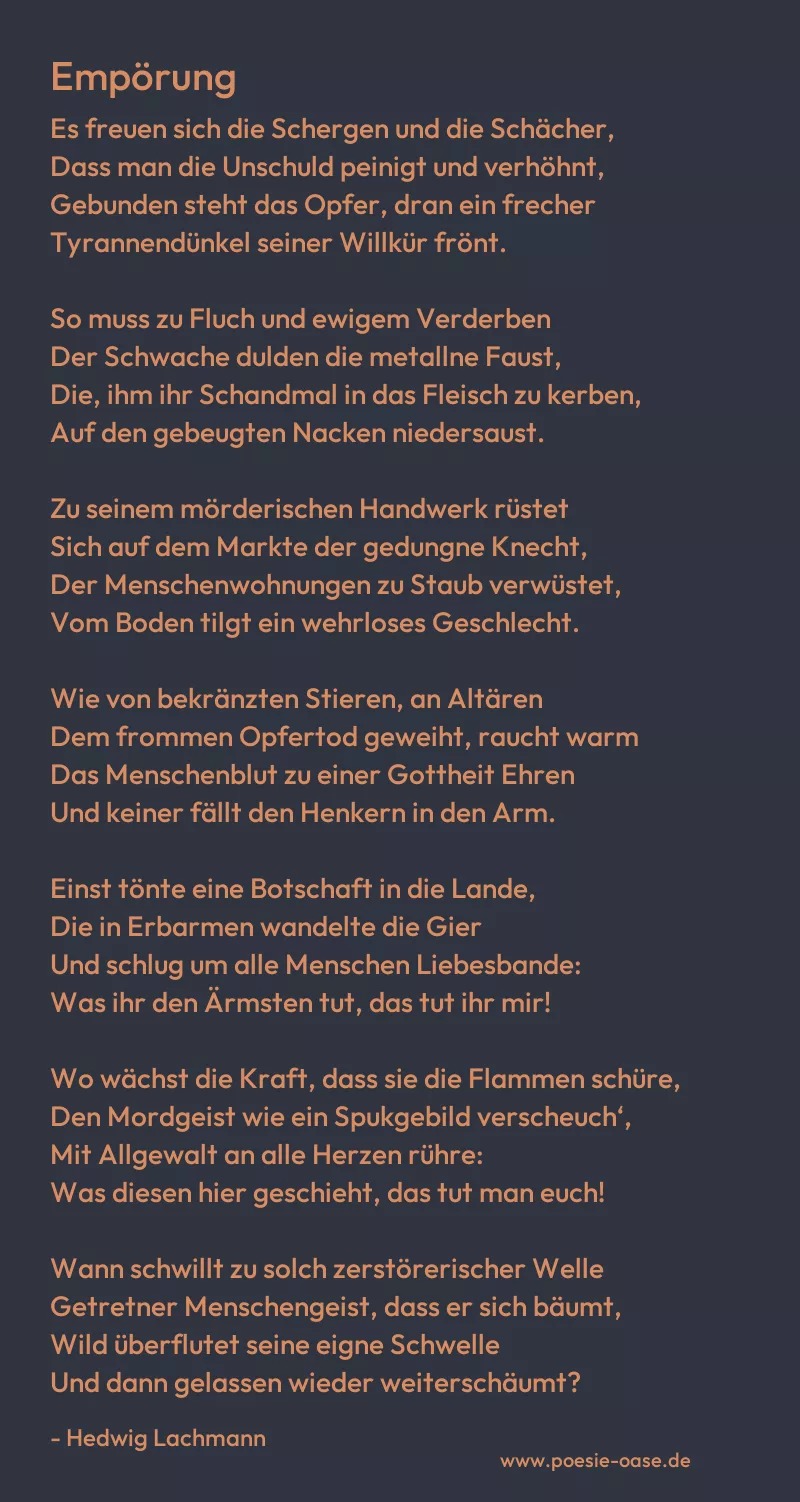
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Empörung“ von Hedwig Lachmann behandelt die Themen von Unterdrückung, Ungerechtigkeit und der Drang nach Gerechtigkeit im Angesicht von Gewalt und Machtmissbrauch. Zu Beginn beschreibt die Dichterin die Freude der „Schergen“ und „Schächer“, die sich daran laben, die Unschuld zu quälen und zu verspotten. Diese Figuren symbolisieren die Unterdrücker, die die Macht über die Schwachen ausüben. Das Opfer, „gebunden“, steht hilflos und machtlos, während der „Tyrannendünkel“ des Herrschers die Willkür und Grausamkeit der Unterdrückung unterstreicht.
In den folgenden Zeilen wird das Bild der Gewalt weiter zugespitzt, indem die „metallne Faust“ des Unterdrückers symbolisch als Werkzeug des Leidens dargestellt wird. Diese Faust, die „auf den gebeugten Nacken niedersaust“, fügt dem Opfer nicht nur körperliche Schmerzen zu, sondern hinterlässt auch ein „Schandmal“ im Fleisch, was die bleibenden physischen und emotionalen Narben der Unterdrückung betont. Es wird der Eindruck erweckt, dass das Opfer durch den Schmerz und die Demütigung nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Würde verliert.
Das Gedicht fährt fort mit dem Bild des „gedungnen Knechts“, der auf dem Markt zu seinem „mörderischen Handwerk“ ansetzt. Hier wird der Knecht als ein Werkzeug der Gewalt und Zerstörung dargestellt, der mit seinem Handeln ganze „Menschenwohnungen“ in „Staub verwüstet“ und ein wehrloses Volk auslöscht. Diese Bilder von Zerstörung und Vernichtung betonen die grausame Natur der Unterdrückung und die völlige Machtlosigkeit derjenigen, die unterdrückt werden.
In der nächsten Strophe wird auf die Opferung der Menschen als ein ritueller Akt hingewiesen, ähnlich den alten „begrabenen Stieren“ an den Altären, deren Blut den Göttern geopfert wurde. Das Menschenopfer wird hier als grausamer Akt des religiösen Wahns und als Mittel der Herrschaft über das Leben anderer dargestellt. Der Ausdruck „und keiner fällt den Henkern in den Arm“ deutet darauf hin, dass niemand den Mut oder die Kraft hat, sich gegen die Henker zu erheben, was die Verzweiflung der Opfer unterstreicht.
Das Gedicht endet mit der Frage, ob die Menschheit jemals die Kraft finden wird, gegen die Unterdrückung zu kämpfen und den „Mordgeist“ zu vertreiben. Die Zeilen stellen eine tiefgehende Reflexion darüber an, wie sich der Mensch gegenüber Gewalt und Ungerechtigkeit verhält. „Was diesen hier geschieht, das tut man euch!“ fordert dazu auf, über das eigene Handeln nachzudenken und die Ketten der Unterdrückung zu brechen. Das Gedicht endet mit einer hoffnungsvollen, aber auch alarmierenden Frage: Wann wird die unterdrückte Menschlichkeit so stark, dass sie sich gegen ihre Peiniger erhebt und für die Gerechtigkeit kämpft? Es bleibt eine offene Frage, die den Leser auffordert, die Verantwortung für seine Taten und deren Auswirkungen auf andere zu erkennen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.