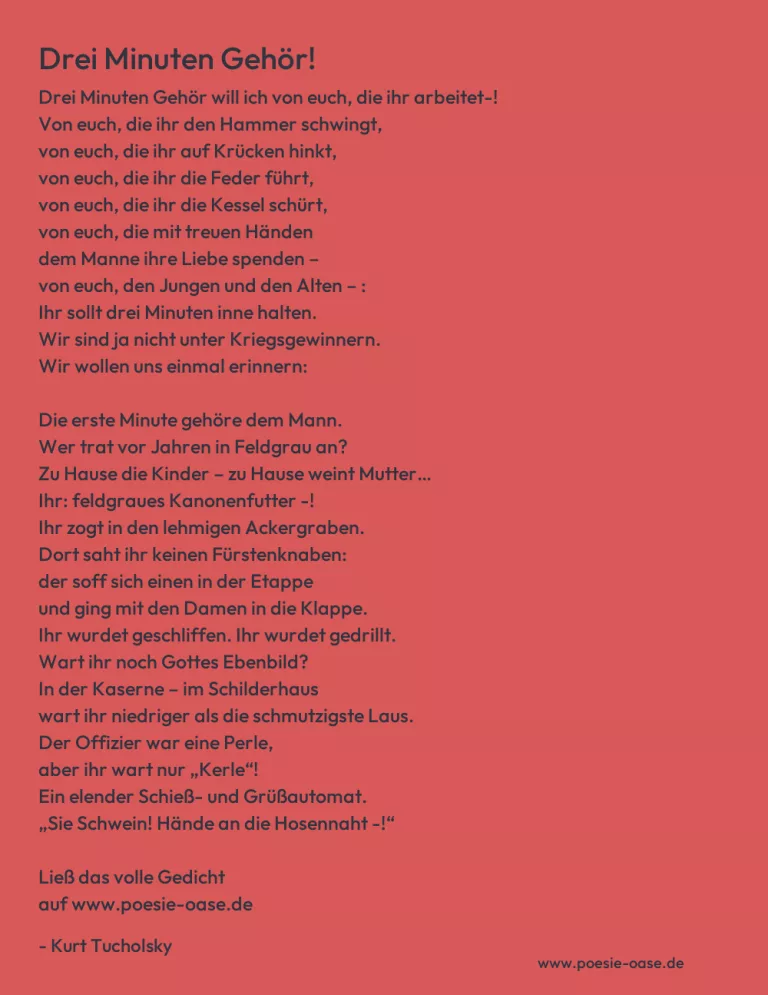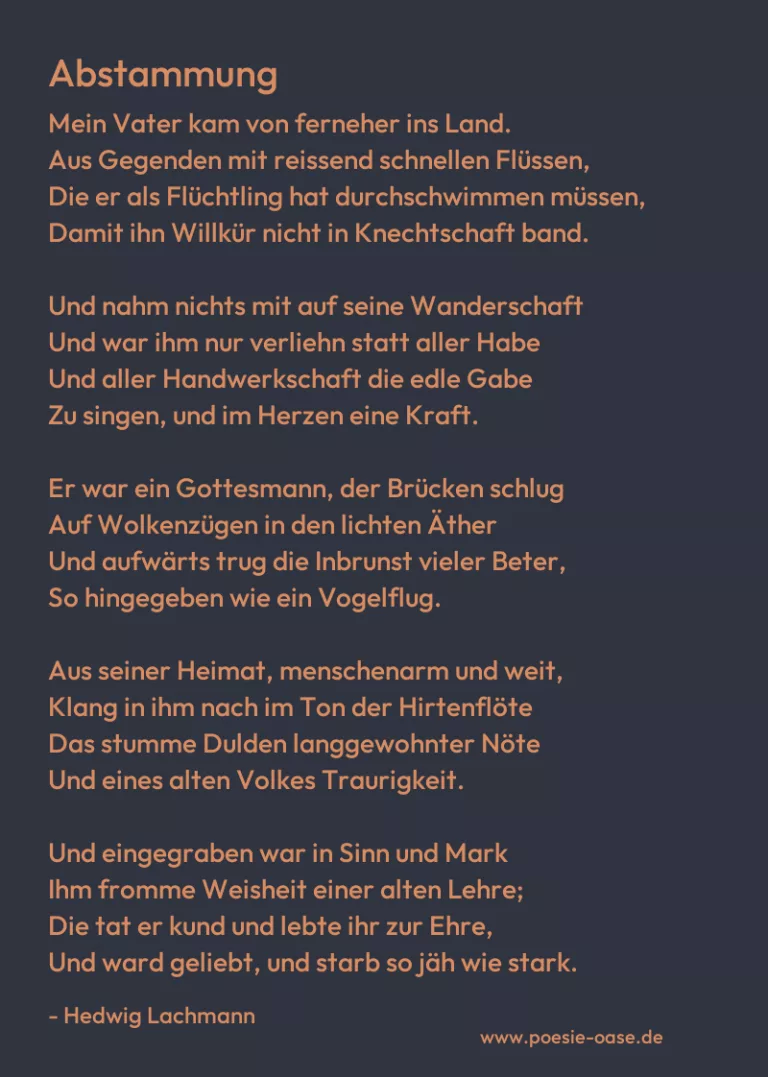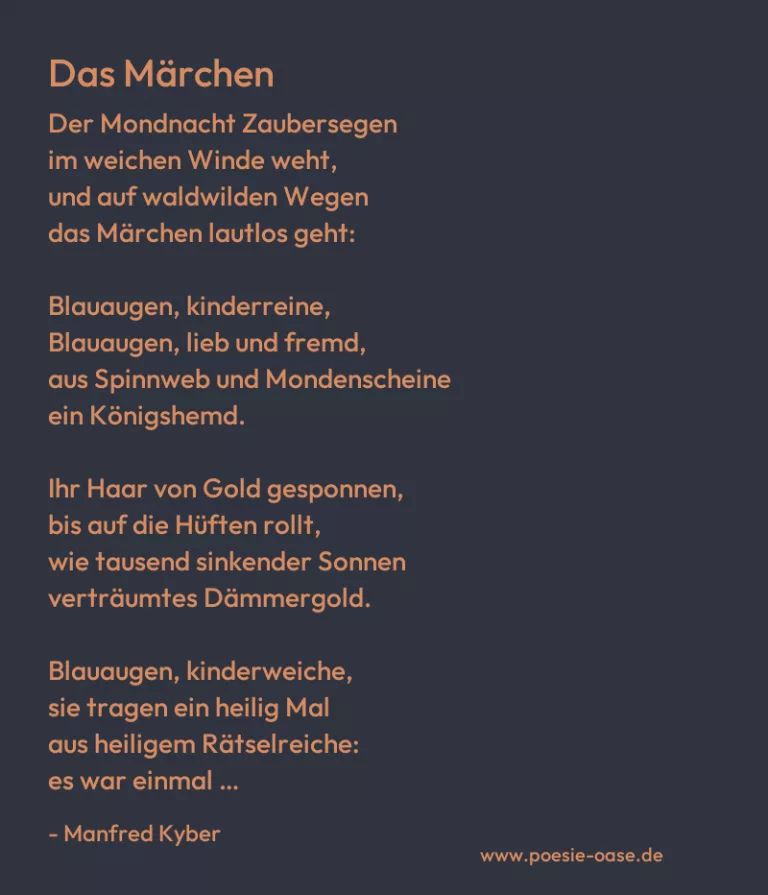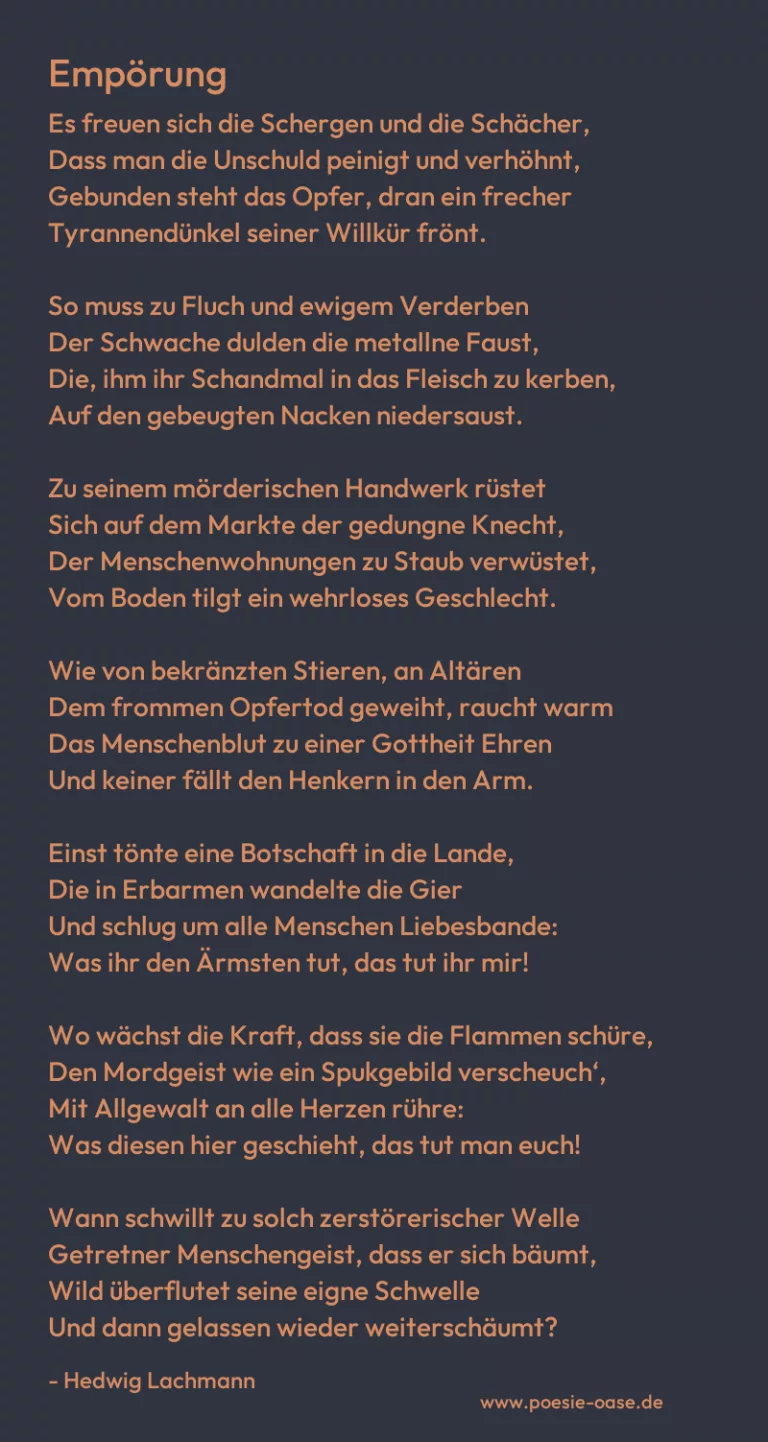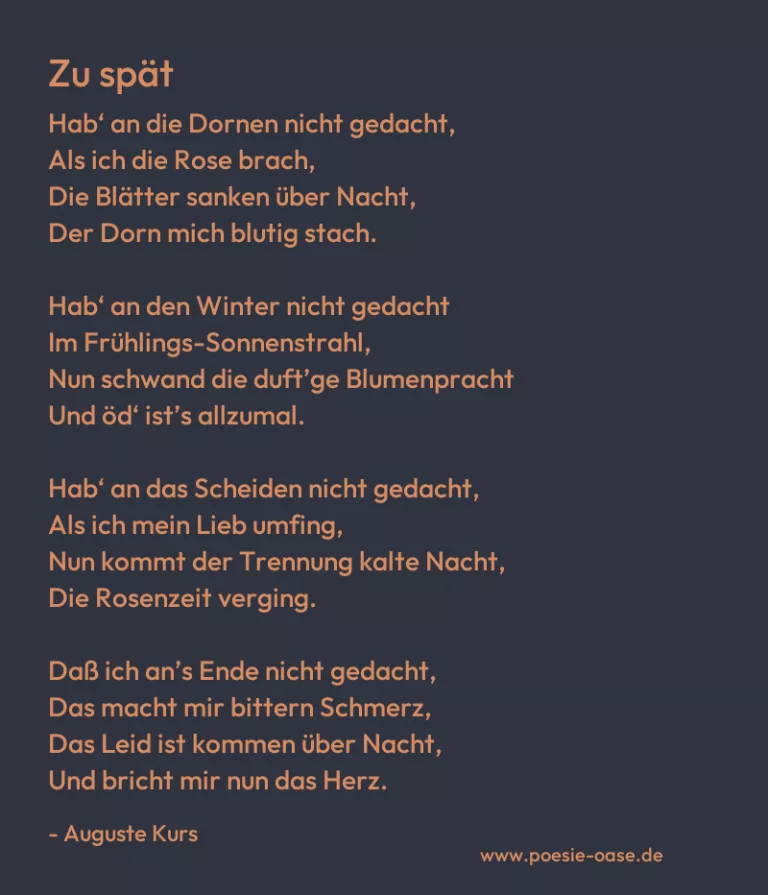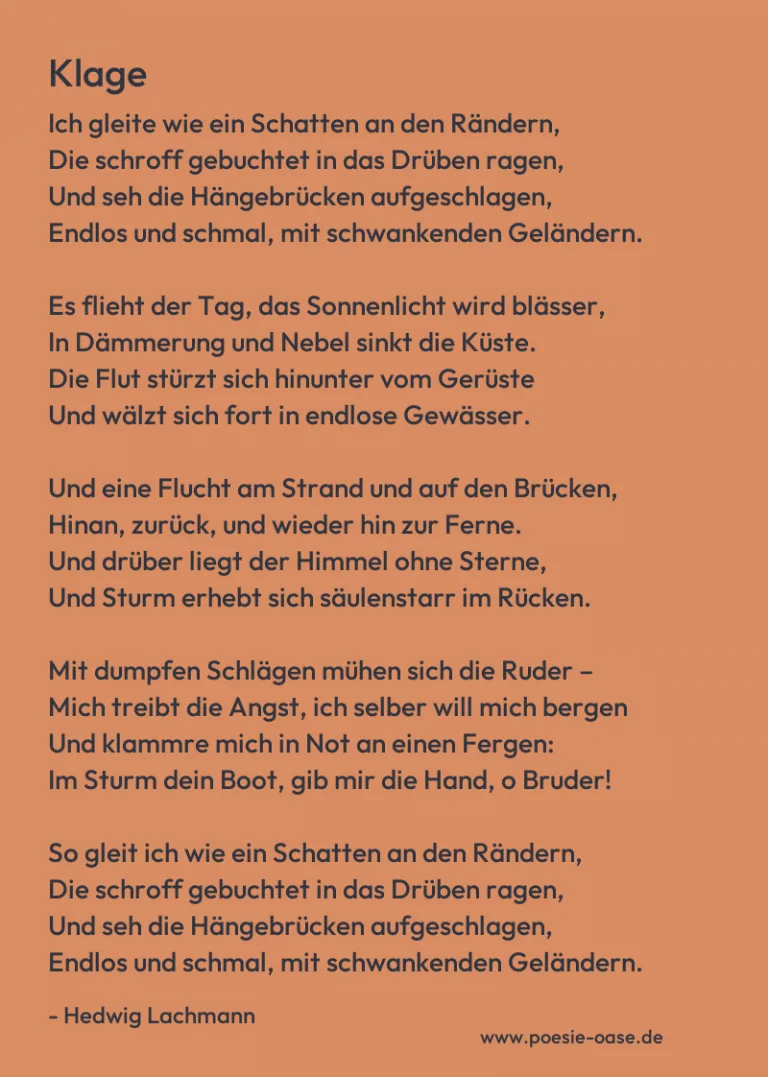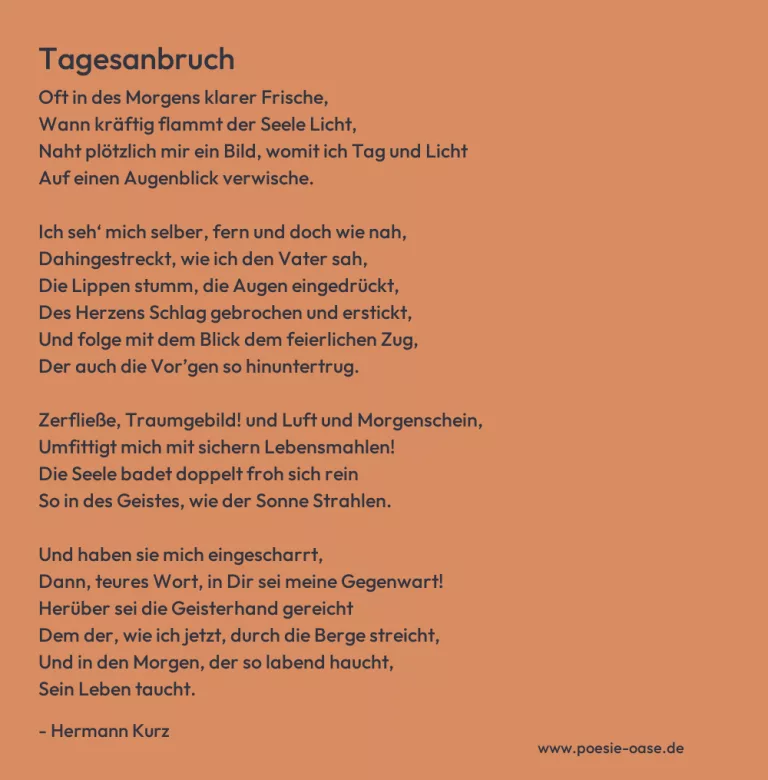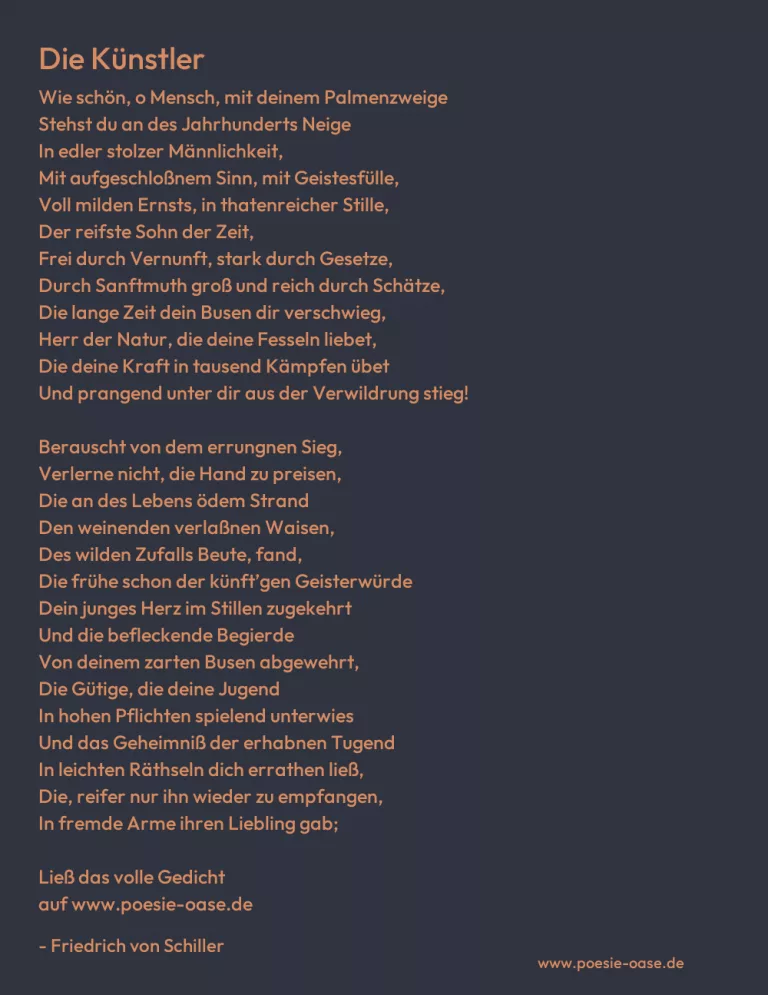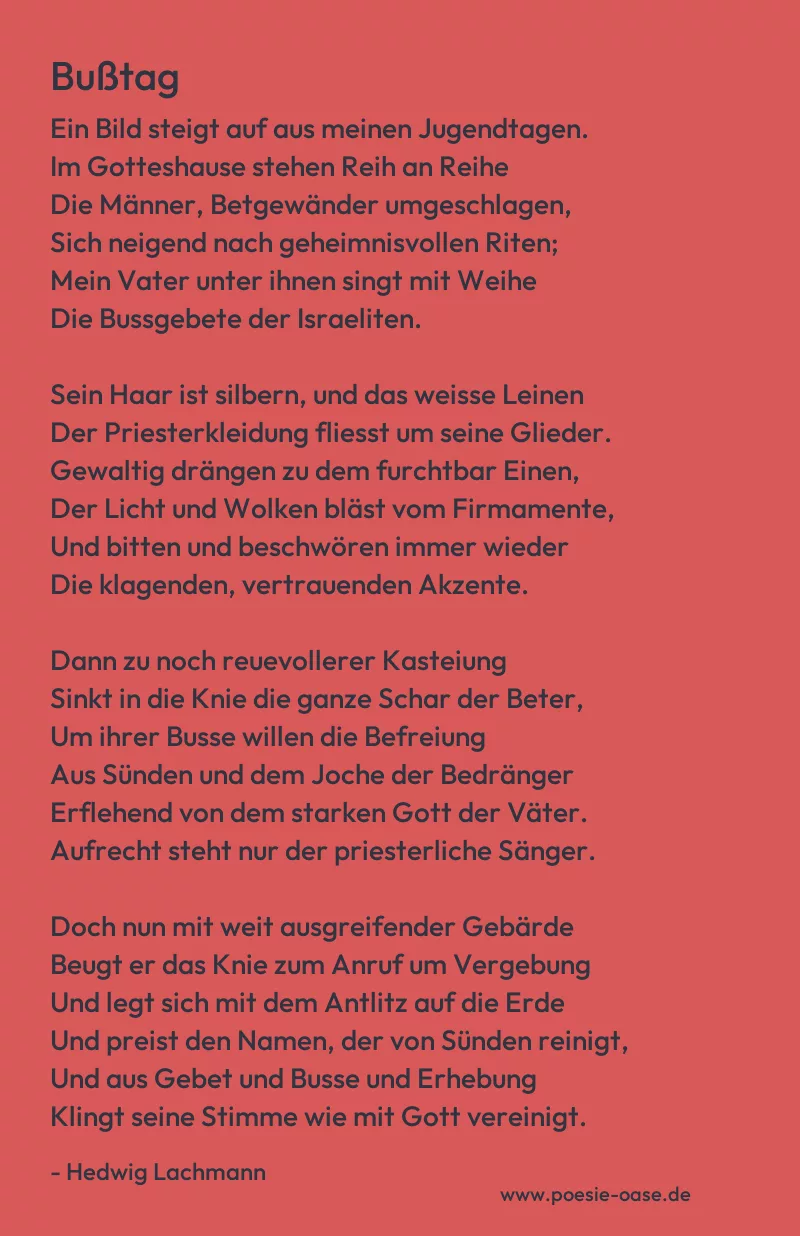Bußtag
Ein Bild steigt auf aus meinen Jugendtagen.
Im Gotteshause stehen Reih an Reihe
Die Männer, Betgewänder umgeschlagen,
Sich neigend nach geheimnisvollen Riten;
Mein Vater unter ihnen singt mit Weihe
Die Bussgebete der Israeliten.
Sein Haar ist silbern, und das weisse Leinen
Der Priesterkleidung fliesst um seine Glieder.
Gewaltig drängen zu dem furchtbar Einen,
Der Licht und Wolken bläst vom Firmamente,
Und bitten und beschwören immer wieder
Die klagenden, vertrauenden Akzente.
Dann zu noch reuevollerer Kasteiung
Sinkt in die Knie die ganze Schar der Beter,
Um ihrer Busse willen die Befreiung
Aus Sünden und dem Joche der Bedränger
Erflehend von dem starken Gott der Väter.
Aufrecht steht nur der priesterliche Sänger.
Doch nun mit weit ausgreifender Gebärde
Beugt er das Knie zum Anruf um Vergebung
Und legt sich mit dem Antlitz auf die Erde
Und preist den Namen, der von Sünden reinigt,
Und aus Gebet und Busse und Erhebung
Klingt seine Stimme wie mit Gott vereinigt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
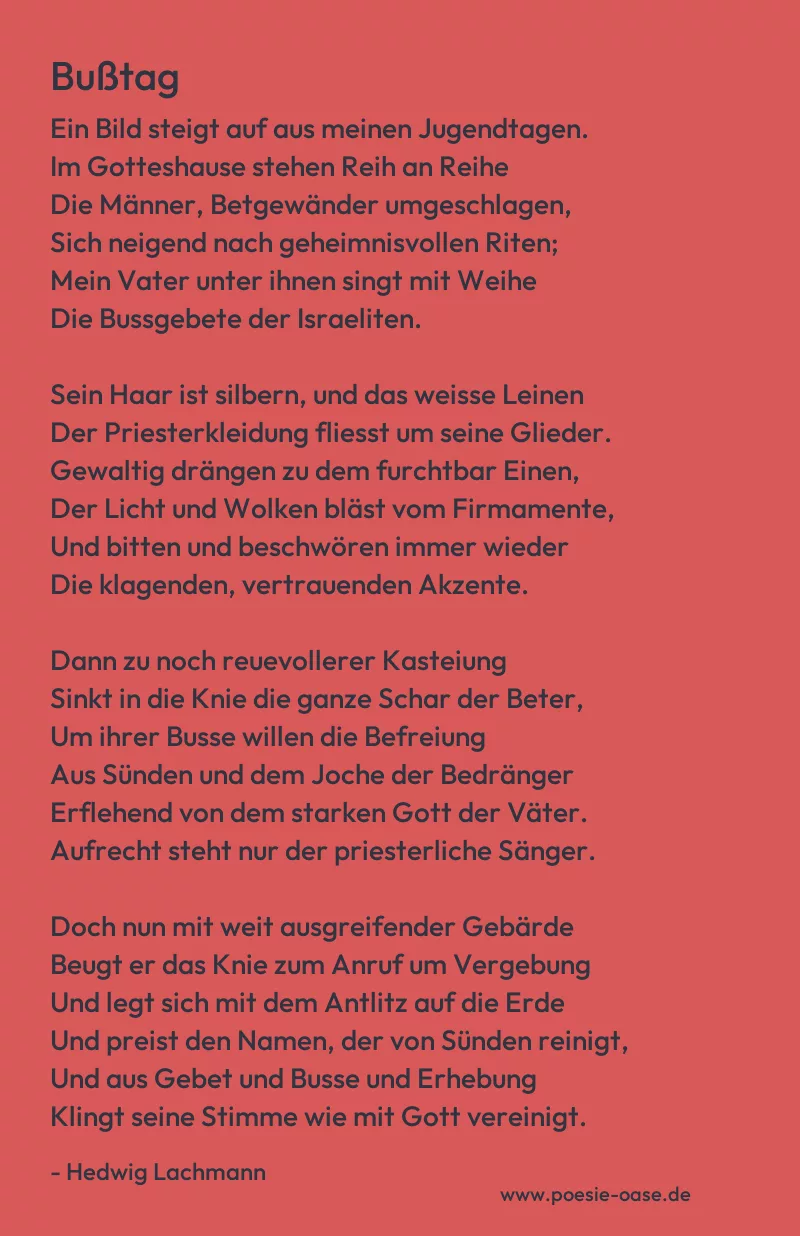
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Bußtag“ von Hedwig Lachmann ist eine eindrucksvolle lyrische Erinnerung an einen jüdischen Gottesdienst, vermutlich am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, der der Reue, Buße und Versöhnung gewidmet ist. Die Sprecherin blickt in ihre Kindheit zurück und erinnert sich an die religiöse Atmosphäre und insbesondere an ihren Vater, der in priesterlicher Funktion an den rituellen Handlungen teilnimmt. Diese Rückerinnerung wird zugleich zur spirituellen Reflexion über Schuld, Reue und göttliche Nähe.
Bereits die ersten Verse erzeugen ein feierliches, ehrfürchtiges Bild: Männer in weißen Betgewändern stehen Reihe an Reihe, vertieft in rituelle Gebete. Der Vater der Sprecherin wird hervorgehoben, nicht nur durch seine Funktion als Vorbeter, sondern durch die Haltung tiefer Weihe, mit der er die Bußgebete der Israeliten vorträgt. Die Beschreibung hat eine fast sakrale Bildhaftigkeit – das „silberne Haar“ und das „weiße Leinen“ verleihen ihm eine würdige, beinahe prophetische Ausstrahlung.
Das Gedicht beschreibt die Liturgie als eine machtvolle Bewegung hin zu einem transzendenten Gott, der „Licht und Wolken bläst vom Firmamente“. Dieses Bild des „furchtbar Einen“ deutet auf die alttestamentarische Vorstellung eines gewaltigen, ehrfurchtgebietenden Gottes hin, zu dem sich die Gemeinschaft in tiefer Demut wendet. Die Sprache changiert zwischen Ehrfurcht, Vertrauen und innerer Erschütterung. Besonders die „klagenden, vertrauenden Akzente“ der Beter betonen die emotionale Tiefe des Rituals.
Im Zentrum des Gedichts steht der Moment der kollektiven Unterwerfung: Die ganze Gemeinde sinkt in die Knie, während der priesterliche Sänger – der Vater – zunächst allein aufrecht bleibt. Diese Differenzierung unterstreicht sowohl seine religiöse Rolle als auch seine geistige Stärke. Doch schließlich beugt auch er das Knie, legt sich mit dem Gesicht zur Erde und vereint sich im Akt der Reue mit der Gemeinschaft. In diesem Moment wird die höchste Form der Hingabe an das Göttliche erreicht.
Im letzten Vers wird die Stimme des Vaters zur Verkörperung des Glaubens selbst. Sie „klingt wie mit Gott vereinigt“, was den Höhepunkt der spirituellen Erfahrung beschreibt: Gebet, Buße und Erhebung verschmelzen zu einem Zustand innerer Reinigung und göttlicher Nähe. Das Gedicht schließt somit mit einer tief empfundenen Vision religiöser Erfüllung – getragen von Erinnerung, Ehrfurcht und einem leisen Staunen über die Kraft des Glaubens.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.