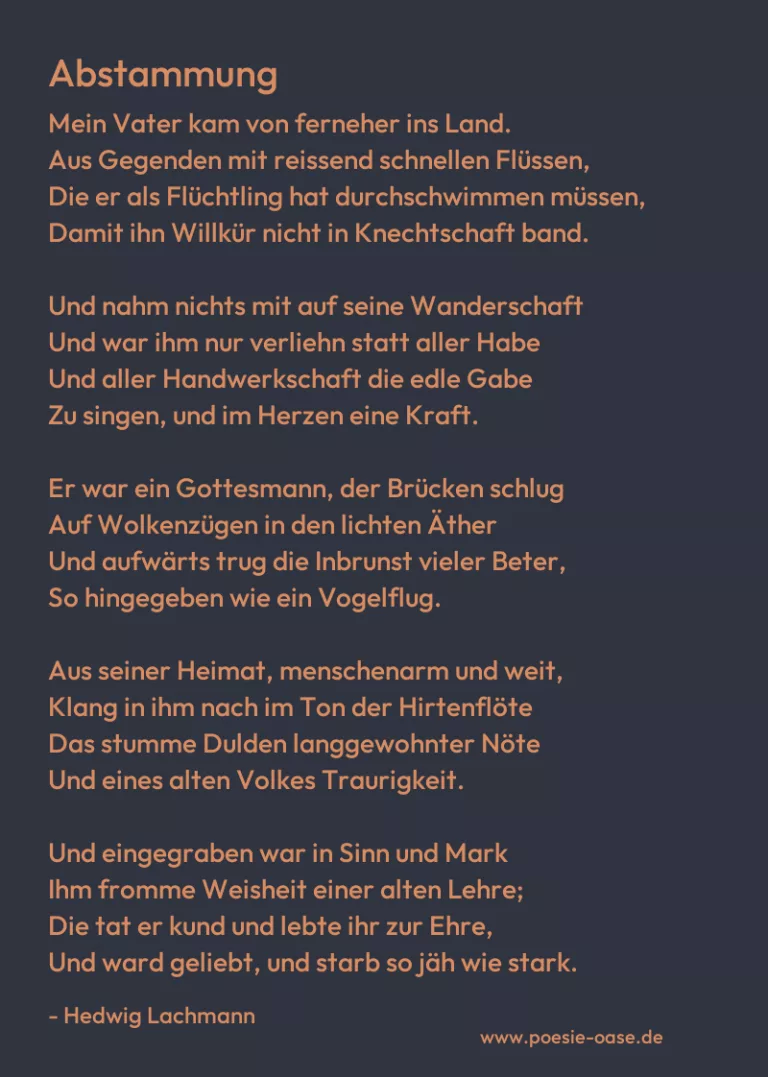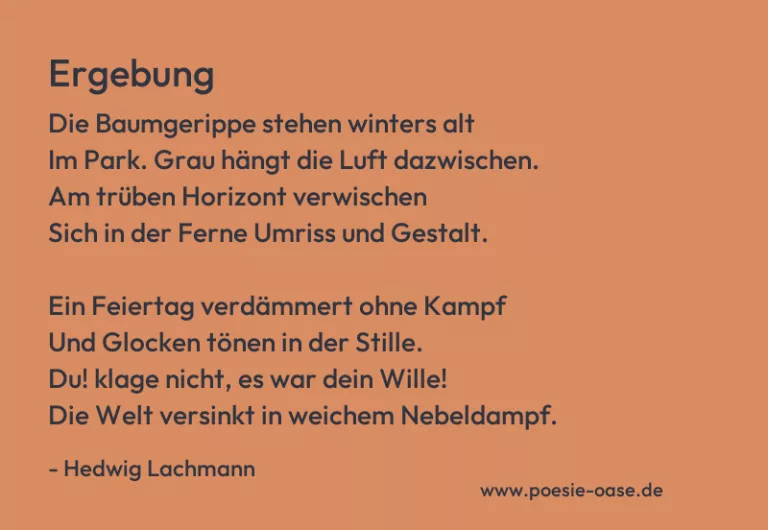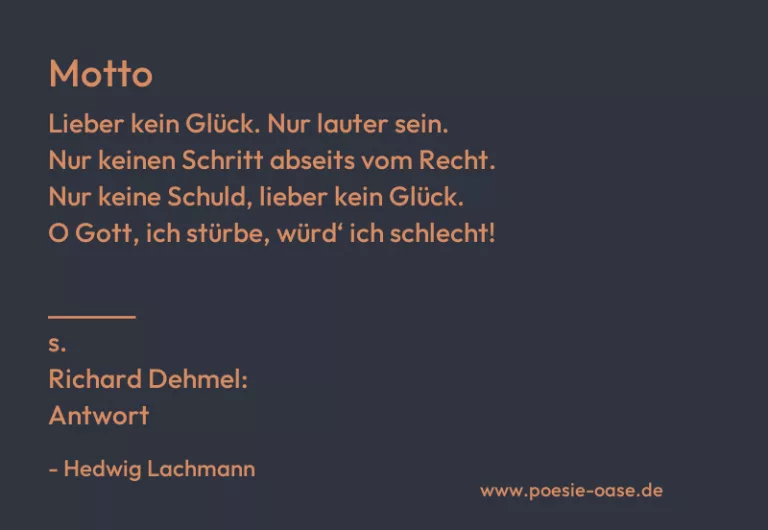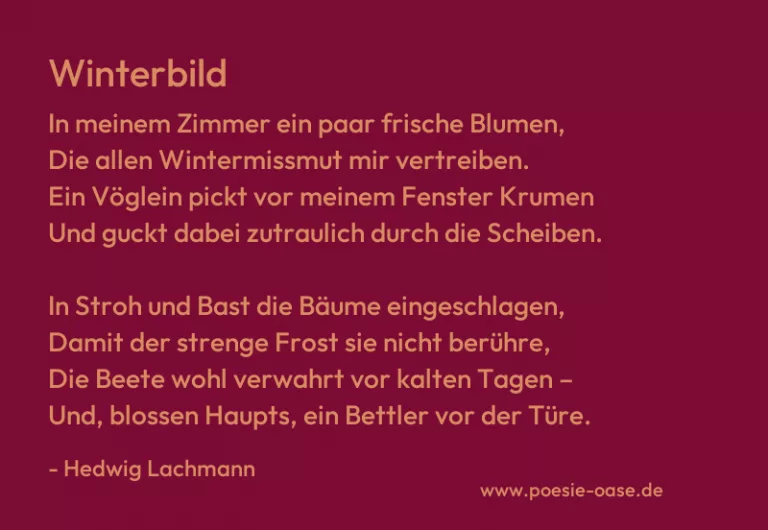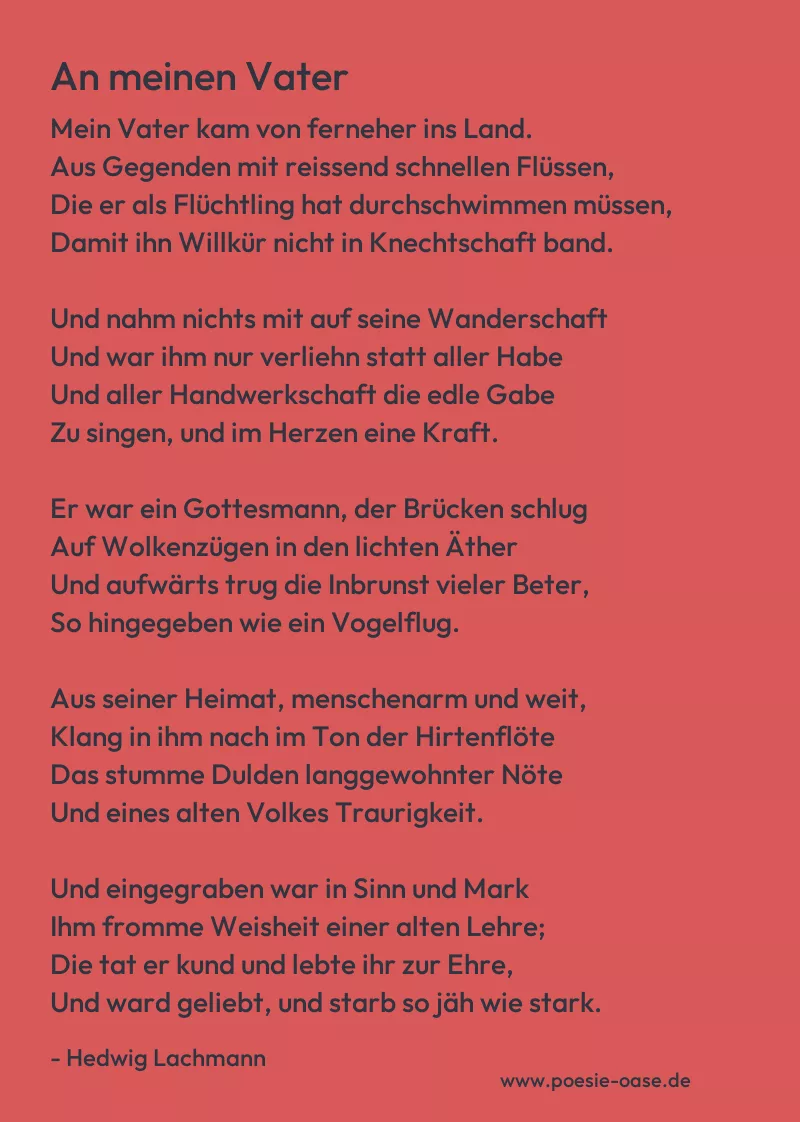An meinen Vater
Mein Vater kam von ferneher ins Land.
Aus Gegenden mit reissend schnellen Flüssen,
Die er als Flüchtling hat durchschwimmen müssen,
Damit ihn Willkür nicht in Knechtschaft band.
Und nahm nichts mit auf seine Wanderschaft
Und war ihm nur verliehn statt aller Habe
Und aller Handwerkschaft die edle Gabe
Zu singen, und im Herzen eine Kraft.
Er war ein Gottesmann, der Brücken schlug
Auf Wolkenzügen in den lichten Äther
Und aufwärts trug die Inbrunst vieler Beter,
So hingegeben wie ein Vogelflug.
Aus seiner Heimat, menschenarm und weit,
Klang in ihm nach im Ton der Hirtenflöte
Das stumme Dulden langgewohnter Nöte
Und eines alten Volkes Traurigkeit.
Und eingegraben war in Sinn und Mark
Ihm fromme Weisheit einer alten Lehre;
Die tat er kund und lebte ihr zur Ehre,
Und ward geliebt, und starb so jäh wie stark.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
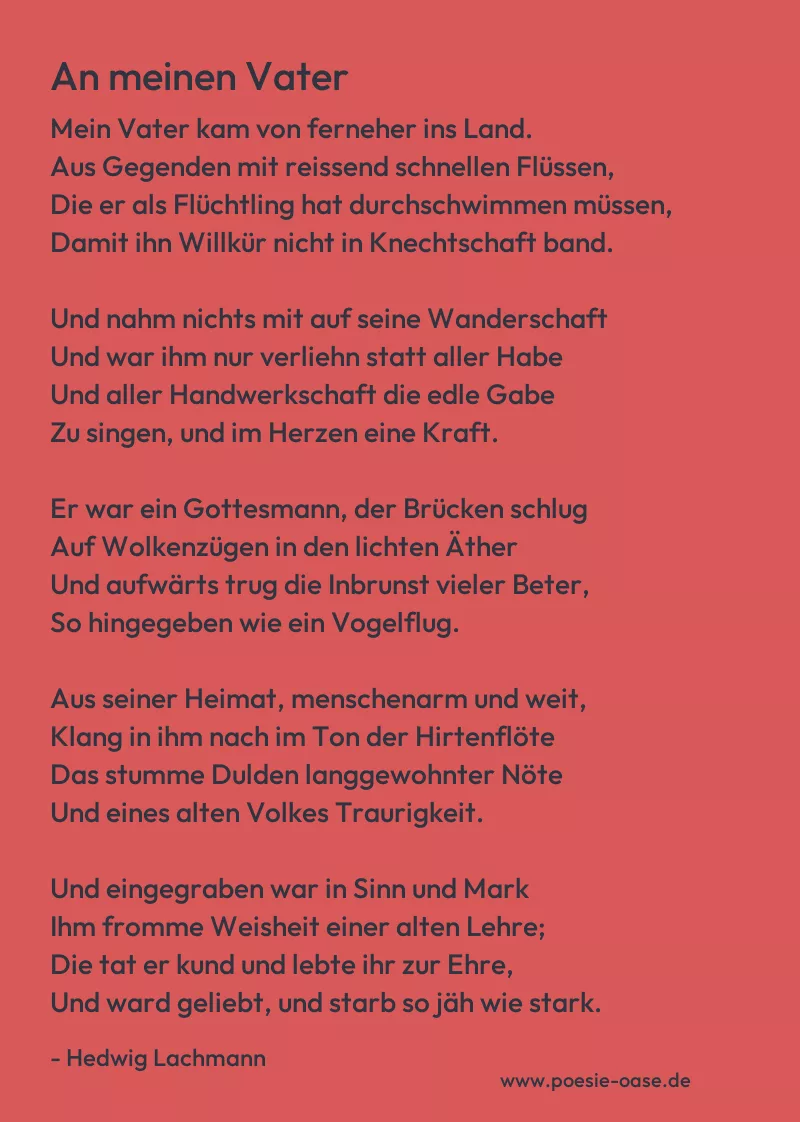
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An meinen Vater“ von Hedwig Lachmann reflektiert über das Leben des Vaters der Sprecherin, der als Flüchtling in ein neues Land kam und trotz seines entbehrungsreichen Lebens eine innere Stärke und Weisheit bewahrte. Zu Beginn beschreibt die Dichterin den Vater als jemanden, der aus „ferneher“ kam, aus einer Region mit „reissend schnellen Flüssen“, was sowohl die geografische Entfernung als auch die schwierigen Umstände seiner Flucht symbolisiert. Die „Willkür“, die ihn verfolgt, und die Notwendigkeit, die Flüsse zu durchschwimmen, verdeutlichen die Gefahren und die Notwendigkeit, dem Unrecht zu entkommen.
In der zweiten Strophe wird der Vater als ein Mann dargestellt, der in seiner Wanderschaft auf jeglichen Besitz verzichtet hat, aber eine „edle Gabe“ erhielt: das Singen und eine „Kraft“ im Herzen. Diese Gaben sind sein einziger Besitz, aber sie verleihen ihm eine einzigartige Würde und innere Stärke. Das Bild des Gesangs und der „Kraft“ deutet darauf hin, dass der Vater seine spirituelle und seelische Stärke aus seiner Fähigkeit zur Hingabe und zu einem tiefen Glauben schöpfte.
Die dritte Strophe beschreibt den Vater als „Gottesmann“, der in der Lage ist, „Brücken zu schlagen“ und die Inbrunst der Gläubigen in den „lichten Äther“ zu tragen. Das Bild des Vogelflugs, das in seiner „Inbrunst“ dargestellt wird, symbolisiert eine spirituelle Erhebung und Hingabe, die weit über das Alltägliche hinausgeht. Der Vater lebt in Einklang mit einem höheren Ziel, das ihn trägt und ihm die Fähigkeit gibt, anderen Trost zu spenden.
Die vierte Strophe stellt den Vater als einen Menschen dar, dessen Herkunft von „menschenarmen“ und „weiten“ Regionen geprägt ist. Das „stumme Dulden“ und die „Traurigkeit“ eines alten Volkes klingen in ihm nach, was auf die Erfahrungen von Leid und Entbehrung anspielt, die er in seiner Heimat durchlebte. Dennoch gibt er diese Erfahrungen nicht auf, sondern bewahrt sie in sich, was seine tiefe Weisheit und Empathie für die Not der anderen unterstreicht.
In der letzten Strophe wird das Leben des Vaters als eines voller Hingabe und Weisheit beschrieben. Die „fromme Weisheit“ einer alten Lehre prägt sein Denken und Handeln, und er lebt nach diesen Prinzipien, was ihm Liebe und Respekt einbringt. Sein plötzlicher Tod – „so jäh wie stark“ – wird als eine kraftvolle und vollendete Lebensweise dargestellt, die im Einklang mit seinem inneren Glauben und seiner Lebensphilosophie stand.
Das Gedicht schildert das Leben des Vaters als einen Ausdruck von Stärke, Hingabe und Weisheit. Trotz seiner Herkunft aus schwierigen Verhältnissen bewahrte er eine tiefe Spiritualität und Empathie, die ihm halfen, sowohl in seinem eigenen Leben als auch im Leben der anderen eine tiefere Bedeutung zu finden. Der Vater wird als ein Vorbild der inneren Stärke und des Glaubens dargestellt, dessen Leben und Tod im Einklang mit den höheren Werten stand, die er verkörperte.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.