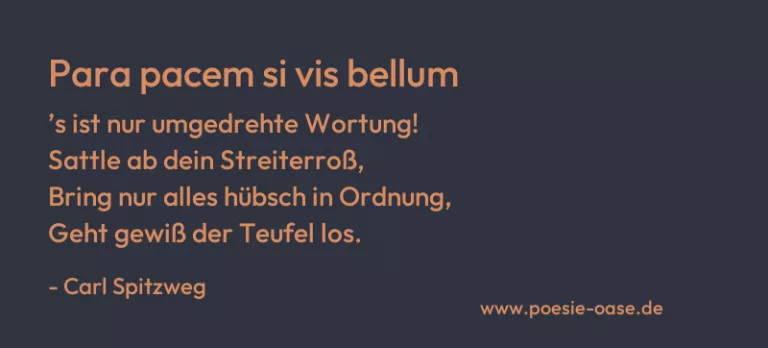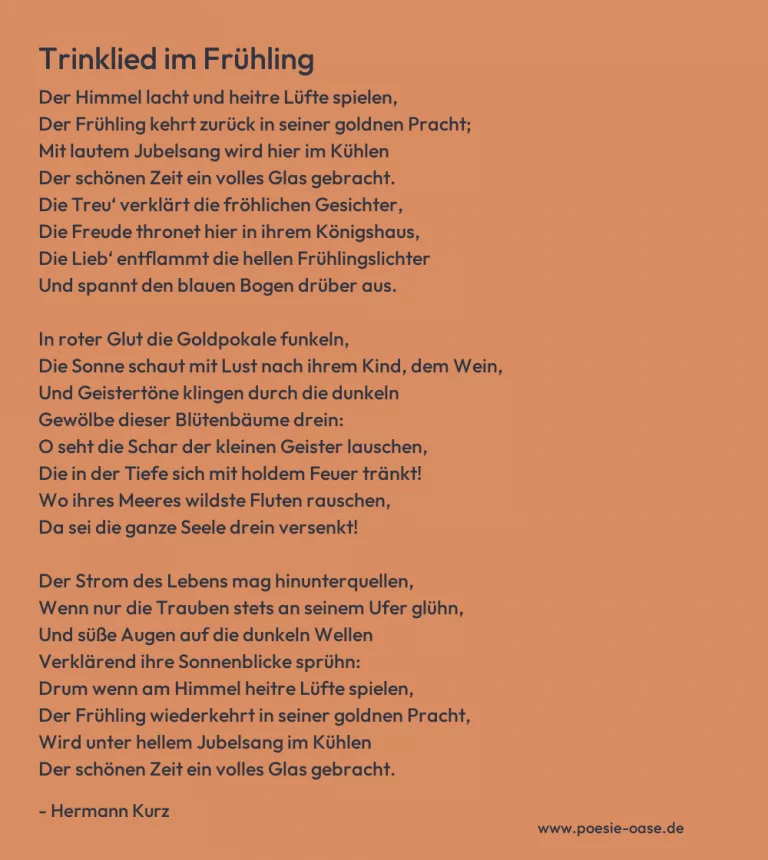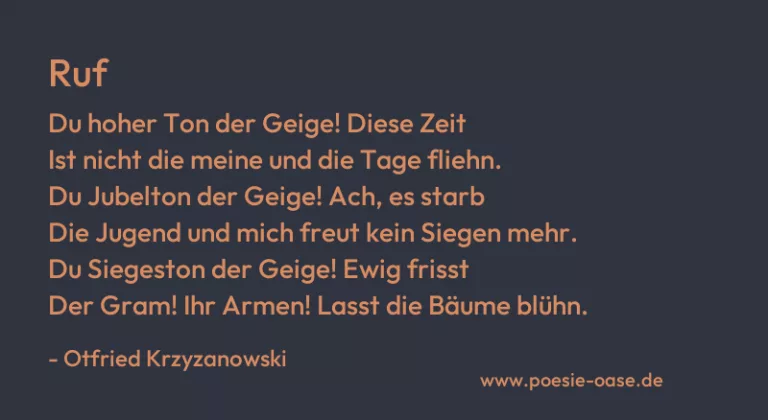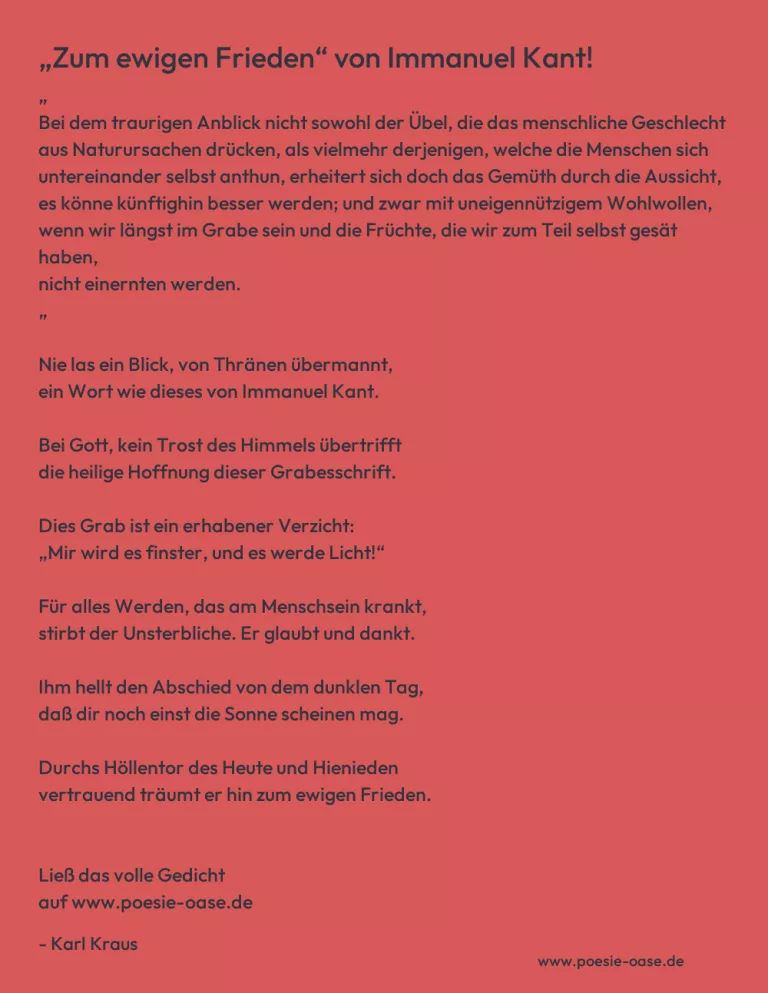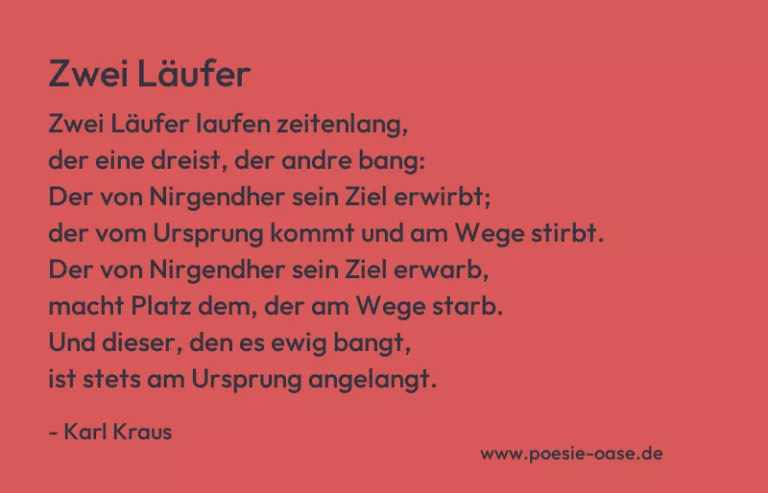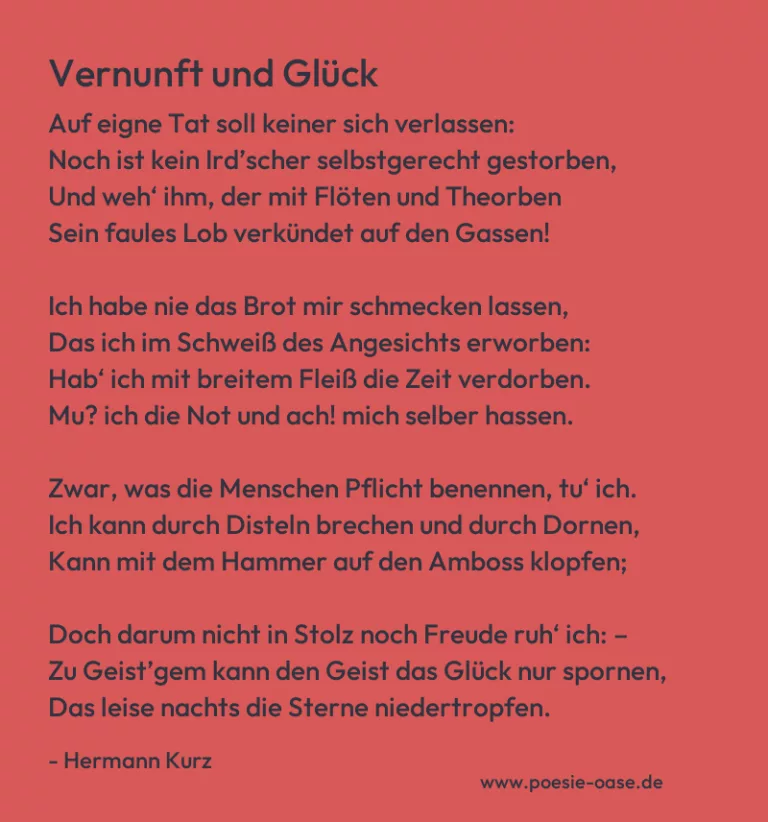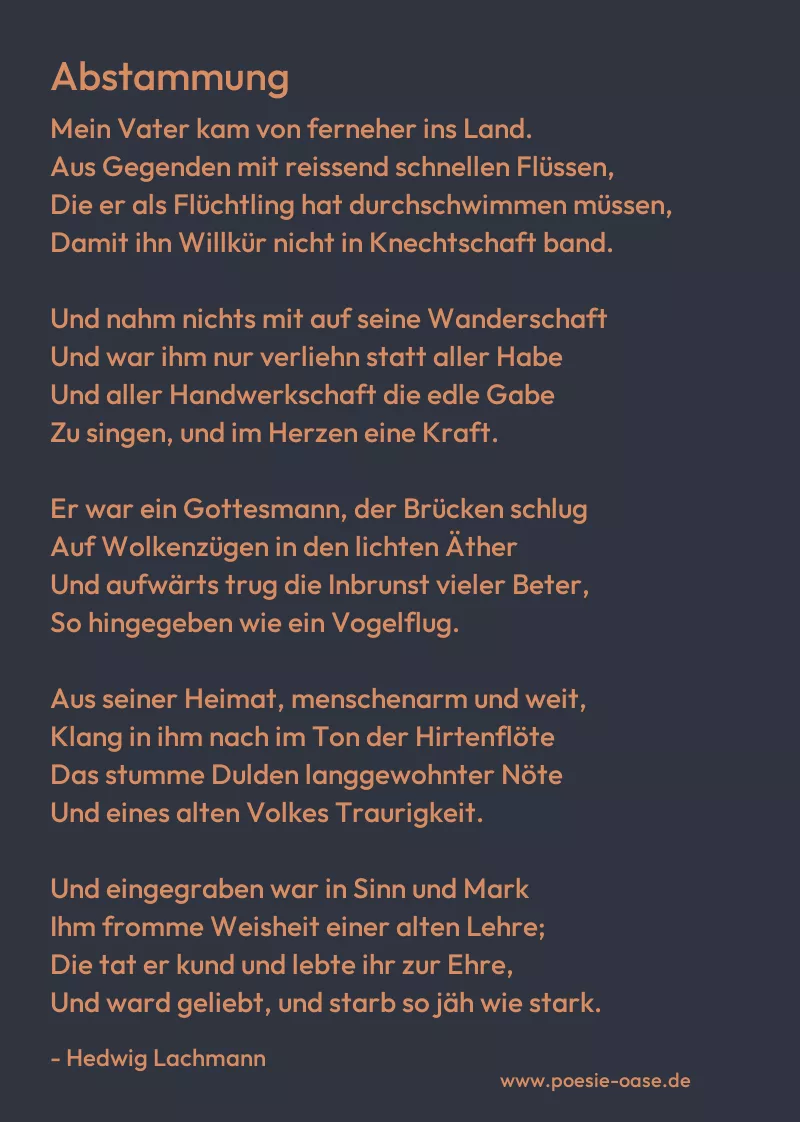Abstammung
Mein Vater kam von ferneher ins Land.
Aus Gegenden mit reissend schnellen Flüssen,
Die er als Flüchtling hat durchschwimmen müssen,
Damit ihn Willkür nicht in Knechtschaft band.
Und nahm nichts mit auf seine Wanderschaft
Und war ihm nur verliehn statt aller Habe
Und aller Handwerkschaft die edle Gabe
Zu singen, und im Herzen eine Kraft.
Er war ein Gottesmann, der Brücken schlug
Auf Wolkenzügen in den lichten Äther
Und aufwärts trug die Inbrunst vieler Beter,
So hingegeben wie ein Vogelflug.
Aus seiner Heimat, menschenarm und weit,
Klang in ihm nach im Ton der Hirtenflöte
Das stumme Dulden langgewohnter Nöte
Und eines alten Volkes Traurigkeit.
Und eingegraben war in Sinn und Mark
Ihm fromme Weisheit einer alten Lehre;
Die tat er kund und lebte ihr zur Ehre,
Und ward geliebt, und starb so jäh wie stark.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
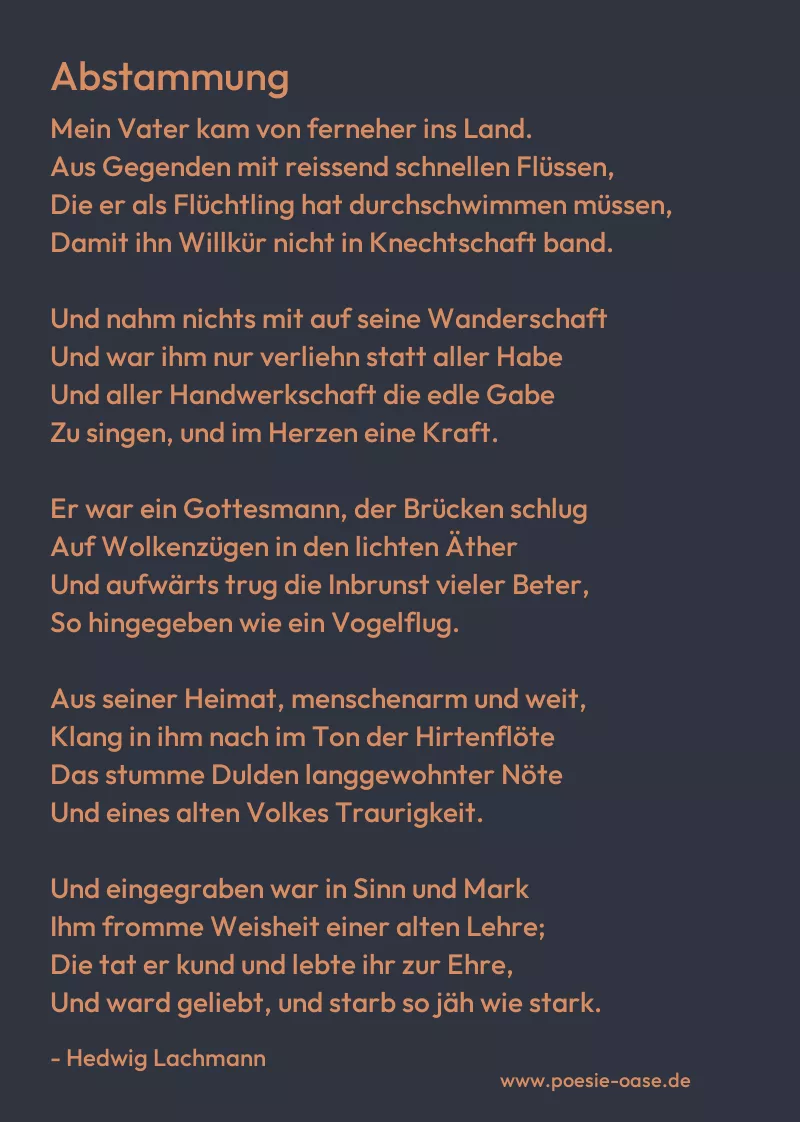
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Abstammung“ von Hedwig Lachmann beschreibt die Herkunft des Vaters der Sprecherin und stellt eine poetische Erzählung über seine Vergangenheit und seine innere Stärke dar. Zu Beginn erfahren wir, dass der Vater aus einem fremden Land stammt, das von „reißend schnellen Flüssen“ geprägt ist – eine symbolische Darstellung für ein Land voller Gefahren und Herausforderungen. Als „Flüchtling“ hat der Vater die harte Erfahrung gemacht, aus seiner Heimat zu entkommen, um der „Willkür“ zu entfliehen. Diese Zeilen thematisieren die Gewalt und die Drangsal, die der Vater durchleben musste, um seine Freiheit zu bewahren.
Der Vater trägt „nichts mit auf seine Wanderschaft“, was darauf hindeutet, dass er all seine weltlichen Besitztümer hinter sich ließ. Anstatt materieller Werte erhielt er jedoch eine „edle Gabe“: die Fähigkeit zu singen und eine innere „Kraft“. Diese Gabe könnte als Symbol für seine geistige und spirituelle Stärke verstanden werden, die ihm auf seiner Reise half. Die Musik, dargestellt durch das Singen, wird hier als ein Ausdruck der spirituellen und emotionalen Erhebung des Vaters gezeigt. Der Vater wird als „Gottesmann“ beschrieben, ein Mensch, der mit Hingabe und Inbrunst den Glauben lebt und in seiner Mission Brücken schlägt – sowohl im wörtlichen als auch im metaphorischen Sinne.
Das Bild des „Vogelflugs“ verstärkt die Vorstellung von Freiheit und geistiger Erhebung. Der Vater wird als jemand dargestellt, der sich über das Irdische hinaushebt und von einer höheren Kraft getragen wird. Diese Metaphern – „Brücken schlagen“, „Wolkenzüge“, „Vogelflug“ – verweisen auf die spirituelle Mission des Vaters, der über den physischen Zustand hinausgeht und eine höhere, edlere Aufgabe verfolgt. Es wird betont, dass seine innere Inbrunst und Hingabe auch die Herzen der Menschen berührten.
Die Herkunft des Vaters, die von „menschenarmen“ und „weiten“ Gegenden geprägt ist, sowie der Klang der „Hirtenflöte“ symbolisieren eine Verbindung zur Natur, zu alten Traditionen und zu einer tiefen Weisheit, die durch „Dulden“ und „Traurigkeit“ geprägt ist. Diese Weisheit, die er von seiner Heimat mitnahm, ist in ihm „eingegraben“ und prägt ihn sowohl in seinem Denken als auch in seinem Handeln. Der Vater lebte in Übereinstimmung mit dieser Weisheit und tat sie „kund“, was bedeutet, dass er sie sowohl durch seine Worte als auch durch sein Beispiel weitergab.
Das Gedicht endet mit der Darstellung des Vaters als einer starken und zugleich verletzlichen Figur. Er wurde von der Gemeinschaft „geliebt“ und starb auf eine Weise, die sowohl plötzlich als auch kraftvoll war – „so jäh wie stark“. Der Tod des Vaters, der in seiner Stärke und seiner Weisheit verehrt wurde, wird hier als ein unvermeidlicher, aber respektierter Abschluss seines Lebensweges dargestellt, der in der Erinnerung weiterlebt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.