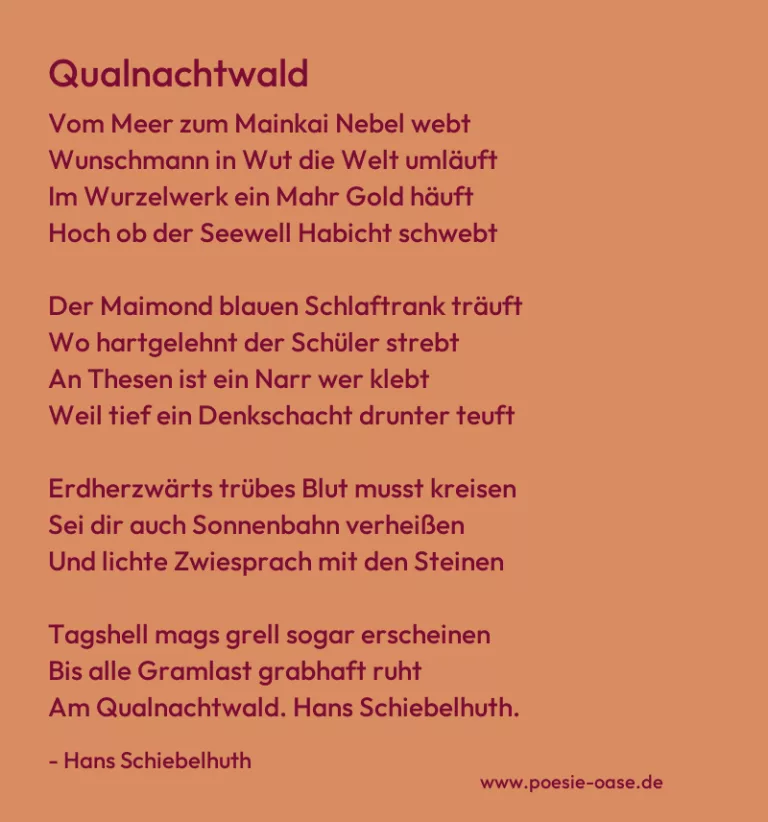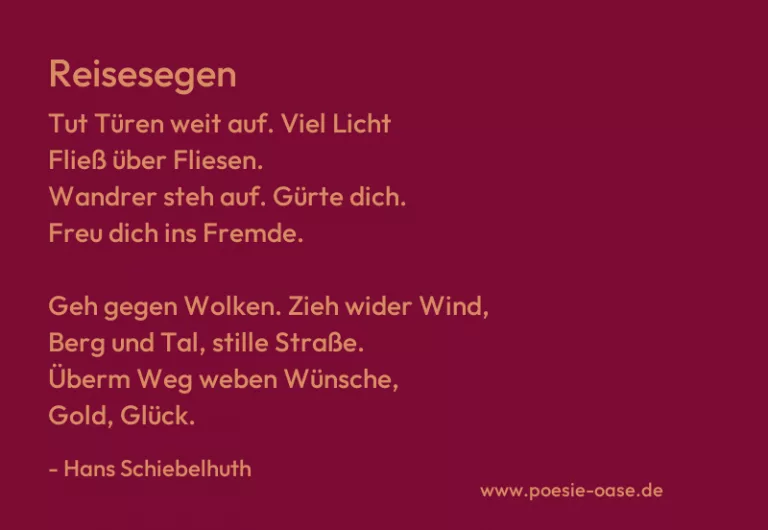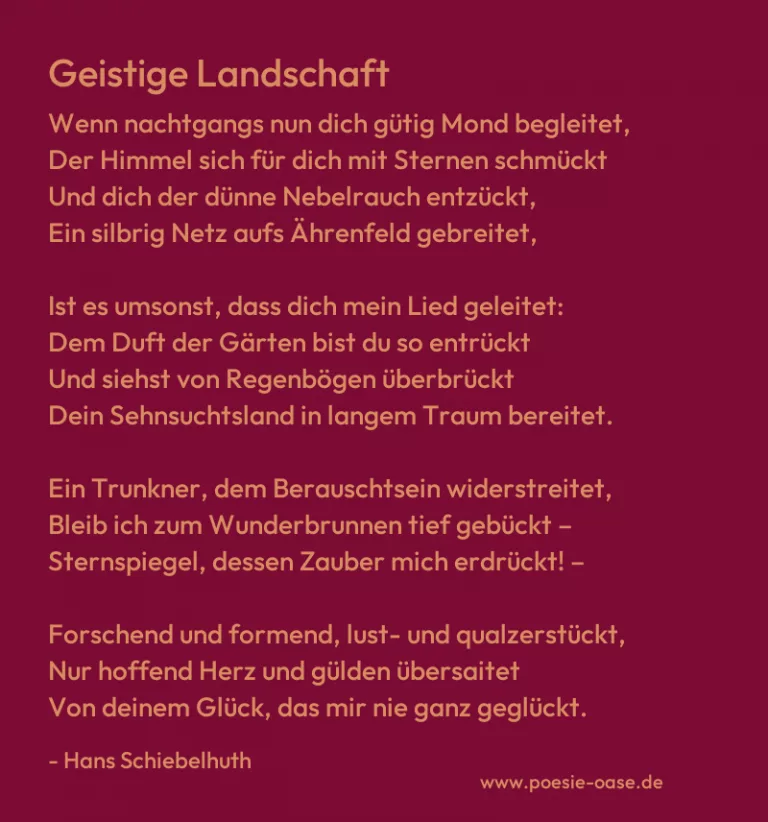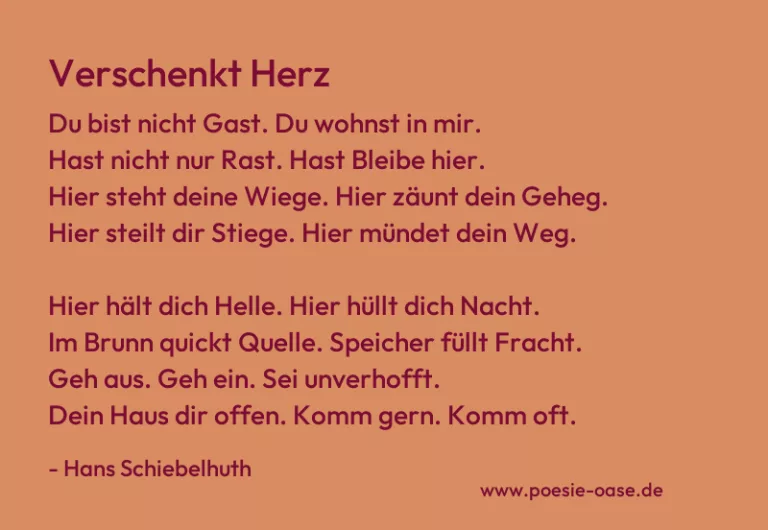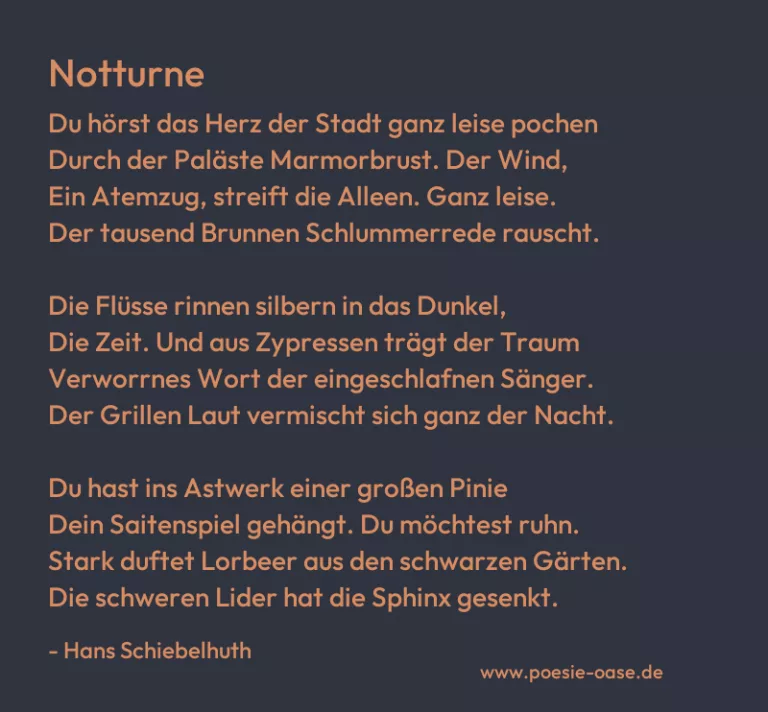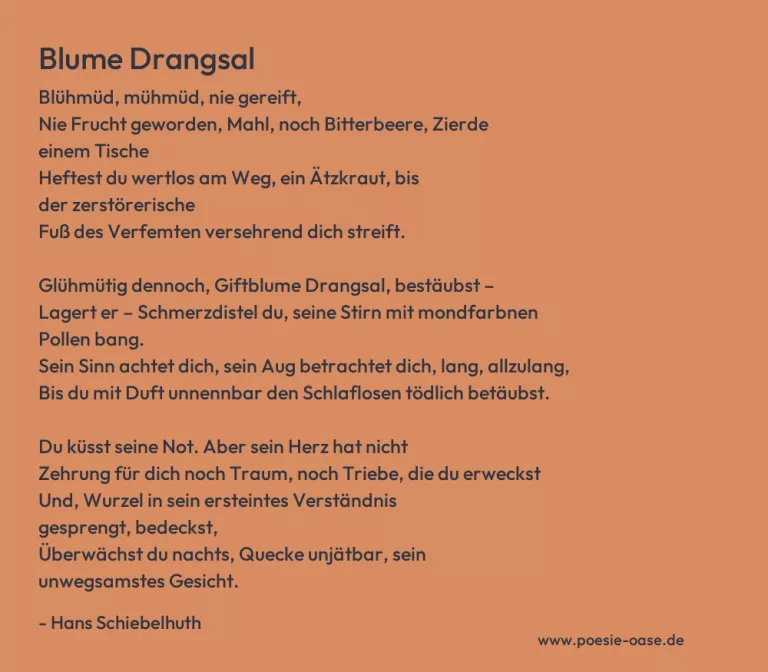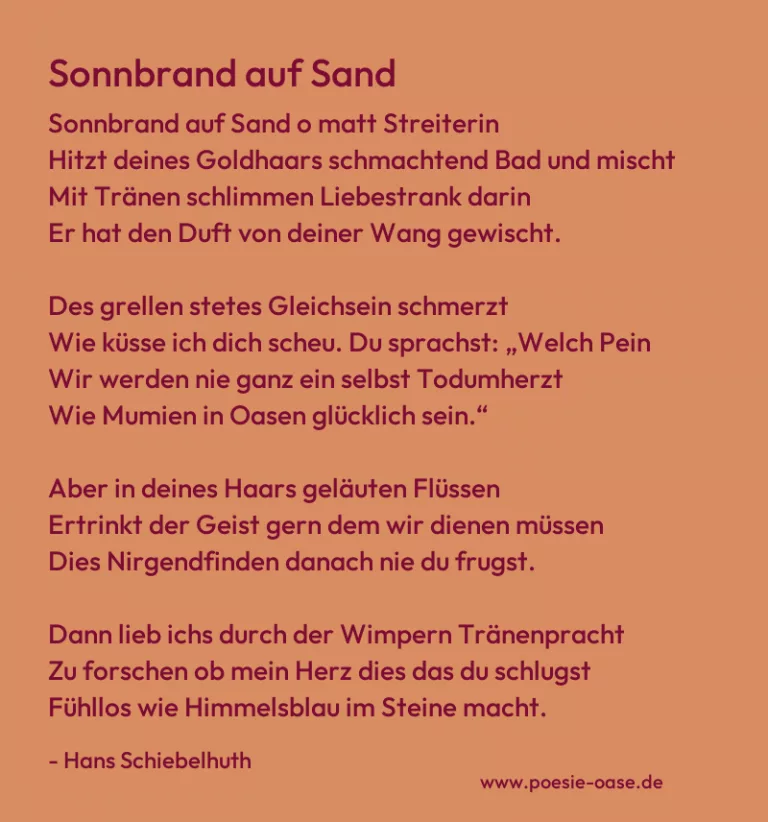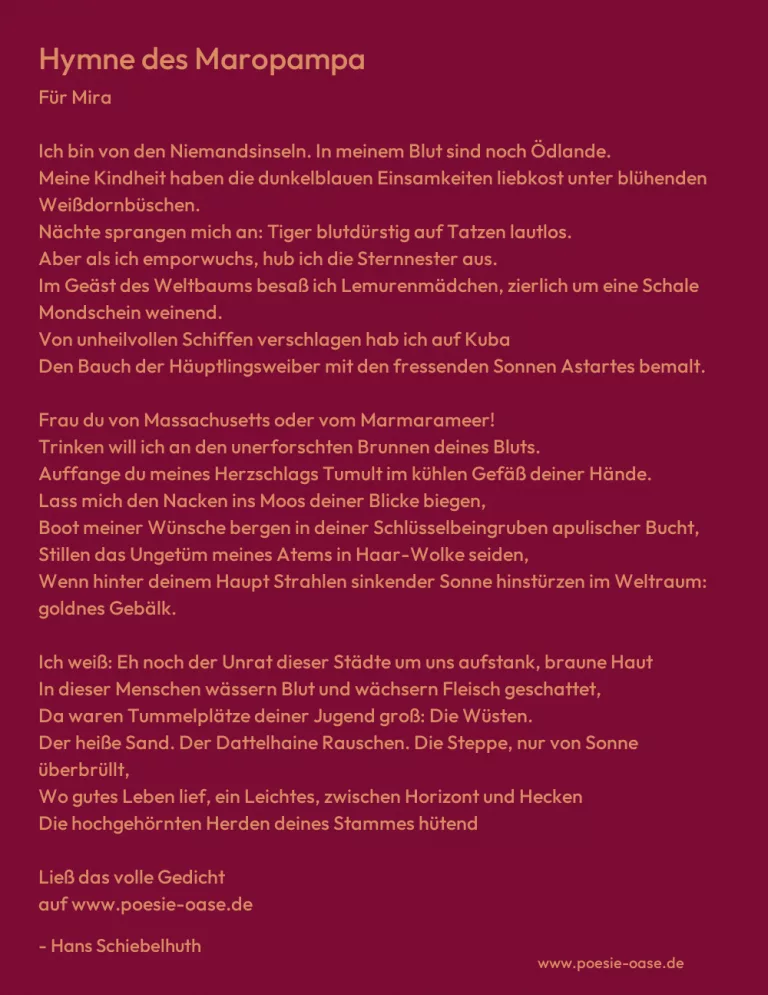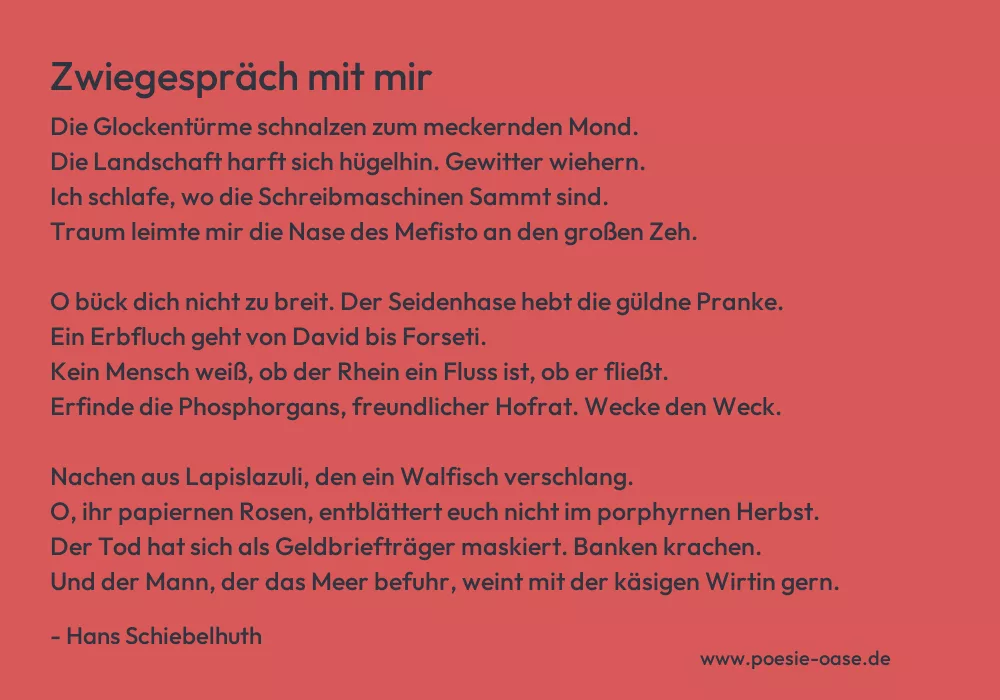Zwiegespräch mit mir
Die Glockentürme schnalzen zum meckernden Mond.
Die Landschaft harft sich hügelhin. Gewitter wiehern.
Ich schlafe, wo die Schreibmaschinen Sammt sind.
Traum leimte mir die Nase des Mefisto an den großen Zeh.
O bück dich nicht zu breit. Der Seidenhase hebt die güldne Pranke.
Ein Erbfluch geht von David bis Forseti.
Kein Mensch weiß, ob der Rhein ein Fluss ist, ob er fließt.
Erfinde die Phosphorgans, freundlicher Hofrat. Wecke den Weck.
Nachen aus Lapislazuli, den ein Walfisch verschlang.
O, ihr papiernen Rosen, entblättert euch nicht im porphyrnen Herbst.
Der Tod hat sich als Geldbriefträger maskiert. Banken krachen.
Und der Mann, der das Meer befuhr, weint mit der käsigen Wirtin gern.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
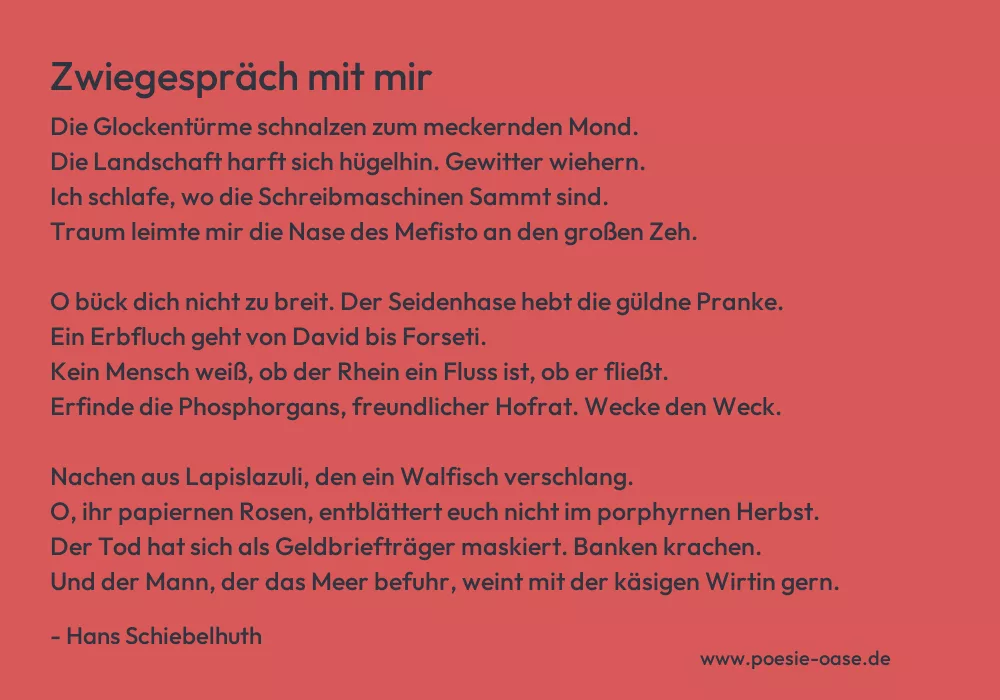
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Zwiegespräch mit mir“ von Hans Schiebelhuth ist eine surreale, dichte und teilweise absurde Reflexion über den Zustand der Welt und des Individuums. Es beginnt mit einer bildhaften und klangvollen Szene: „Die Glockentürme schnalzen zum meckernden Mond“, was eine nahezu chaotische Stimmung von Unruhe und Entfremdung erzeugt. Die „Glockentürme“ und der „meckernde Mond“ vermitteln ein Bild von Zerstreuung und einer Art von unharmonischer Kommunikation zwischen den symbolischen Elementen der Welt. Die „Landschaft“ selbst „harft sich hügelhin“, ein Bild von Unebenheit und vielleicht auch von einem Fortschreiten, das von Hindernissen oder Abweichungen geprägt ist.
In der zweiten Zeile des Gedichts, „Gewitter wiehern“, wird die Atmosphäre weiter verdichtet. Gewitter, ein typisches Naturphänomen, das oft mit Chaos und Zerstörung assoziiert wird, wird hier mit „wiehern“ verbunden – ein für Gewitter ungewöhnliches, fast anachronistisches Bild. Die ungewöhnlichen, surrealen Bilder setzen sich fort, als das lyrische Ich von einem Traum spricht, der ihm die „Nase des Mefisto an den großen Zeh“ „leimte“. Diese Darstellung von Mefisto, einer Figur des Teufels oder der Versuchung, in einem so intimen Kontext, ist eine Mischung aus Verführung und Bedrohung, die die Traumwelt des Ichs in eine dunkle, symbolische Ebene führt.
Die Zeile „O bück dich nicht zu breit. Der Seidenhase hebt die güldne Pranke“ kombiniert surrealistische Elemente, die der Leser schwerlich in einen zusammenhängenden Kontext setzen kann. Der „Seidenhase“ ist eine fast kindliche, märchenhafte Figur, die jedoch auch eine gewisse Bedrohung durch die „güldne Pranke“ ausstrahlt – ein Bild, das Unschuld und Gefahr zugleich symbolisiert. In der nächsten Zeile taucht das Bild eines „Erbfluchs“ auf, der von „David bis Forseti“ geht, was möglicherweise auf eine alte, überlieferte Schuld oder einen Fluch anspielt, der über verschiedene Generationen oder Figuren hinweg weitergegeben wird.
Der Satz „Kein Mensch weiß, ob der Rhein ein Fluss ist, ob er fließt“ führt den Gedanken weiter, indem er mit einer Frage spielt, die die fundamentalen Wahrheiten und Überzeugungen hinterfragt. Der Rhein, traditionell als einer der bedeutendsten Flüsse in Europa betrachtet, wird hier zu einer Frage der Wahrnehmung und Realität, was die Surrealität des Gedichts weiter verstärkt. Die darauffolgende Zeile fordert den „freundlicher Hofrat“ auf, „die Phosphorgans zu erfinden“, was einen weiteren surrealen Moment schafft und den wissenschaftlichen, rationalen Ansatz in Frage stellt.
Die letzten Zeilen des Gedichts entfalten ein Bild von mystischen und symbolischen Assoziationen. Die „Nachen aus Lapislazuli“, die von einem „Walfisch verschlungen“ werden, wirken wie ein alchemistisches Bild, das Mythologie und Materialismus miteinander verbindet. Die „papiernen Rosen“ und der „porphyrne Herbst“ spielen mit der Vorstellung von Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit, während der Tod, der sich als „Geldbriefträger maskiert“, eine bitterböse Satire auf die Entfremdung und die Entwertung von Leben und Tod in einer von ökonomischen Kräften beherrschten Welt darstellt. Die „Banken“, die „krachen“, und der Mann, der „mit der käsigen Wirtin weint“, sind Ausdruck einer gewissen Tragik, die sich im Alltäglichen und scheinbar Banalen versteckt.
Schiebelhuths „Zwiegespräch mit mir“ ist ein Gedicht voller surrealer Bilder, die mit Verwirrung, Absurdität und Kritik an der modernen Welt spielen. Die seltsamen und teils schockierenden Bilder stellen eine Herausforderung für die Interpretationen des Lesers dar und zwingen ihn, über die tieferliegende Bedeutung der Worte und Symbole nachzudenken. In der Gesamtheit bleibt das Gedicht eine Meditation über das Unverständliche und das Paradoxe im Leben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.