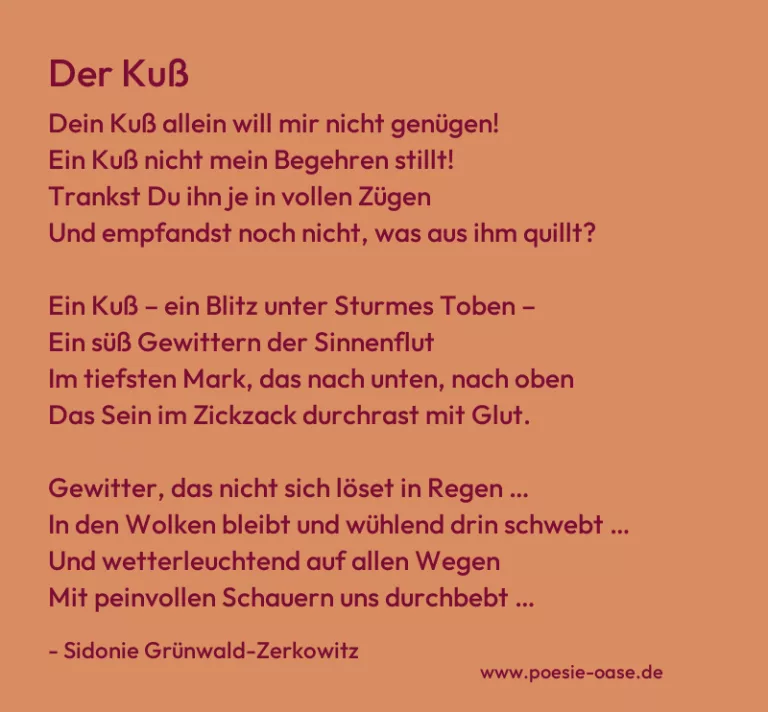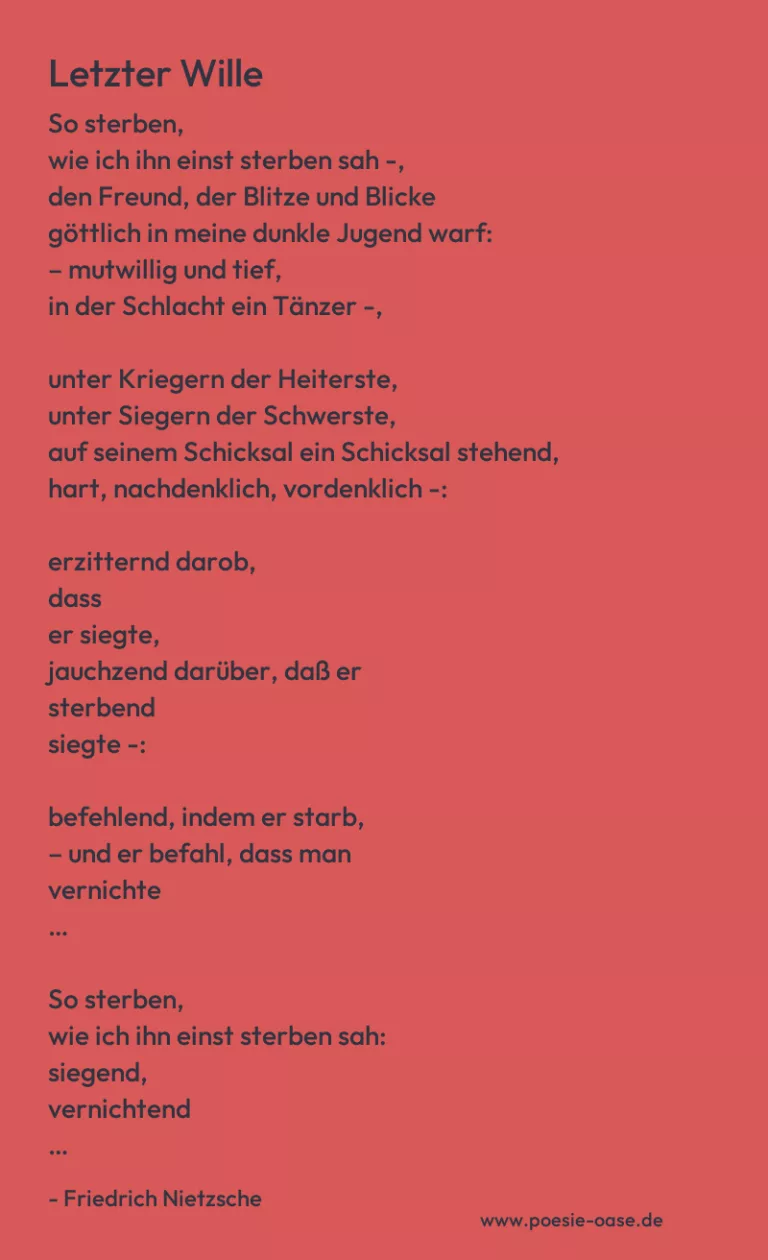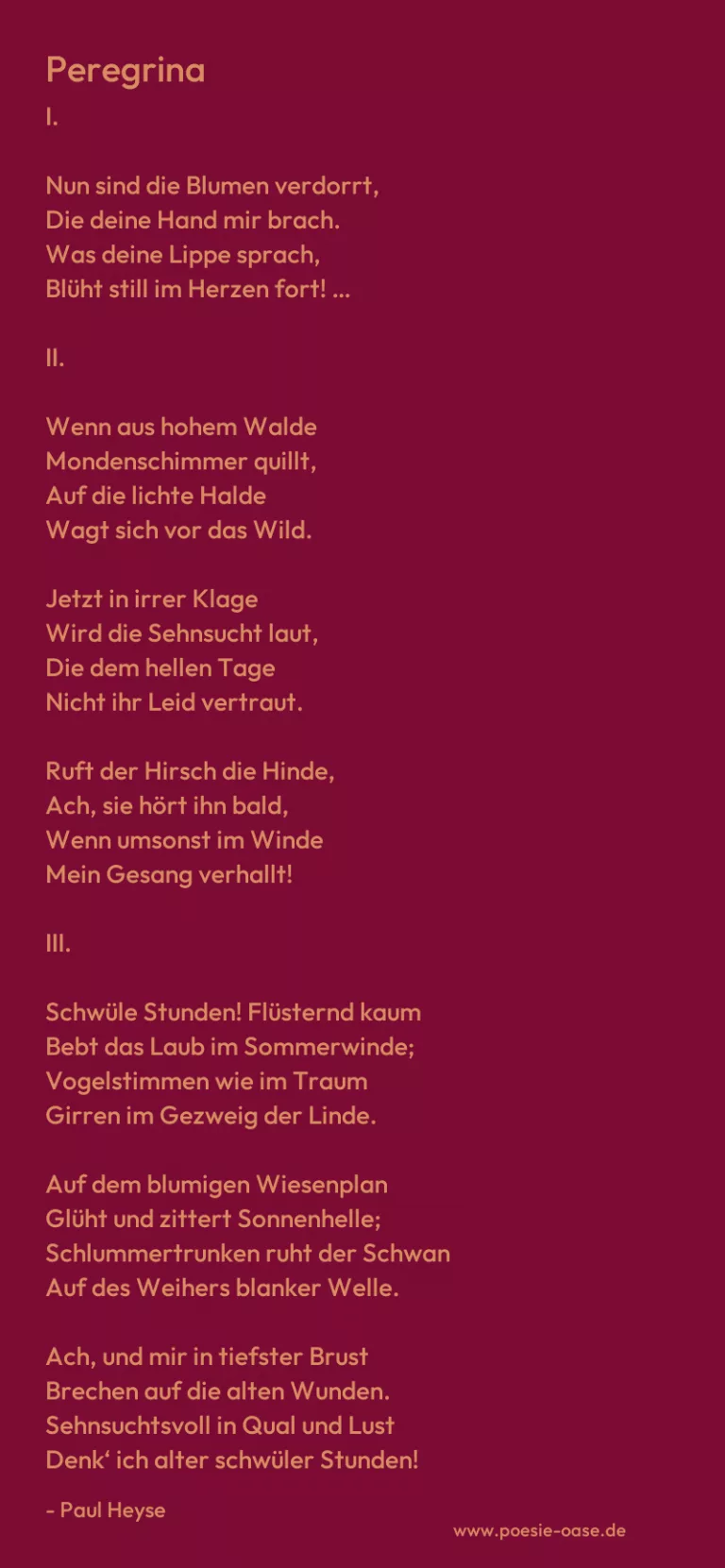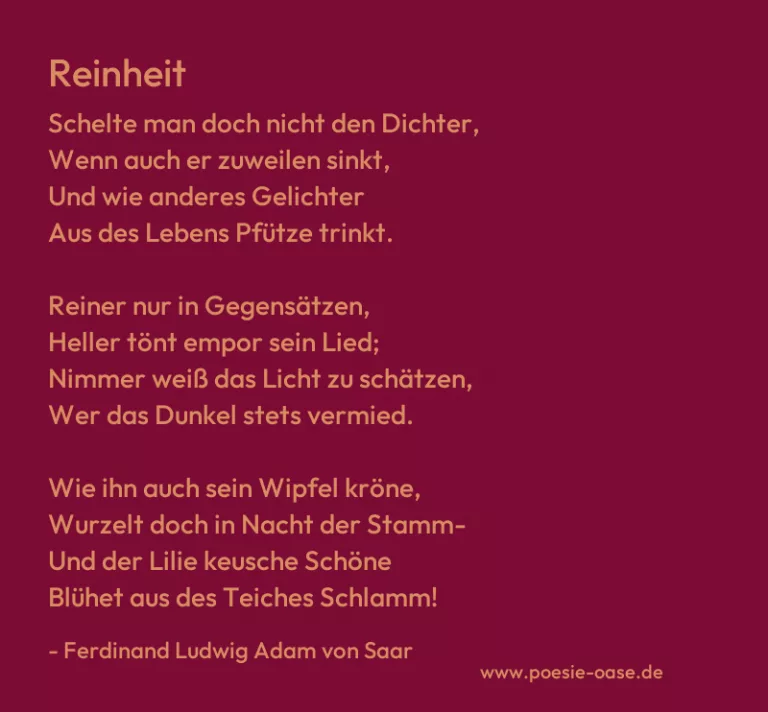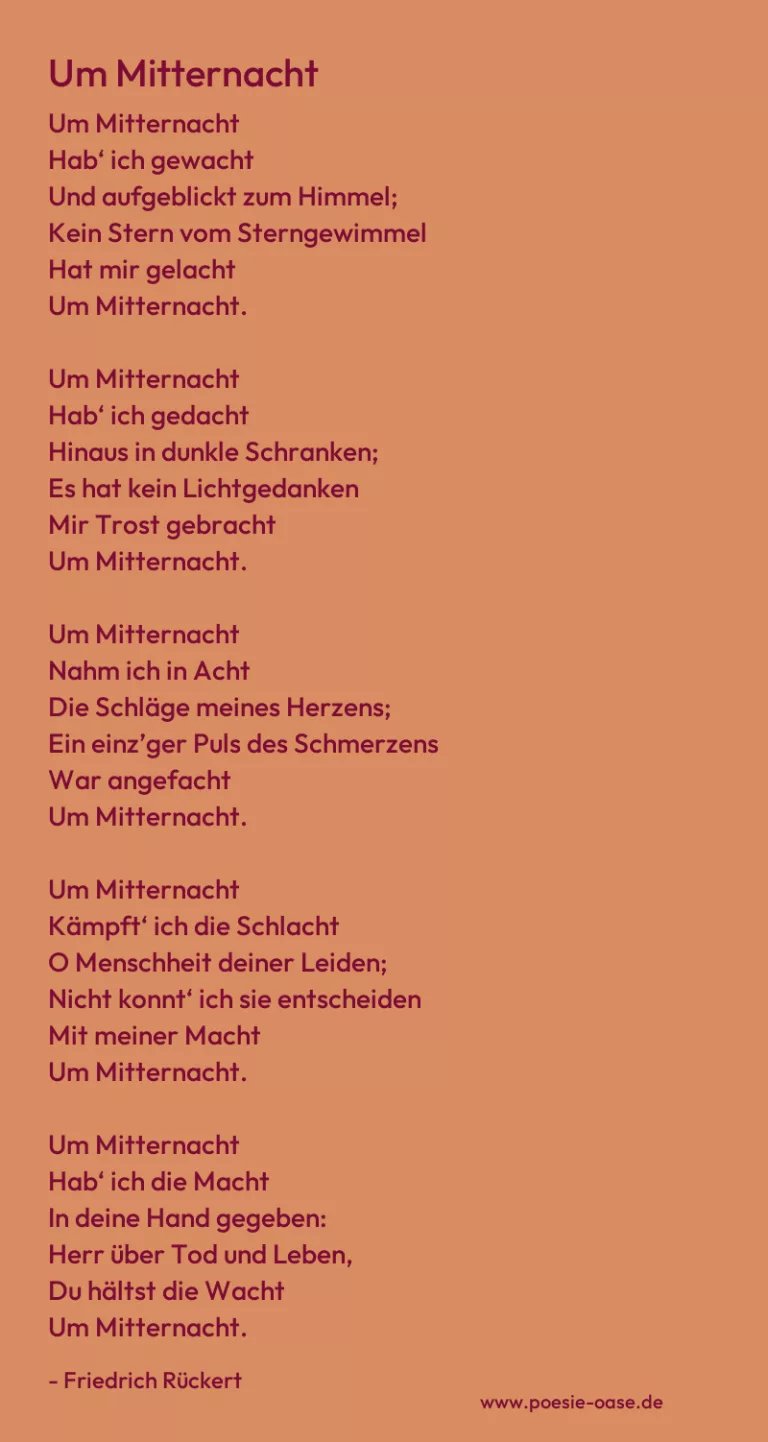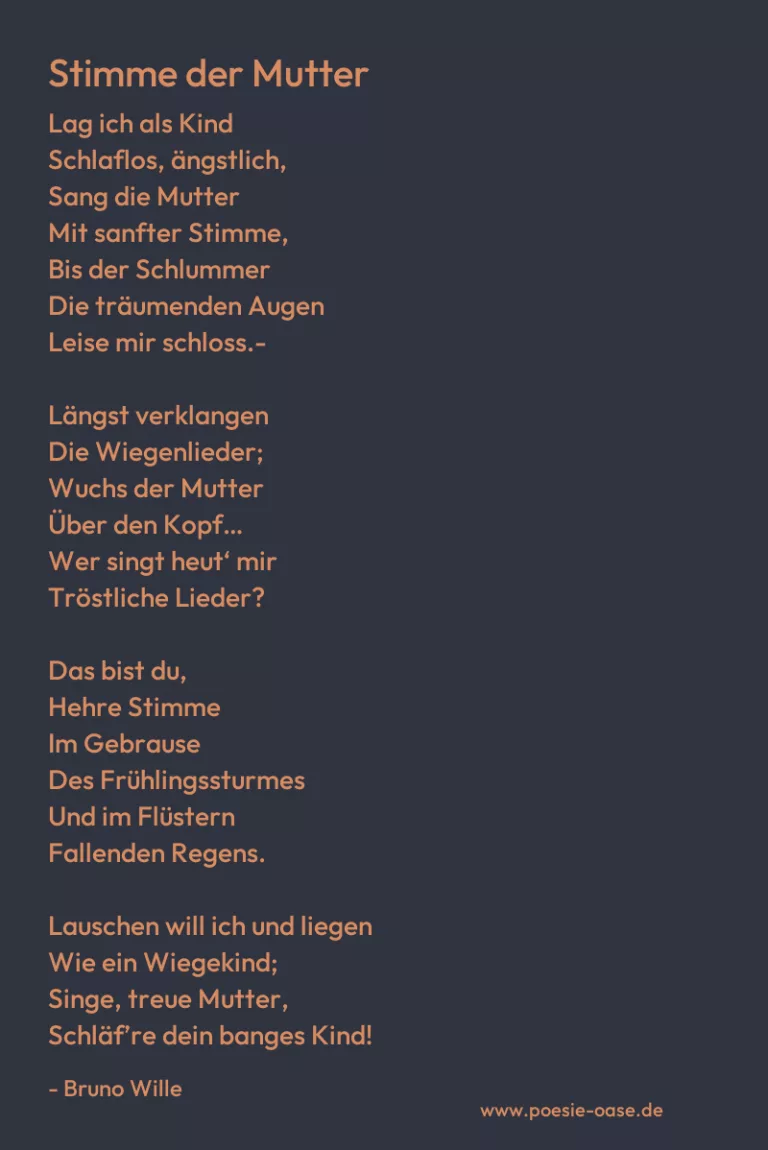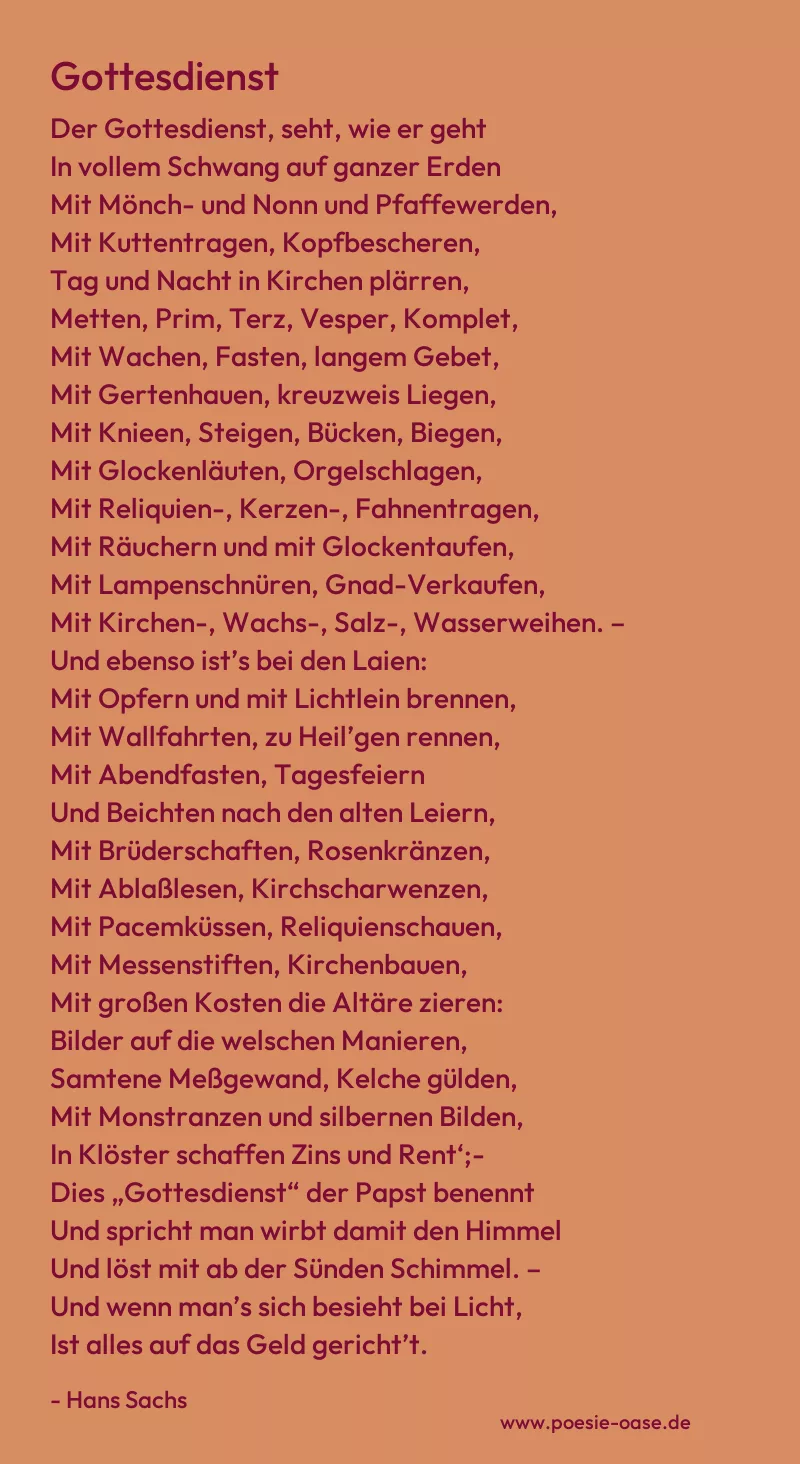Der Gottesdienst, seht, wie er geht
In vollem Schwang auf ganzer Erden
Mit Mönch- und Nonn und Pfaffewerden,
Mit Kuttentragen, Kopfbescheren,
Tag und Nacht in Kirchen plärren,
Metten, Prim, Terz, Vesper, Komplet,
Mit Wachen, Fasten, langem Gebet,
Mit Gertenhauen, kreuzweis Liegen,
Mit Knieen, Steigen, Bücken, Biegen,
Mit Glockenläuten, Orgelschlagen,
Mit Reliquien-, Kerzen-, Fahnentragen,
Mit Räuchern und mit Glockentaufen,
Mit Lampenschnüren, Gnad-Verkaufen,
Mit Kirchen-, Wachs-, Salz-, Wasserweihen. –
Und ebenso ist’s bei den Laien:
Mit Opfern und mit Lichtlein brennen,
Mit Wallfahrten, zu Heil’gen rennen,
Mit Abendfasten, Tagesfeiern
Und Beichten nach den alten Leiern,
Mit Brüderschaften, Rosenkränzen,
Mit Ablaßlesen, Kirchscharwenzen,
Mit Pacemküssen, Reliquienschauen,
Mit Messenstiften, Kirchenbauen,
Mit großen Kosten die Altäre zieren:
Bilder auf die welschen Manieren,
Samtene Meßgewand, Kelche gülden,
Mit Monstranzen und silbernen Bilden,
In Klöster schaffen Zins und Rent‘;-
Dies „Gottesdienst“ der Papst benennt
Und spricht man wirbt damit den Himmel
Und löst mit ab der Sünden Schimmel. –
Und wenn man’s sich besieht bei Licht,
Ist alles auf das Geld gericht’t.
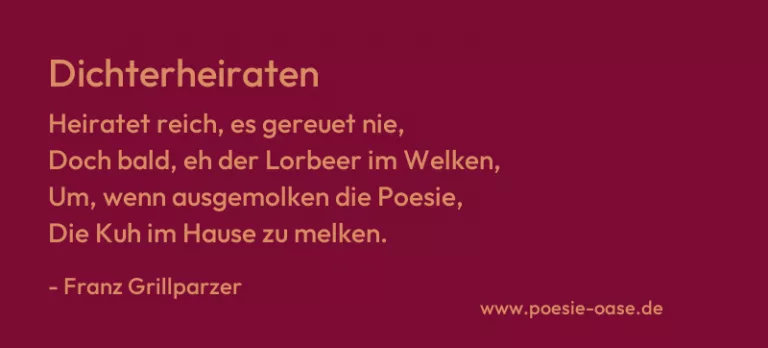
Dichterheiraten
- Gemeinfrei
- Liebe & Romantik
- Tiere