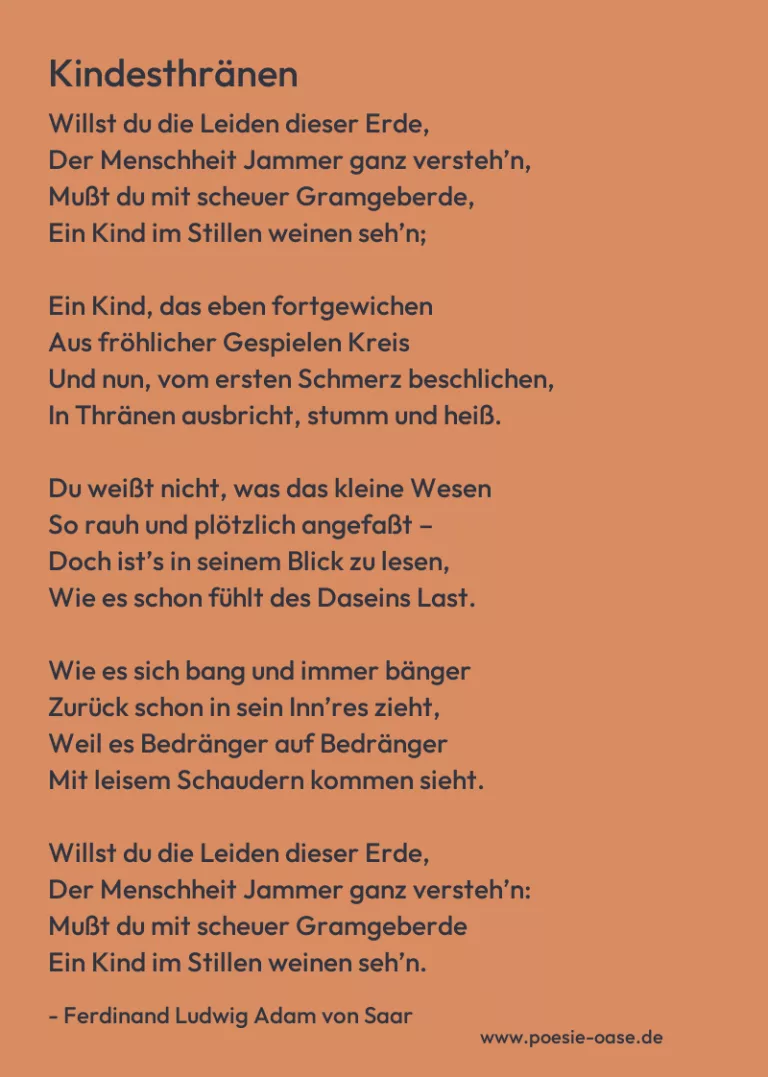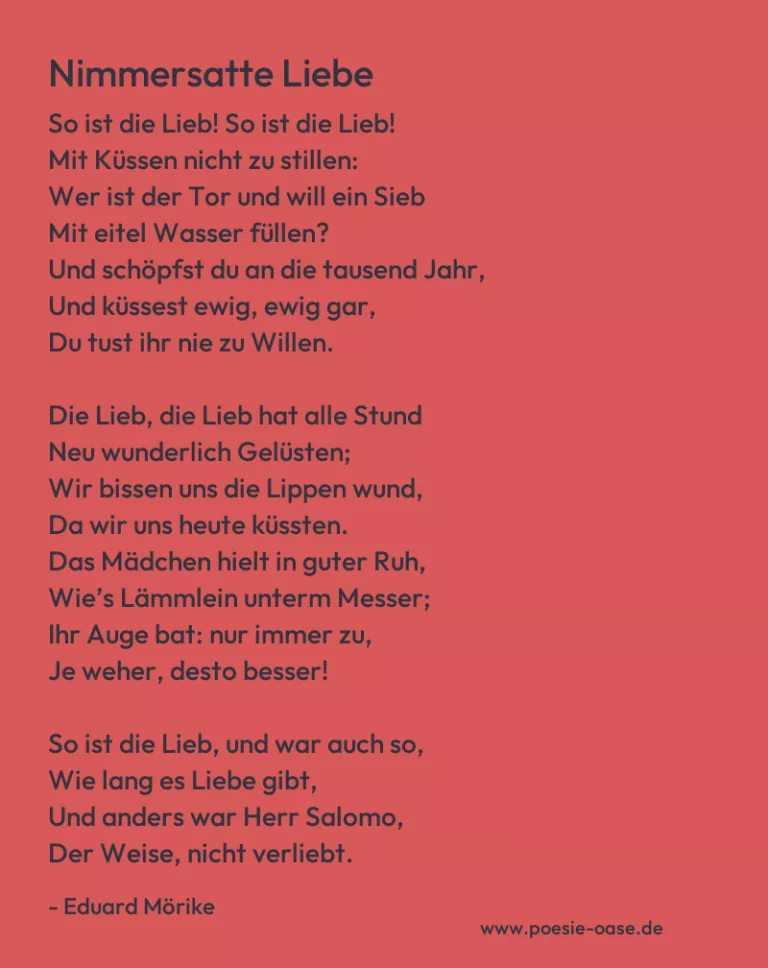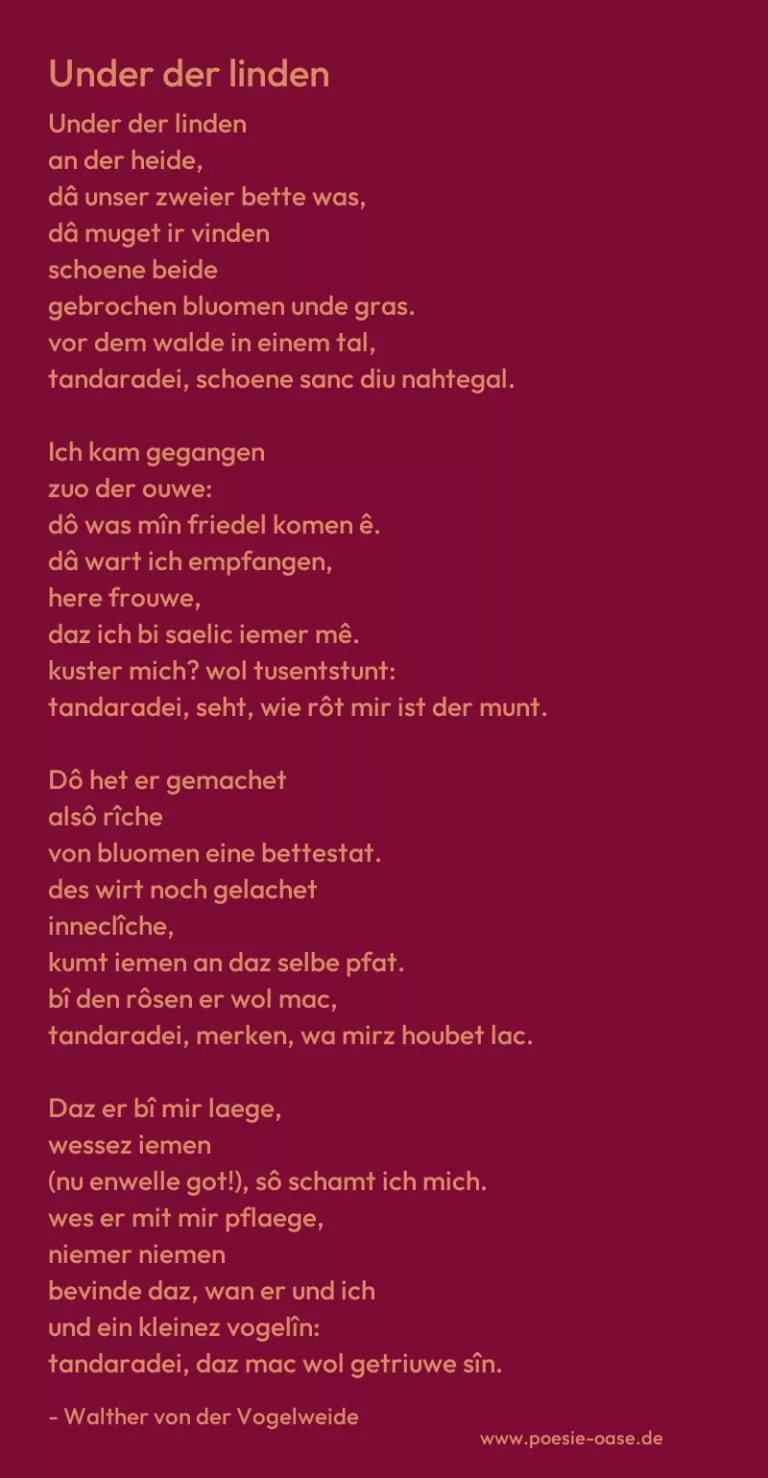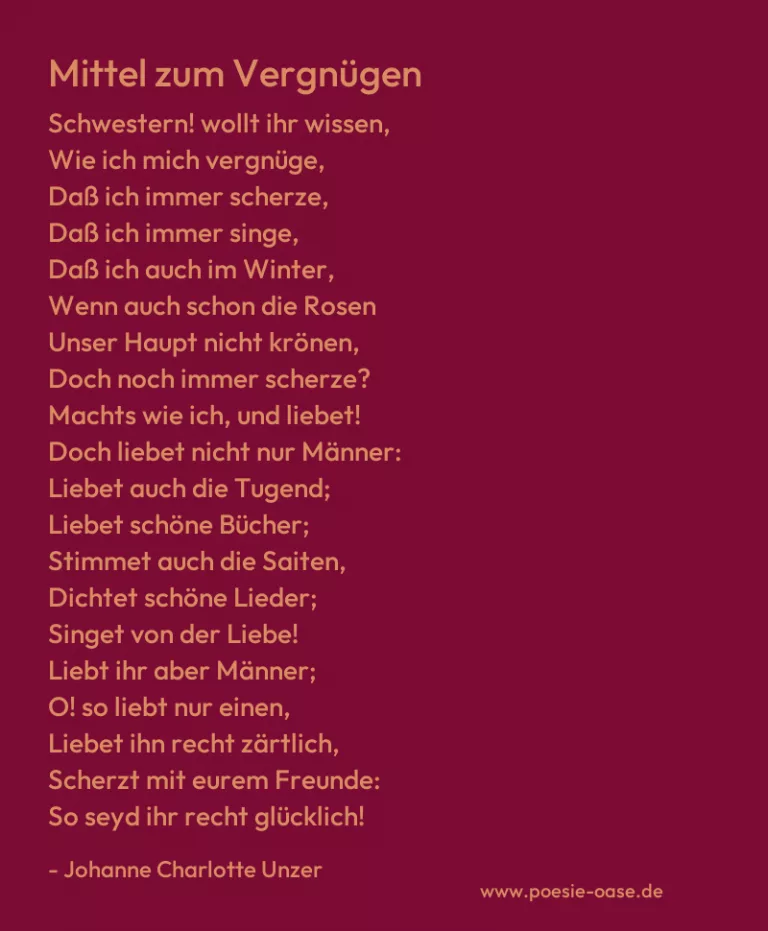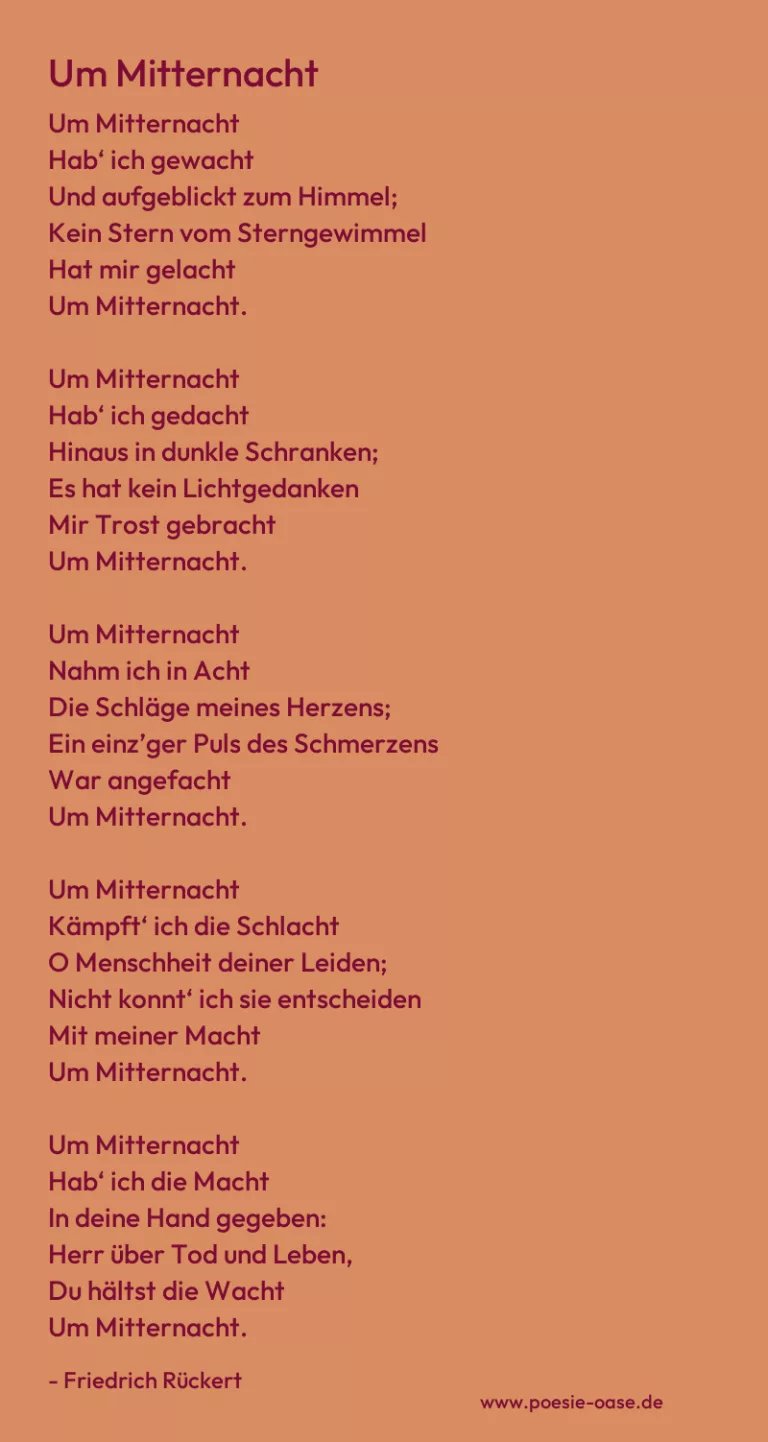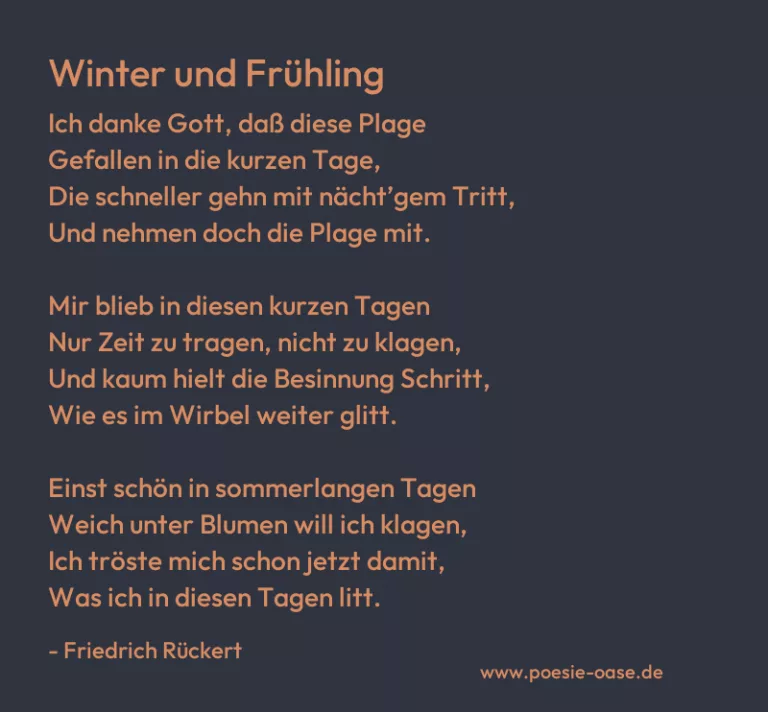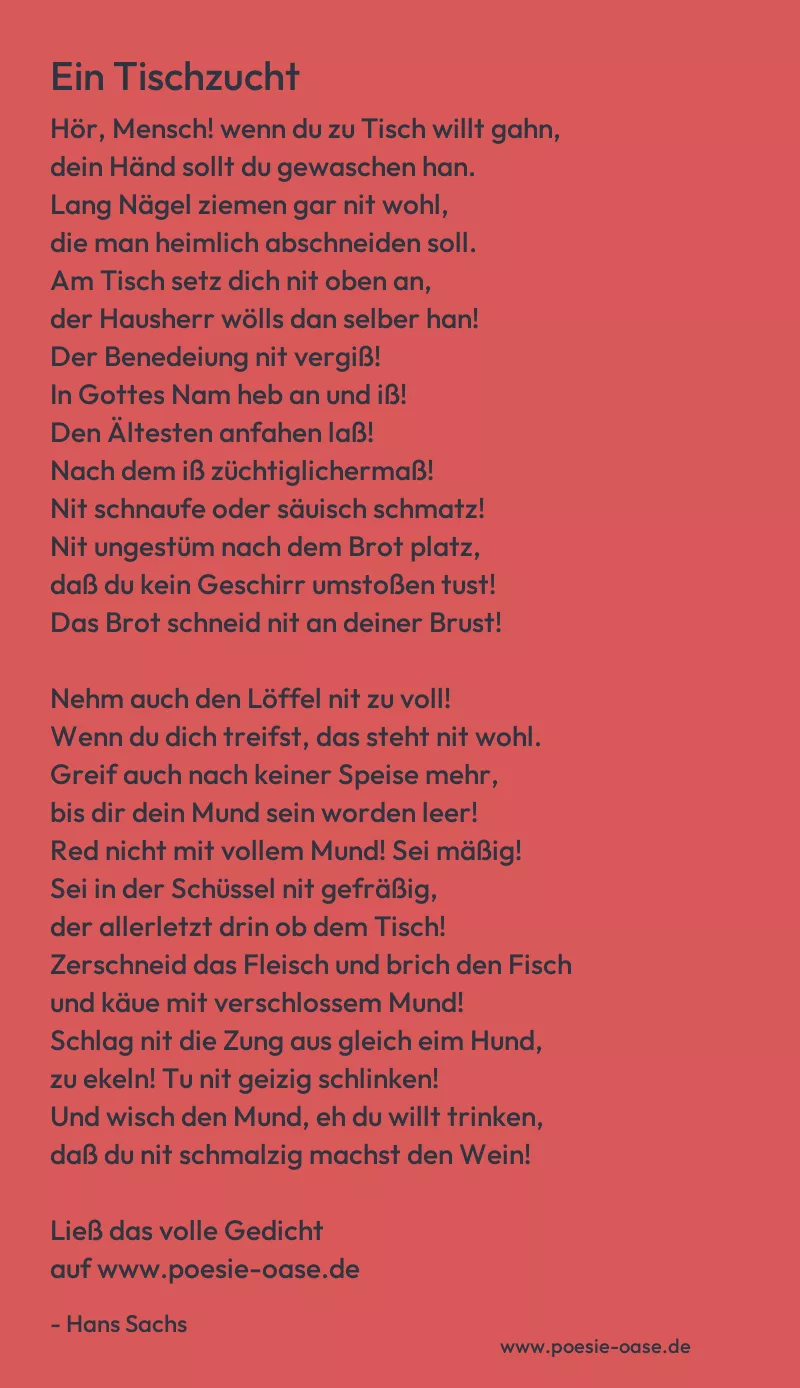Hör, Mensch! wenn du zu Tisch willt gahn,
dein Händ sollt du gewaschen han.
Lang Nägel ziemen gar nit wohl,
die man heimlich abschneiden soll.
Am Tisch setz dich nit oben an,
der Hausherr wölls dan selber han!
Der Benedeiung nit vergiß!
In Gottes Nam heb an und iß!
Den Ältesten anfahen laß!
Nach dem iß züchtiglichermaß!
Nit schnaufe oder säuisch schmatz!
Nit ungestüm nach dem Brot platz,
daß du kein Geschirr umstoßen tust!
Das Brot schneid nit an deiner Brust!
Nehm auch den Löffel nit zu voll!
Wenn du dich treifst, das steht nit wohl.
Greif auch nach keiner Speise mehr,
bis dir dein Mund sein worden leer!
Red nicht mit vollem Mund! Sei mäßig!
Sei in der Schüssel nit gefräßig,
der allerletzt drin ob dem Tisch!
Zerschneid das Fleisch und brich den Fisch
und käue mit verschlossem Mund!
Schlag nit die Zung aus gleich eim Hund,
zu ekeln! Tu nit geizig schlinken!
Und wisch den Mund, eh du willt trinken,
daß du nit schmalzig machst den Wein!
Trink sittlich und nit hust darein!
Tu auch nit grölzen oder kreisten!
Schütt dich auch nit, halt dich am weisten!
Gezänk am Tisch gar übel staht.
Sag nichts, darob man Grauen hat,
und tu dich auch am Tisch nit schneuzen,
daß ander Leut an dir nit scheuzen!
Geh nit umzausen in der Nasen!
Des Zahnstührens sollt du dich maßen!
Im Kopf sollt du dich auch nit krauen!
Dergleichen Maid, Jungfrau und Frauen
solln nach keinem Floh hinunterfischen.
Ans Tischtuch soll sich niemand wischen.
Auch leg den Kopf nit in die Händ!
Leihn dich nit hinten an die Wänd,
bis daß des Mahl hab sein Ausgang!
Denn sag Gott heimlich Lob und Dank,
der dir dein Speise hat beschert,
aus väterlicher Hand ernährt!
Nach dem sollt du vom Tisch aufstehn,
dein Händ waschen und wieder gehn
an dein Gewerb und Arbeit schwer.
So spricht Hans Sachs, Schuhmacher.