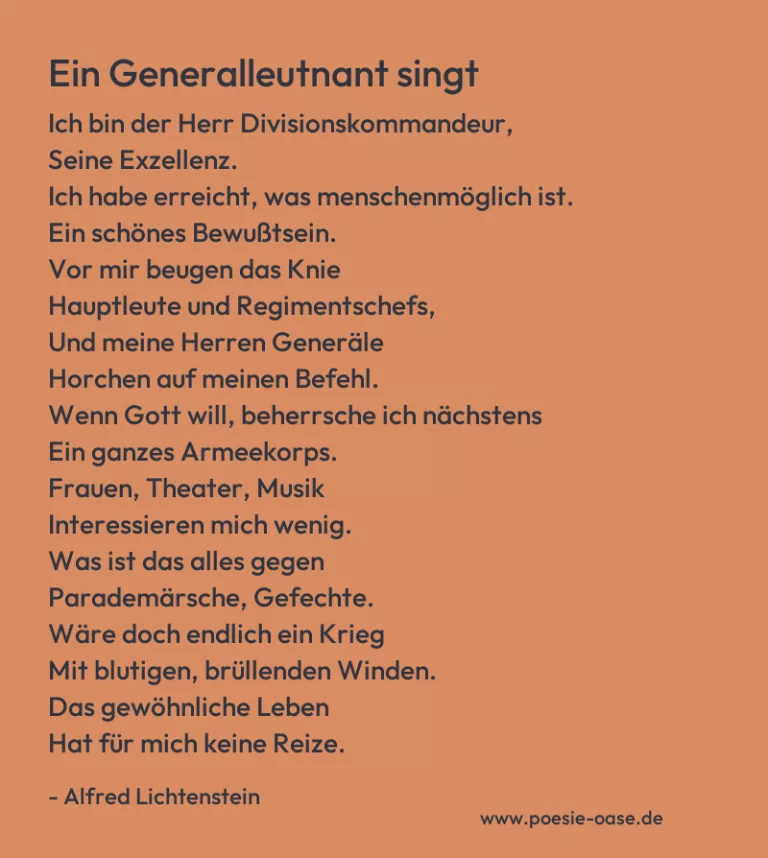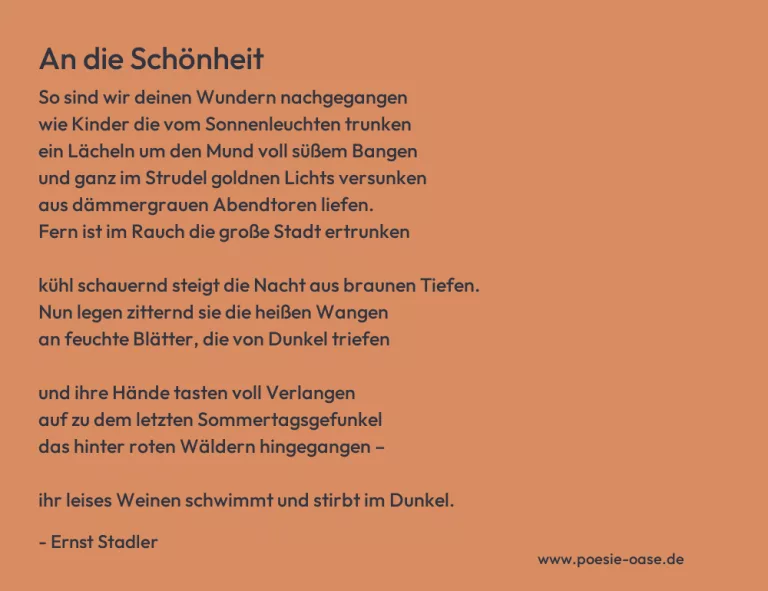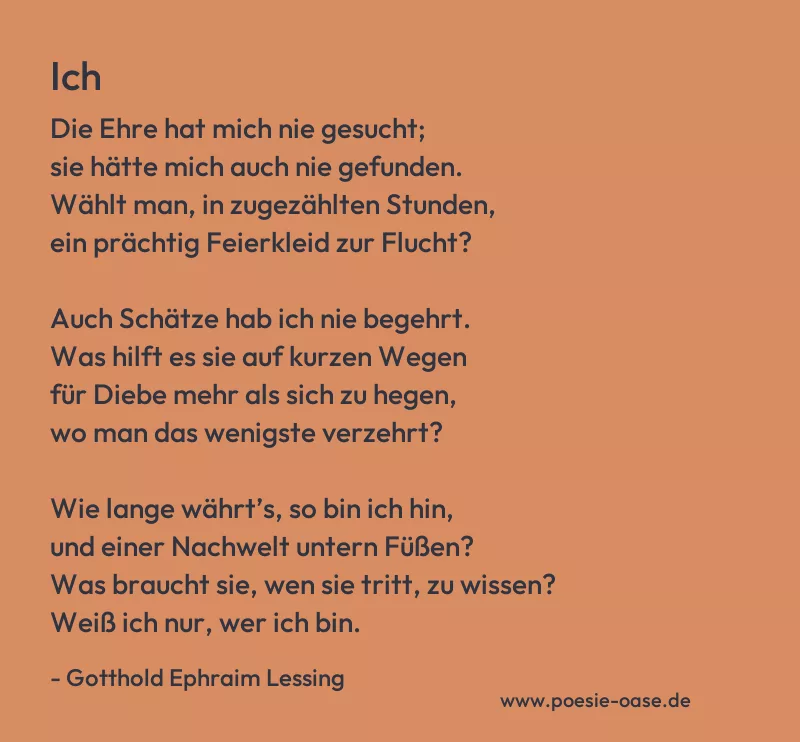Ich
Die Ehre hat mich nie gesucht;
sie hätte mich auch nie gefunden.
Wählt man, in zugezählten Stunden,
ein prächtig Feierkleid zur Flucht?
Auch Schätze hab ich nie begehrt.
Was hilft es sie auf kurzen Wegen
für Diebe mehr als sich zu hegen,
wo man das wenigste verzehrt?
Wie lange währt’s, so bin ich hin,
und einer Nachwelt untern Füßen?
Was braucht sie, wen sie tritt, zu wissen?
Weiß ich nur, wer ich bin.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
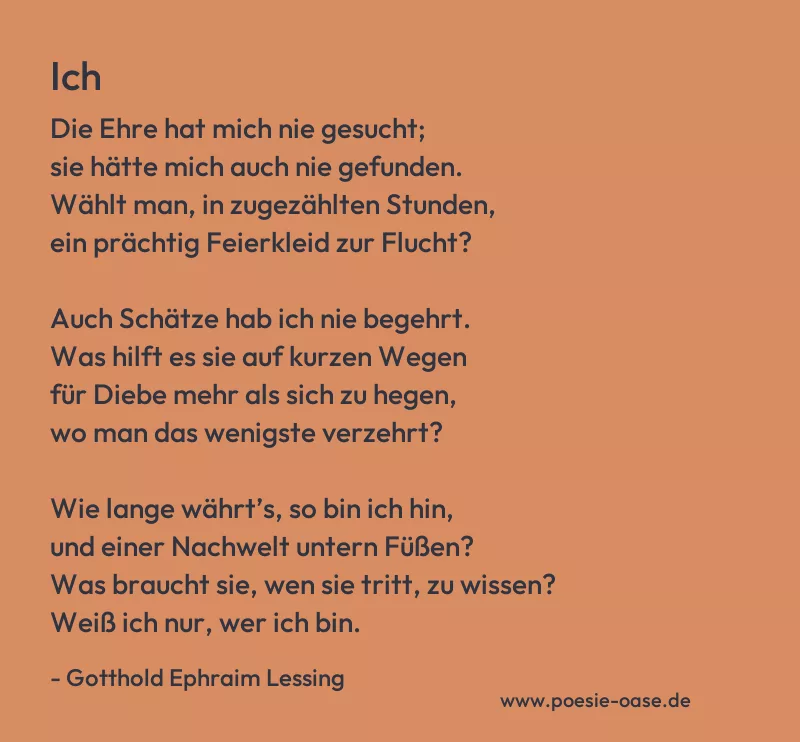
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich“ von Gotthold Ephraim Lessing ist eine Reflexion über den Wert von Ehre, Reichtum und den Sinn des Lebens. Zu Beginn stellt der Sprecher klar, dass „die Ehre“ ihn nie gesucht hat und er sie auch nie gesucht hat. Diese Zeilen zeigen eine distanzierte Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen und dem Streben nach Anerkennung. Ehre wird hier als eine äußere Größe dargestellt, die für den Sprecher keinen wahren Wert hat, weil sie nicht von innen kommt. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob es wirklich sinnvoll ist, „ein prächtig Feierkleid zur Flucht“ zu wählen – ein Bild, das darauf hinweist, dass äußere, vergängliche Dinge wie Ehre nur als Maske dienen, um vor der Realität zu fliehen.
Der Sprecher geht weiter und erklärt, dass er auch „Schätze nie begehrt“ habe. Die Frage, was es einem nutzt, „Schätze auf kurzen Wegen“ zu horten, wird ebenfalls in Zweifel gezogen. Die Vorstellung, dass Reichtum von „Dieben mehr als sich zu hegen“ zu schützen ist, verdeutlicht die Vergänglichkeit von materiellen Dingen. Reichtum kann nur vorübergehend genossen werden und wird oft von jenen begehrt, die ihn unrechtmäßig an sich reißen. Die Vorstellung des „wenigsten Verzehrens“ lässt darauf schließen, dass der wahre Wert nicht in der Anhäufung von Besitztümern liegt, sondern vielmehr im Bescheidenen und im bewussten Umgang mit dem, was man hat.
In der letzten Strophe wird die Vergänglichkeit des Lebens noch deutlicher. Der Sprecher fragt, wie lange er selbst bestehen wird und welche Bedeutung seine Existenz für die Nachwelt haben könnte. „Was braucht sie, wen sie tritt, zu wissen?“ wird hier als rhetorische Frage verwendet, um auf die Bedeutungslosigkeit des Einzelnen aus der Perspektive der „Nachwelt“ hinzuweisen. Es geht nicht darum, von der Nachwelt gewürdigt oder erinnert zu werden, sondern um das Wissen „wer ich bin“ – um das persönliche Bewusstsein und die Erkenntnis der eigenen Identität im gegenwärtigen Moment. Die letzte Zeile drückt aus, dass das wahre Wissen und die wahre Bedeutung nicht von äußeren Anerkennungen abhängen, sondern von der inneren Klarheit des Individuums.
Insgesamt vermittelt Lessing mit diesem Gedicht eine Haltung der Selbstgenügsamkeit und des Gleichmuts gegenüber äußeren Werten wie Ehre und Reichtum. Der Sprecher setzt sich mit der Vergänglichkeit und dem oft vergeblichen Streben nach Anerkennung auseinander und stellt fest, dass die einzige wirklich wertvolle Erkenntnis die ist, wer man selbst ist. Das Gedicht fordert dazu auf, sich nicht von äußeren Maßstäben definieren zu lassen, sondern das eigene Leben und die eigene Identität aus einer inneren, persönlichen Perspektive zu verstehen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.