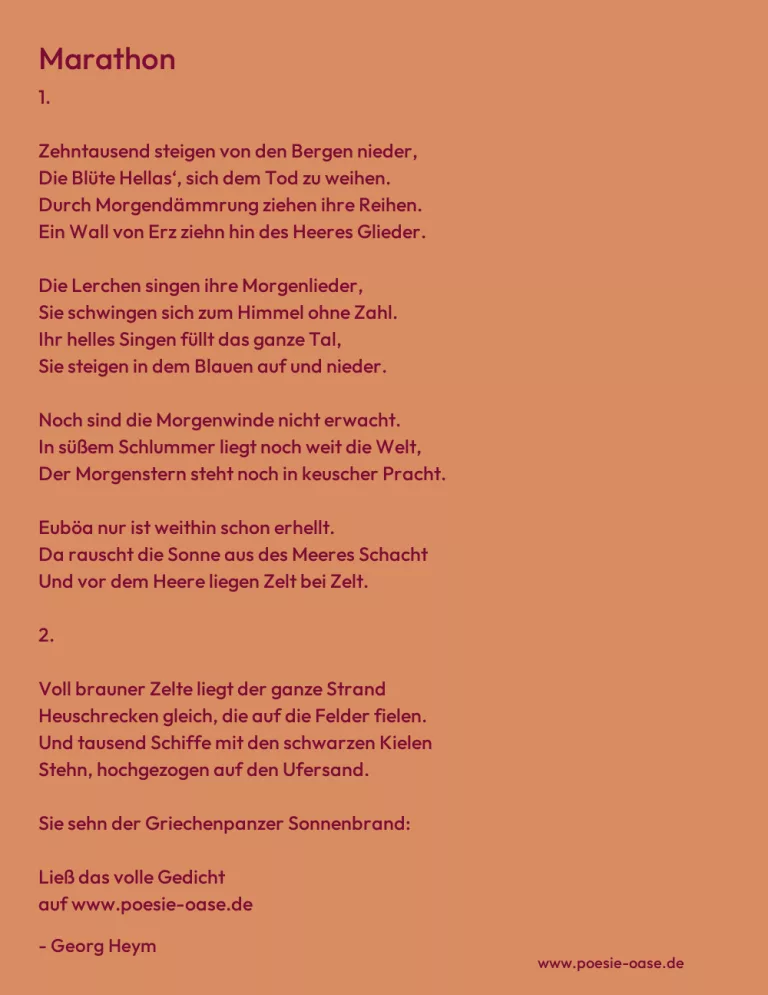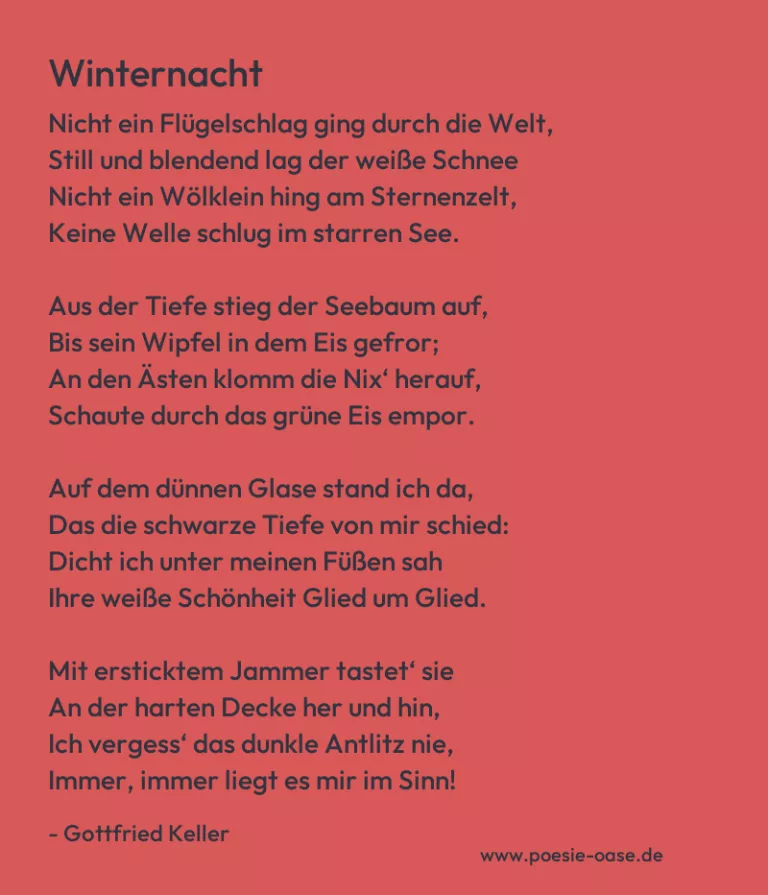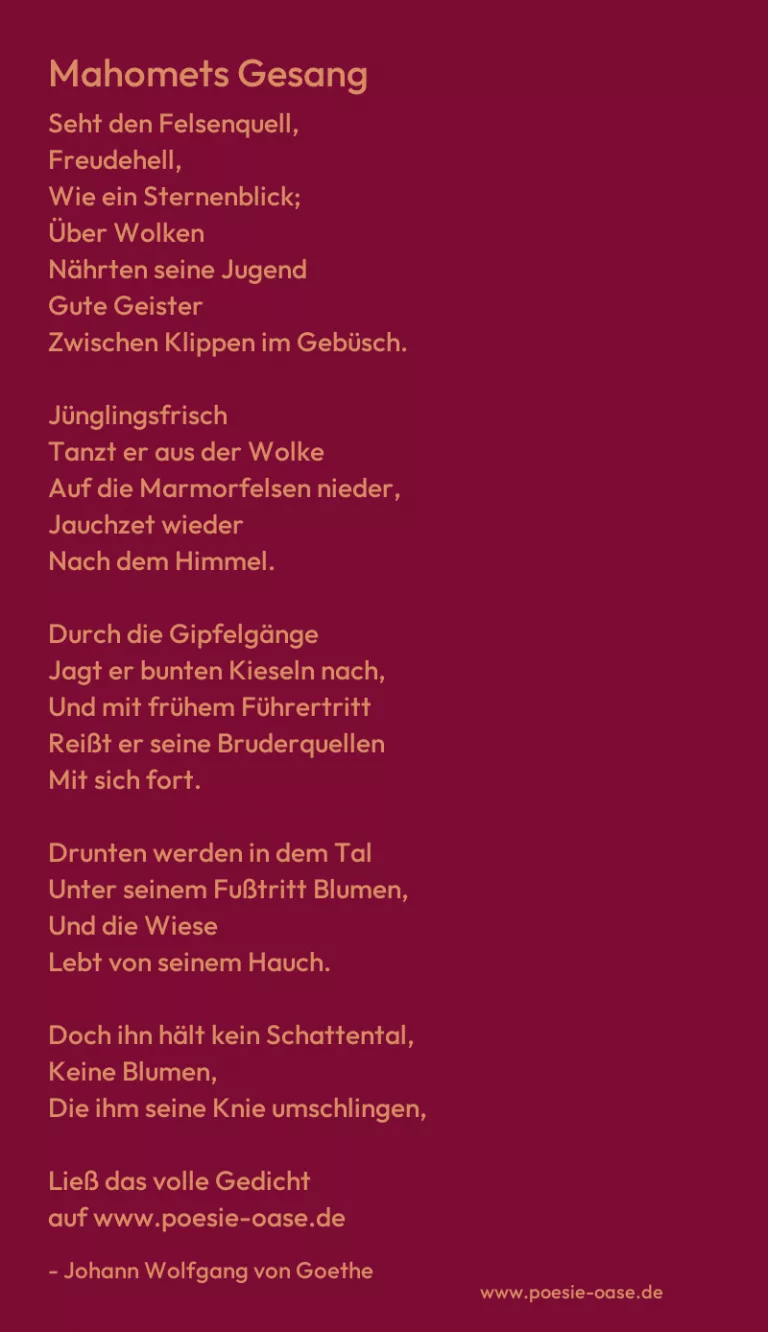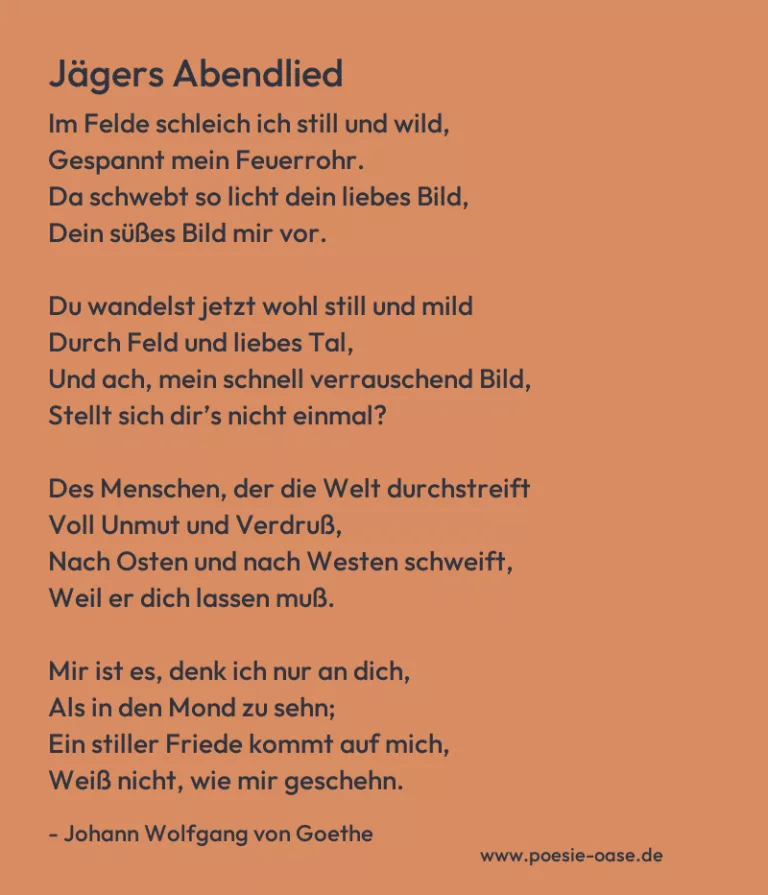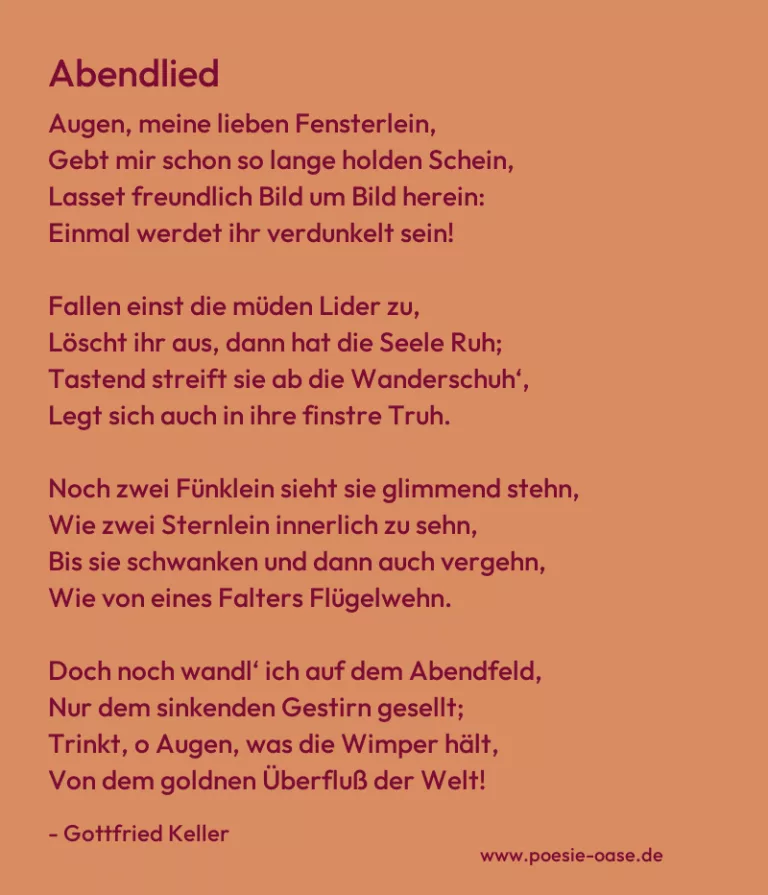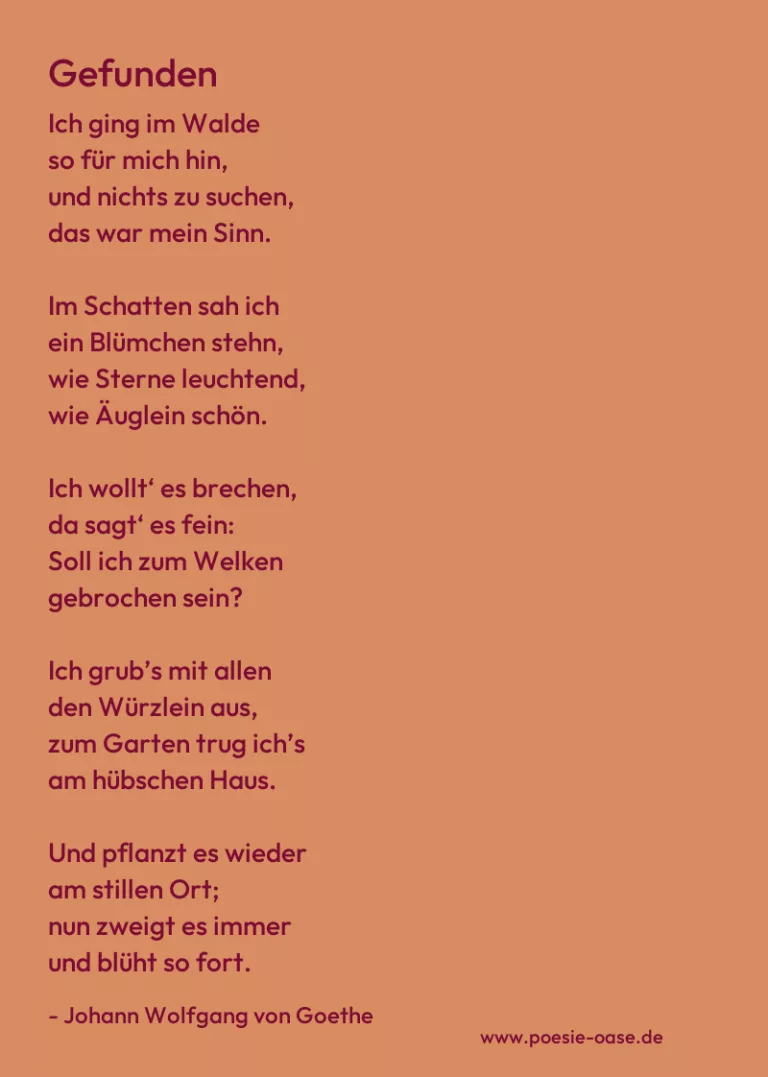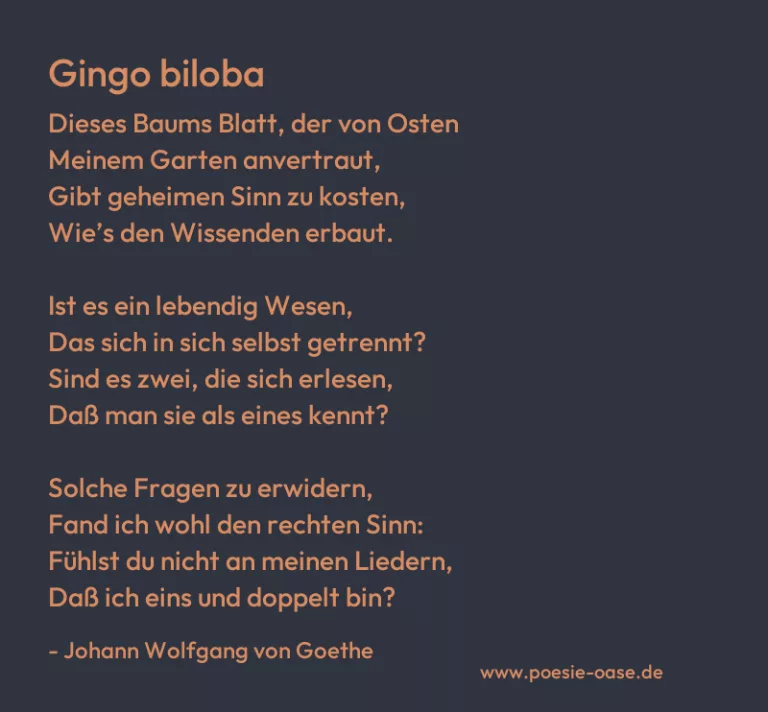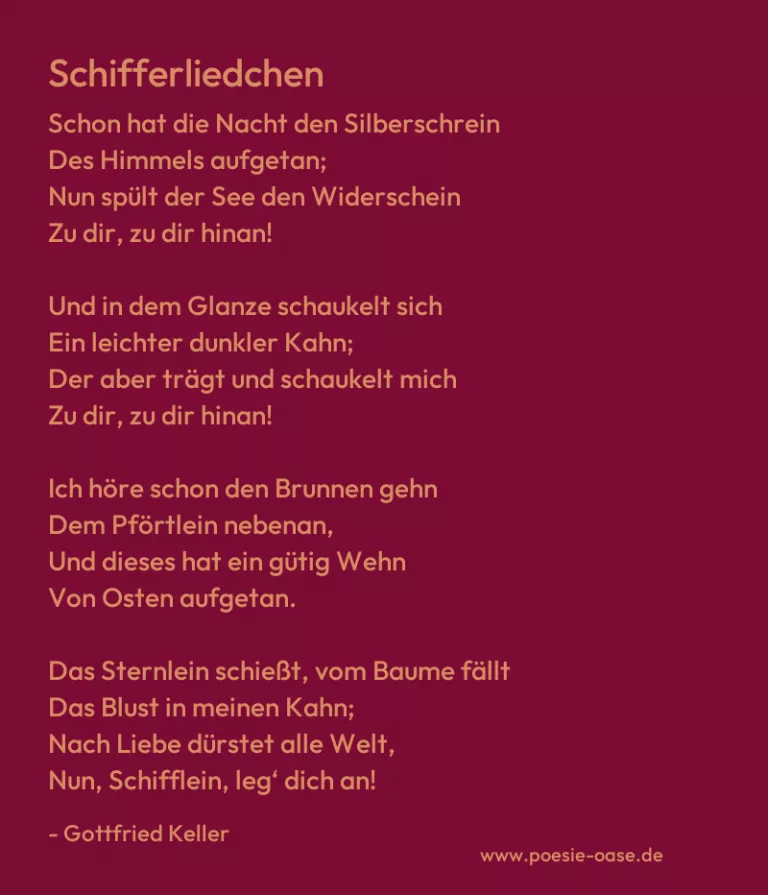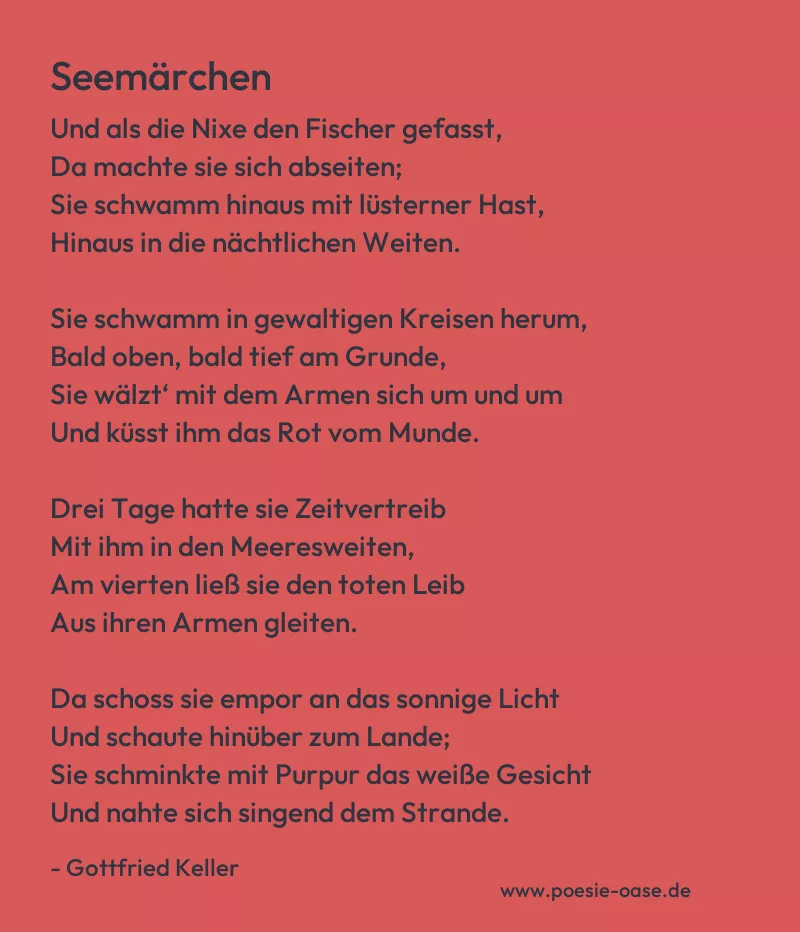Seemärchen
Und als die Nixe den Fischer gefasst,
Da machte sie sich abseiten;
Sie schwamm hinaus mit lüsterner Hast,
Hinaus in die nächtlichen Weiten.
Sie schwamm in gewaltigen Kreisen herum,
Bald oben, bald tief am Grunde,
Sie wälzt‘ mit dem Armen sich um und um
Und küsst ihm das Rot vom Munde.
Drei Tage hatte sie Zeitvertreib
Mit ihm in den Meeresweiten,
Am vierten ließ sie den toten Leib
Aus ihren Armen gleiten.
Da schoss sie empor an das sonnige Licht
Und schaute hinüber zum Lande;
Sie schminkte mit Purpur das weiße Gesicht
Und nahte sich singend dem Strande.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
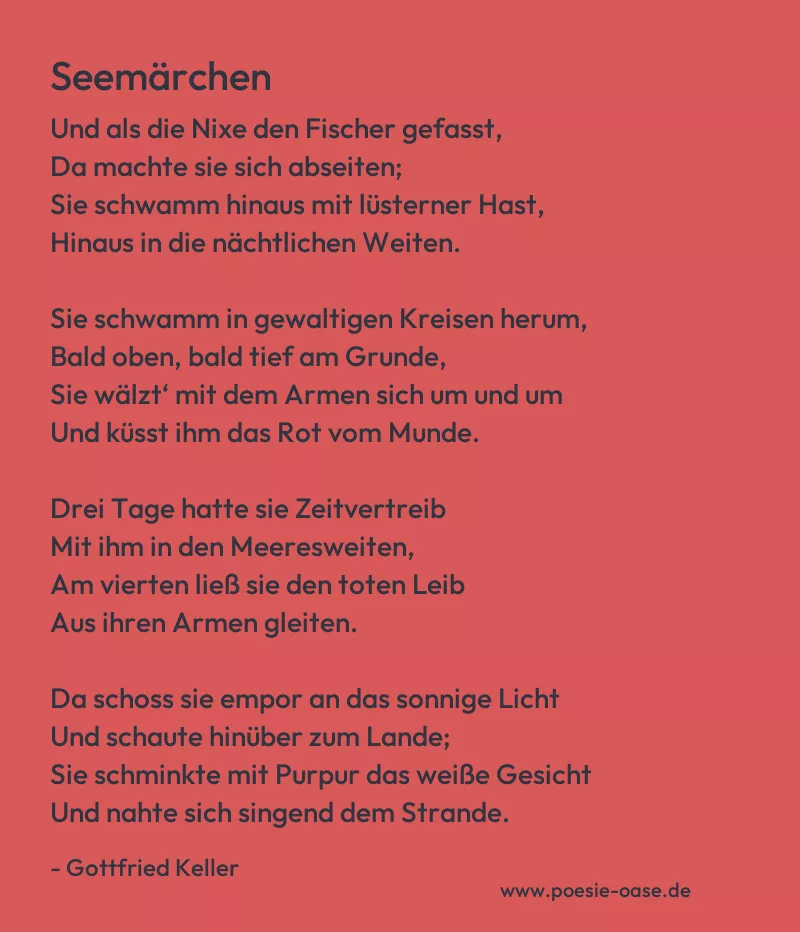
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Seemärchen“ von Gottfried Keller erzählt in balladenhafter Form ein düsteres Unterwassermärchen, das von der Begegnung eines Fischers mit einer Nixe handelt. Im Zentrum steht die verhängnisvolle Macht weiblicher Verführung, die in einer tödlichen Verbindung zwischen Mensch und Naturwesen mündet. Der märchenhafte Titel täuscht zunächst über den tragischen Gehalt des Gedichts hinweg.
Die Nixe wird als leidenschaftliches, zugleich aber auch zerstörerisches Wesen dargestellt. Ihre „lüsterne Hast“ und das Umkreisen des Fischers unterstreichen eine animalische Begierde, die nicht auf Liebe, sondern auf Besitz und Rausch ausgerichtet ist. Die körperliche Nähe, das „Küssen des Rots vom Munde“, verweist auf die Auslöschung seiner Lebenskraft. Die drei Tage im Meer erscheinen wie eine verzerrte Liebesbeziehung – intensiv, körperlich und letztlich tödlich.
Am vierten Tag lässt die Nixe den toten Körper los – ohne Reue oder Sentimentalität. Diese plötzliche Entsorgung verdeutlicht ihre Unfähigkeit zu menschlicher Bindung oder Empathie. Die Gegenüberstellung von Leidenschaft und Tod zeigt die zerstörerische Kraft des Begehrens, wenn es nicht von Gegenseitigkeit oder Bewusstsein durchdrungen ist. Der Tod des Fischers wirkt unausweichlich, fast beiläufig.
Im letzten Versabschnitt kehrt die Nixe an die Oberfläche zurück, schminkt sich und nähert sich singend dem Land – ein Akt der Verwandlung und Verführung. Das Motiv des Gesangs spielt auf den Sirenenmythos an, in dem weibliche Stimmen den Untergang von Männern herbeiführen. Damit endet das Gedicht mit einem unheimlichen Ausblick: Der Kreislauf beginnt vermutlich von Neuem. Die Nixe wird zum Sinnbild einer betörenden, unberechenbaren Naturmacht, die Schönheit und Verderben zugleich in sich trägt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.