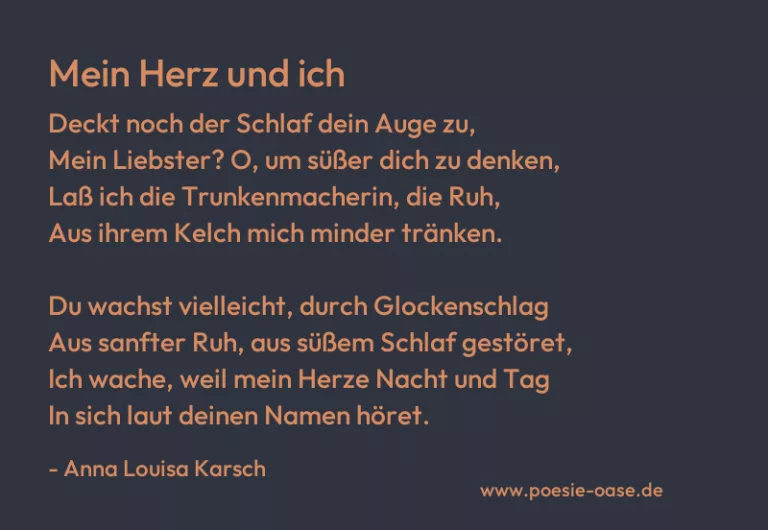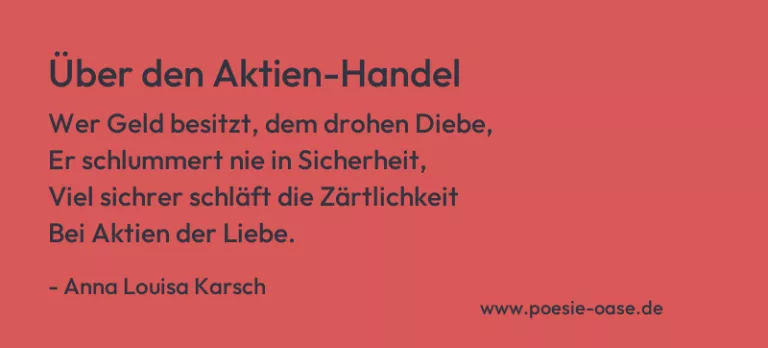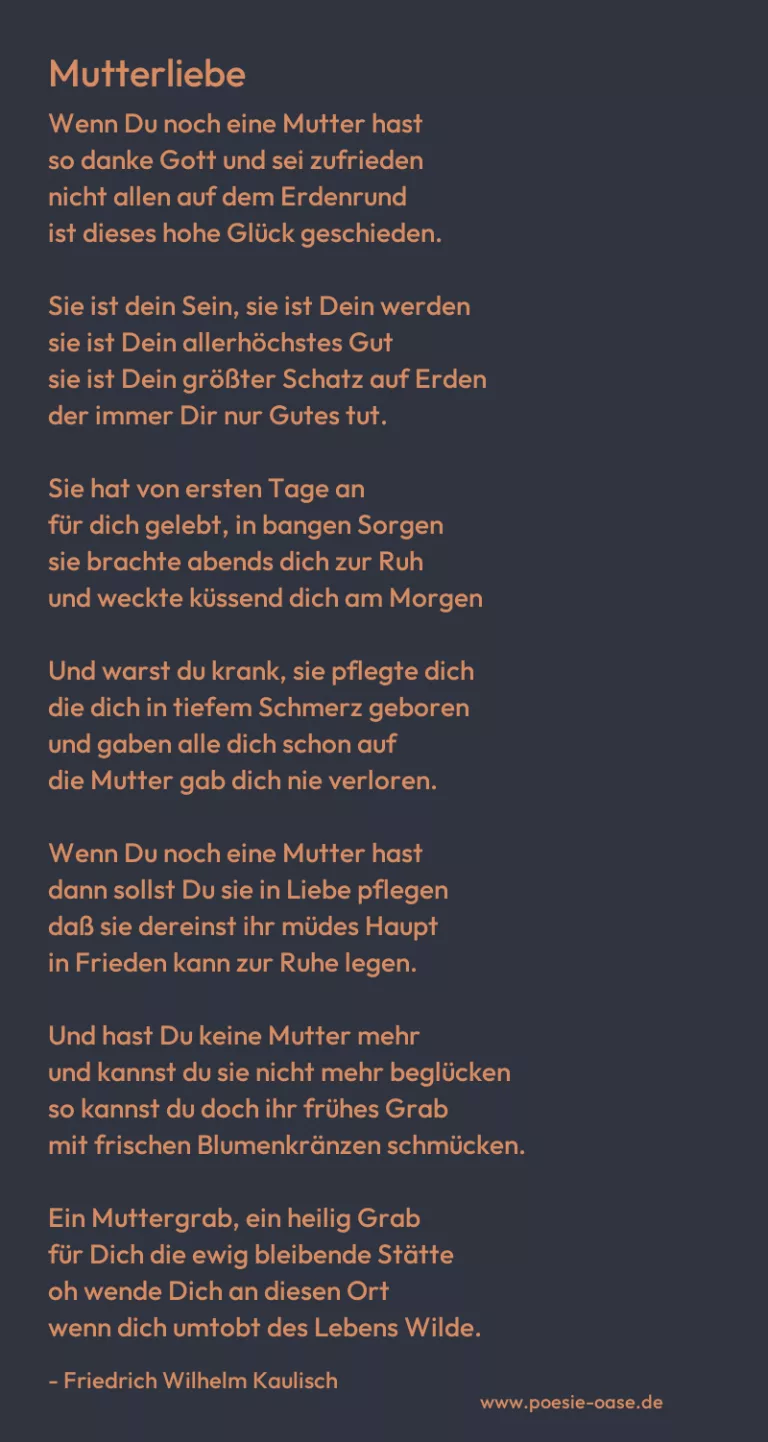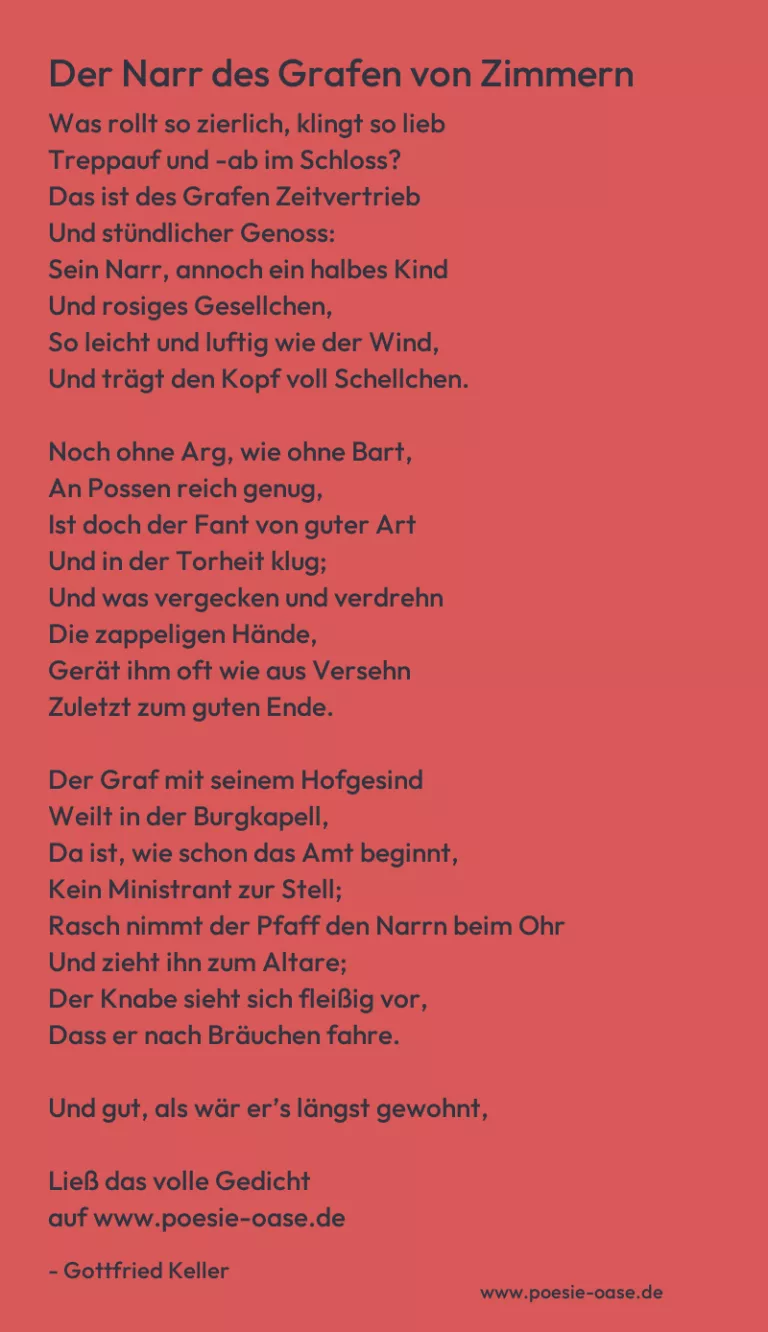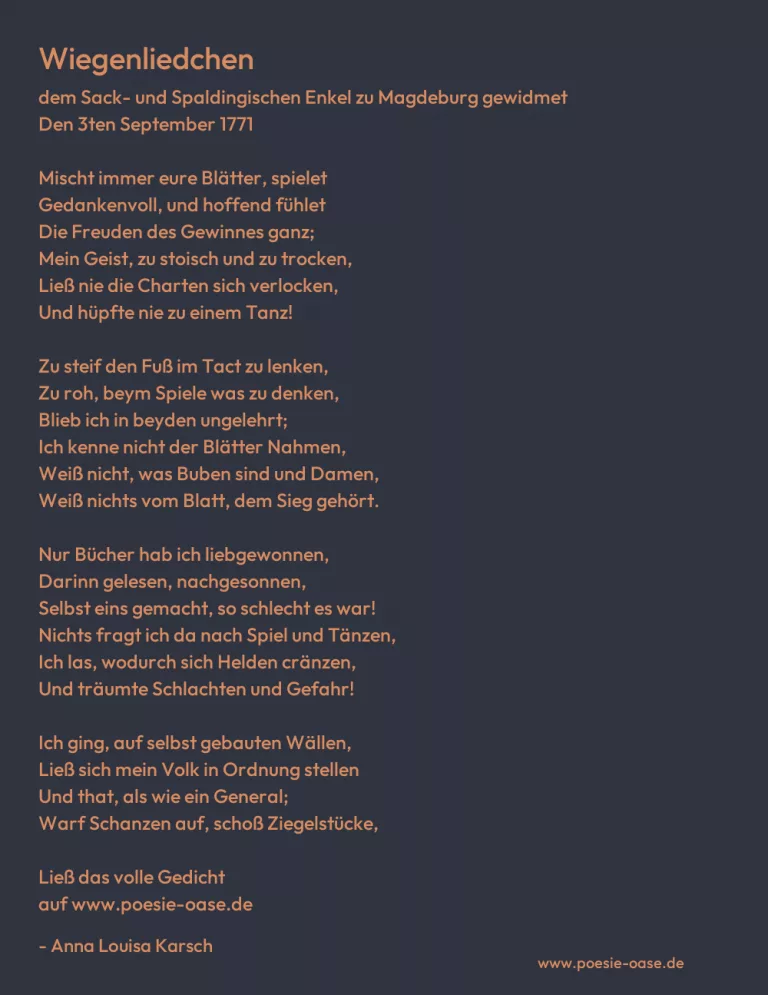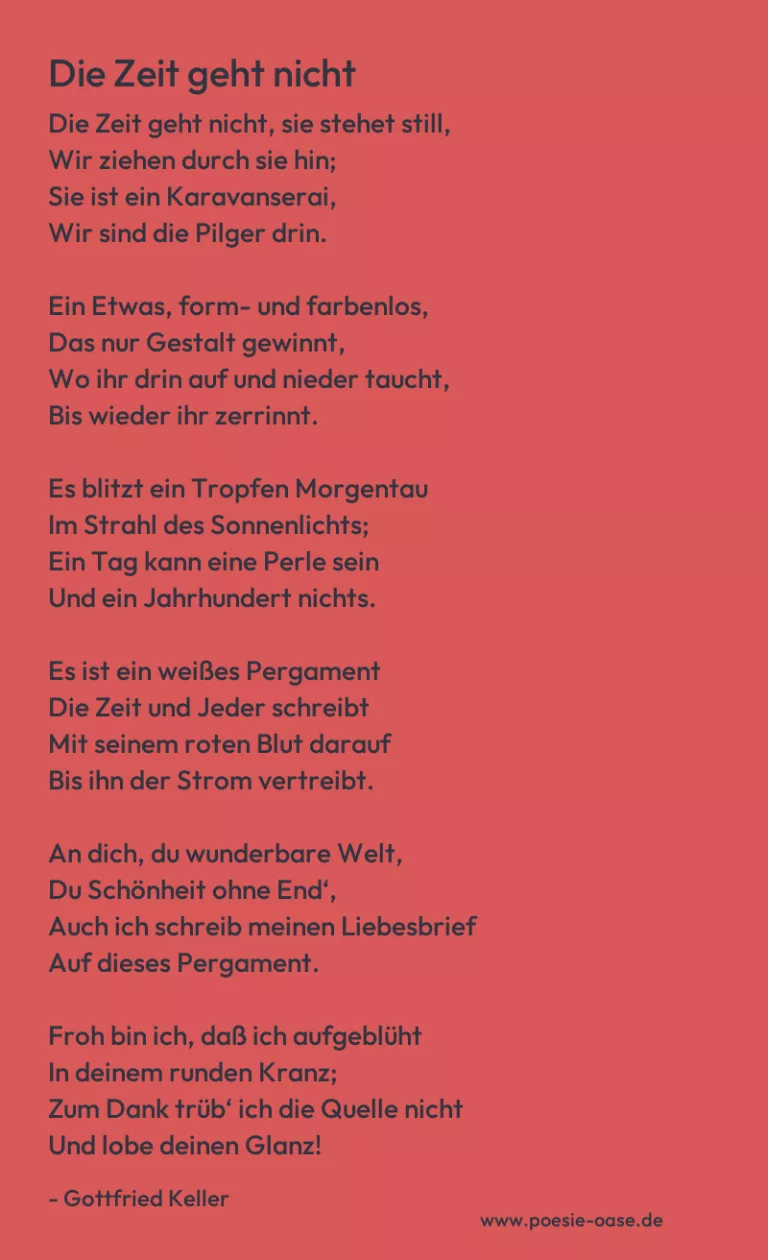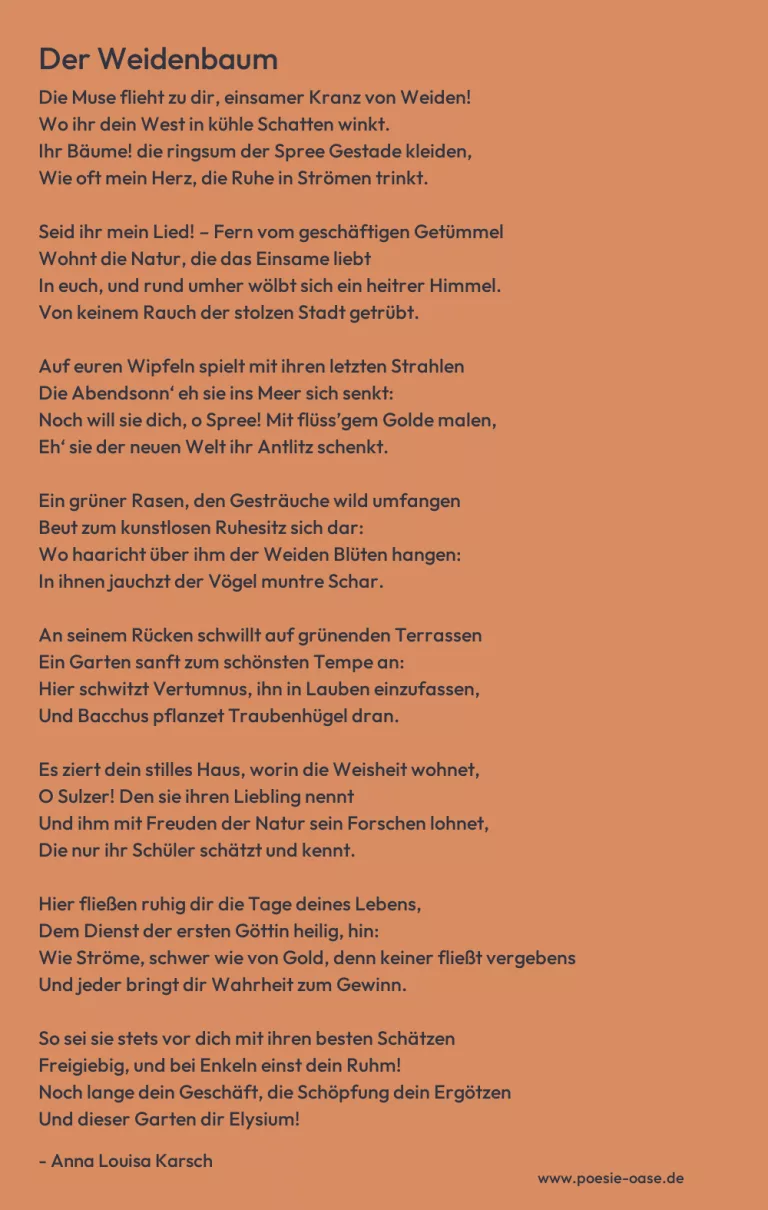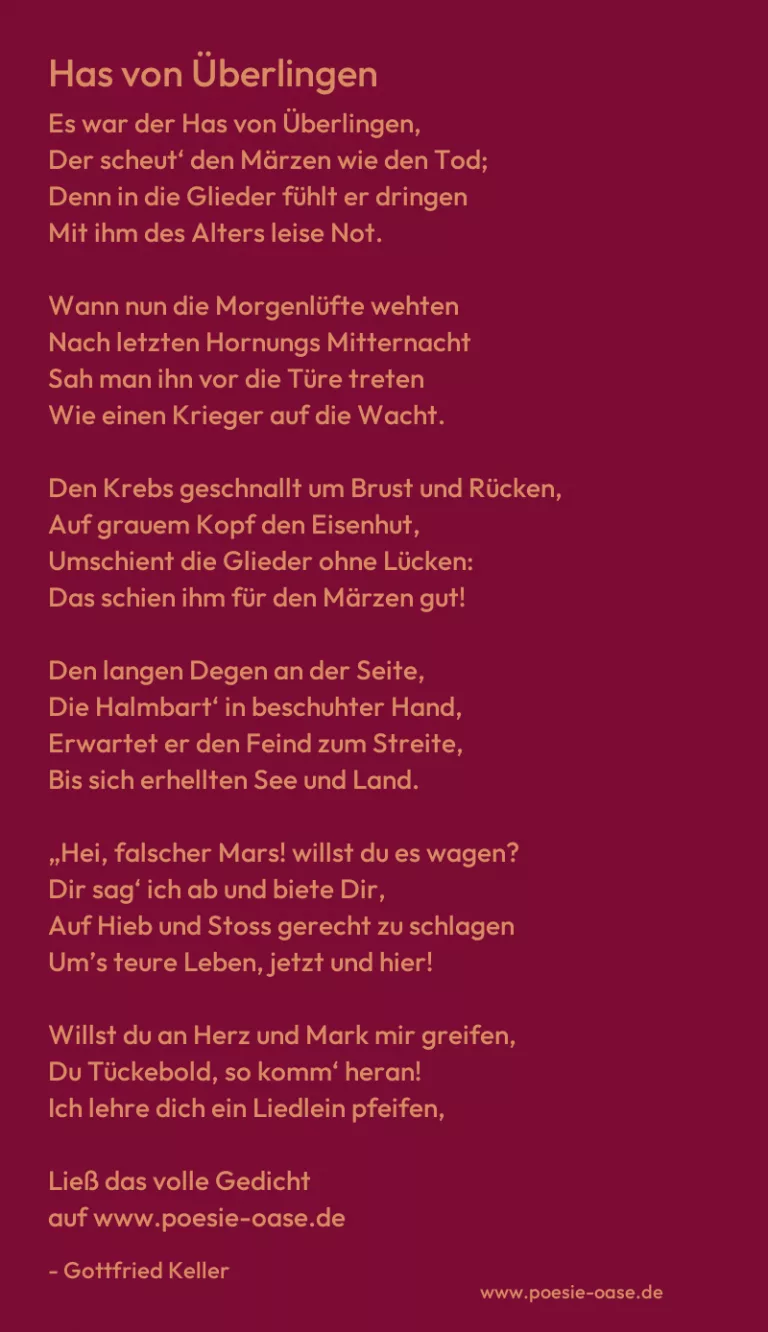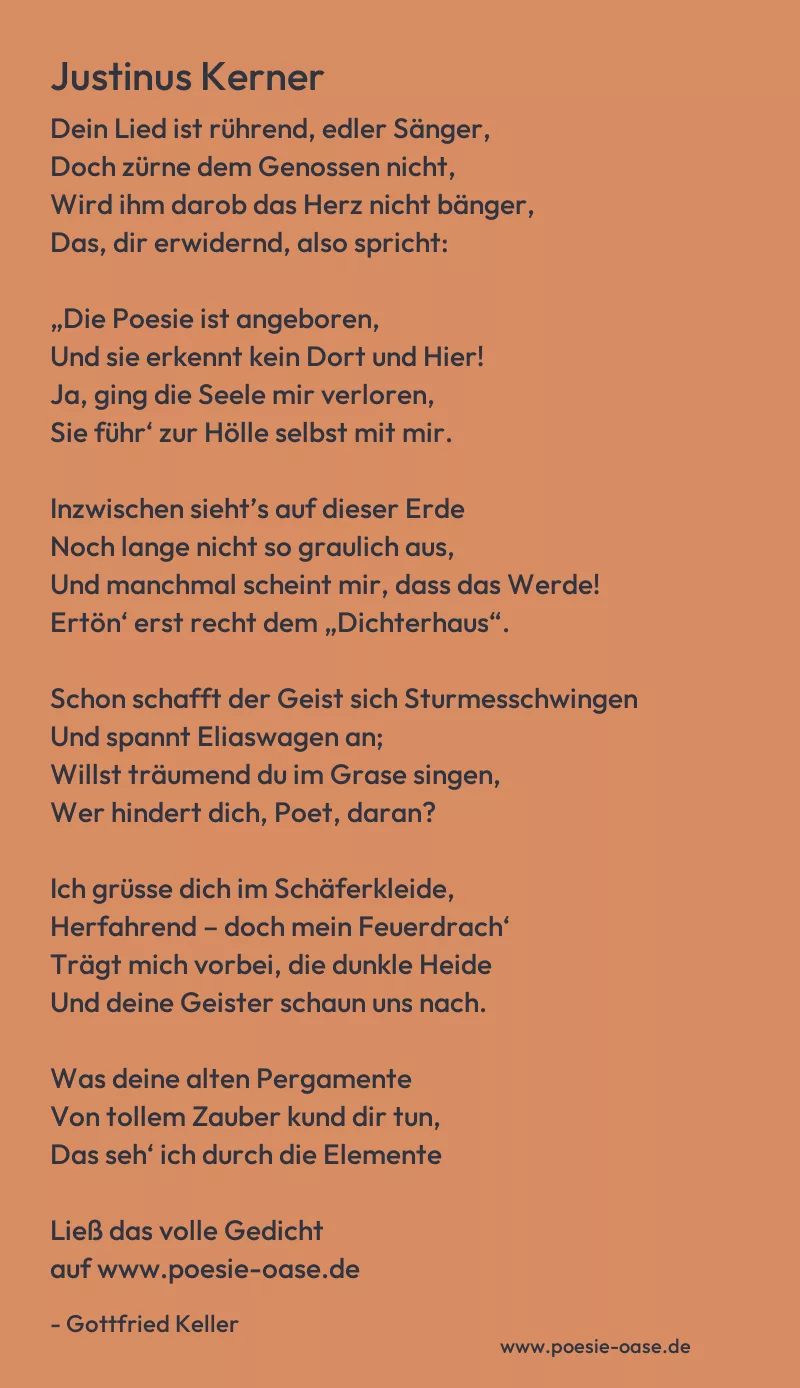Dein Lied ist rührend, edler Sänger,
Doch zürne dem Genossen nicht,
Wird ihm darob das Herz nicht bänger,
Das, dir erwidernd, also spricht:
„Die Poesie ist angeboren,
Und sie erkennt kein Dort und Hier!
Ja, ging die Seele mir verloren,
Sie führ‘ zur Hölle selbst mit mir.
Inzwischen sieht’s auf dieser Erde
Noch lange nicht so graulich aus,
Und manchmal scheint mir, dass das Werde!
Ertön‘ erst recht dem „Dichterhaus“.
Schon schafft der Geist sich Sturmesschwingen
Und spannt Eliaswagen an;
Willst träumend du im Grase singen,
Wer hindert dich, Poet, daran?
Ich grüsse dich im Schäferkleide,
Herfahrend – doch mein Feuerdrach‘
Trägt mich vorbei, die dunkle Heide
Und deine Geister schaun uns nach.
Was deine alten Pergamente
Von tollem Zauber kund dir tun,
Das seh‘ ich durch die Elemente
In Geistes Dienst verwirklicht nun.
Ich seh‘ sie keuchend glühn und sprühen,
Stahlschimmernd bauen Land und Stadt,
Indes das Menschenkind zu blühen
Und singen wieder Musse hat.
Und wenn vielleicht in hundert Jahren
Ein Luftschiff hoch mit Griechenwein
Durchs Morgenrot käm‘ hergefahren
Wer möchte da nicht Fährmann sein?
Dann bög‘ ich mich, ein sel’ger Zecher,
Wohl über Bord von Kränzen schwer,
Und gösse langsam meinen Becher
Hinab in das verlassne Meer.“