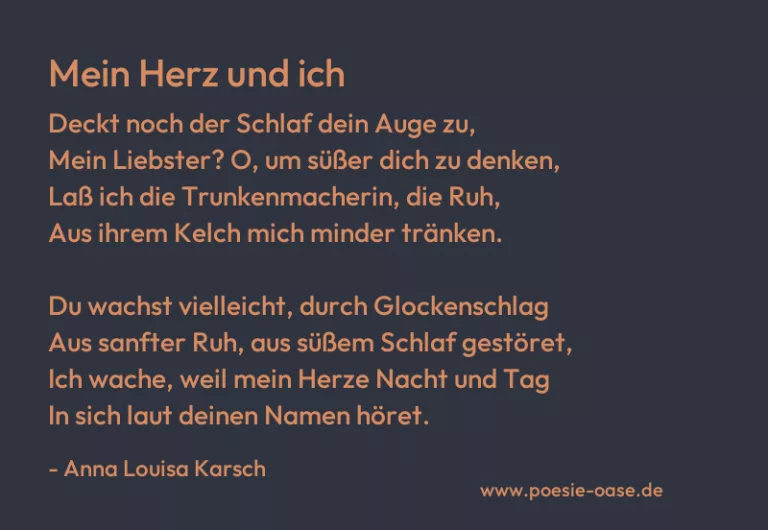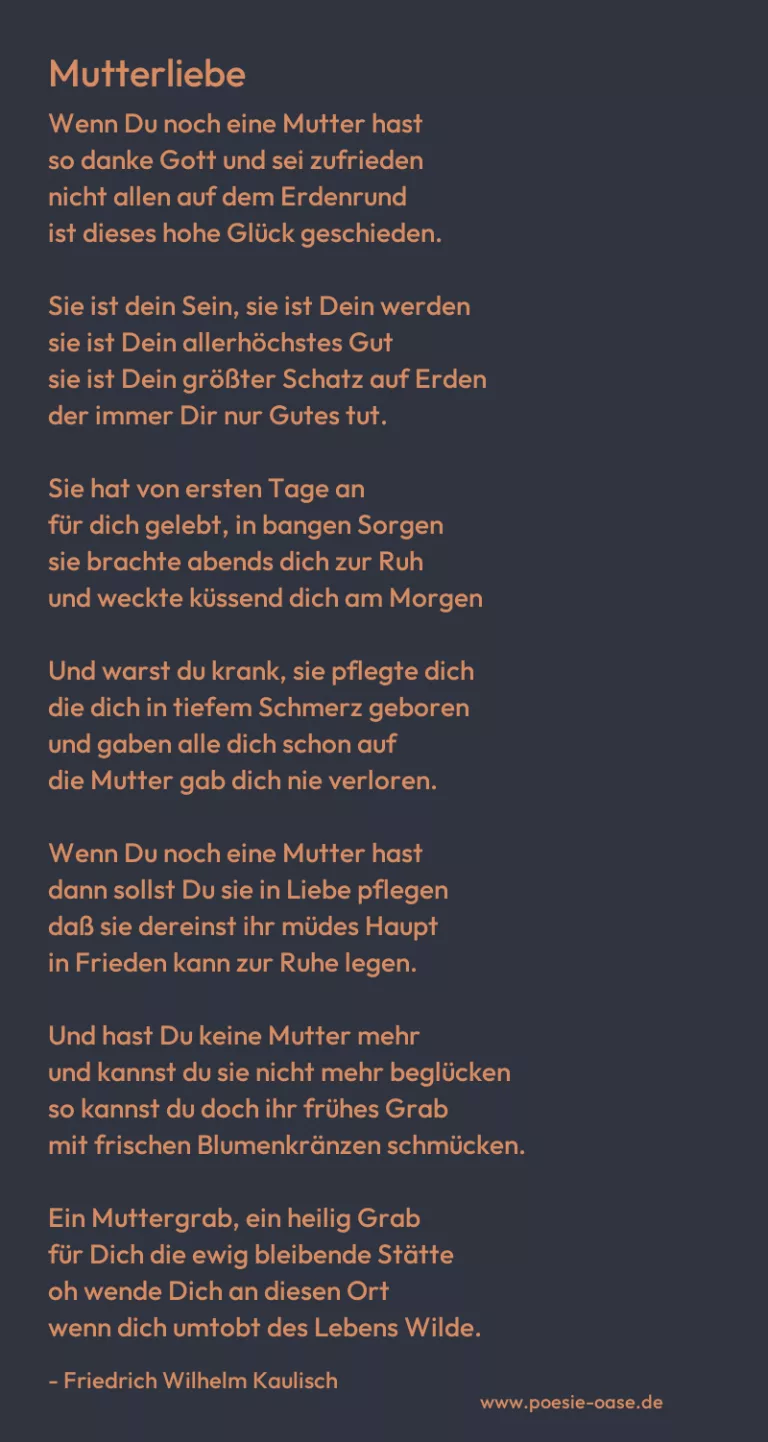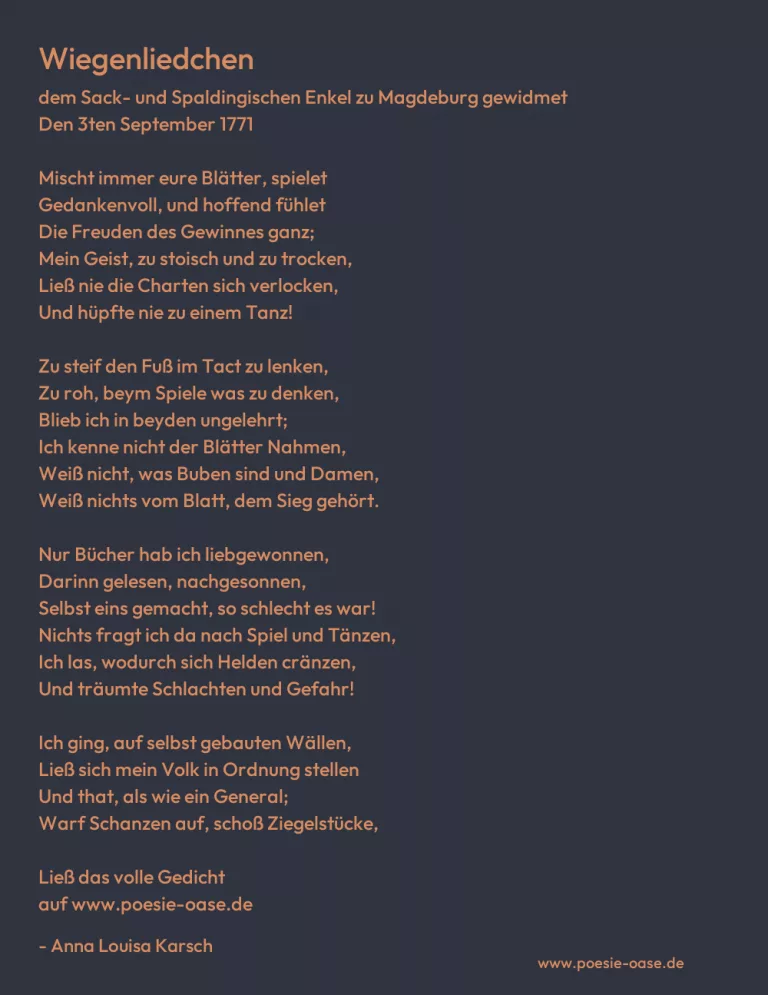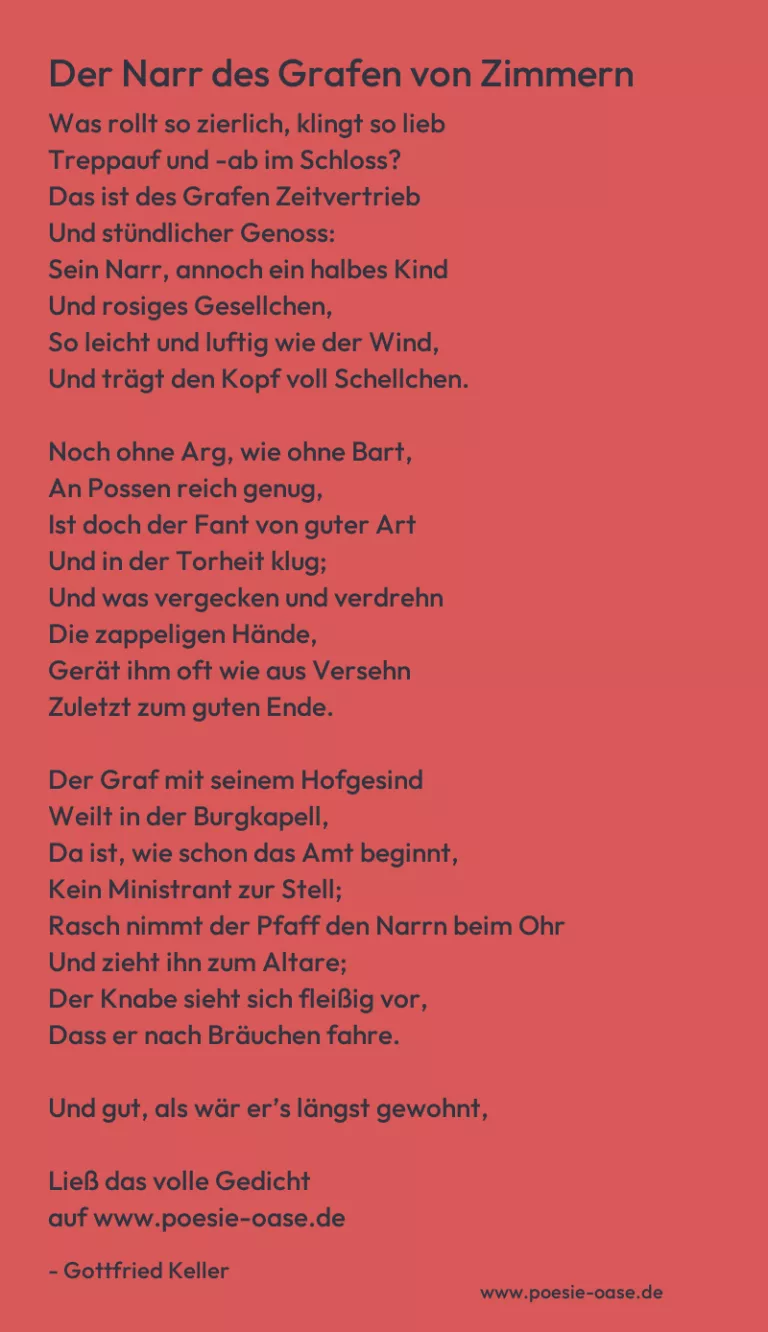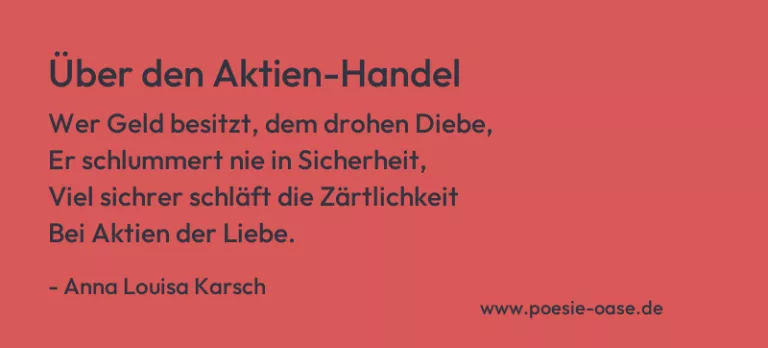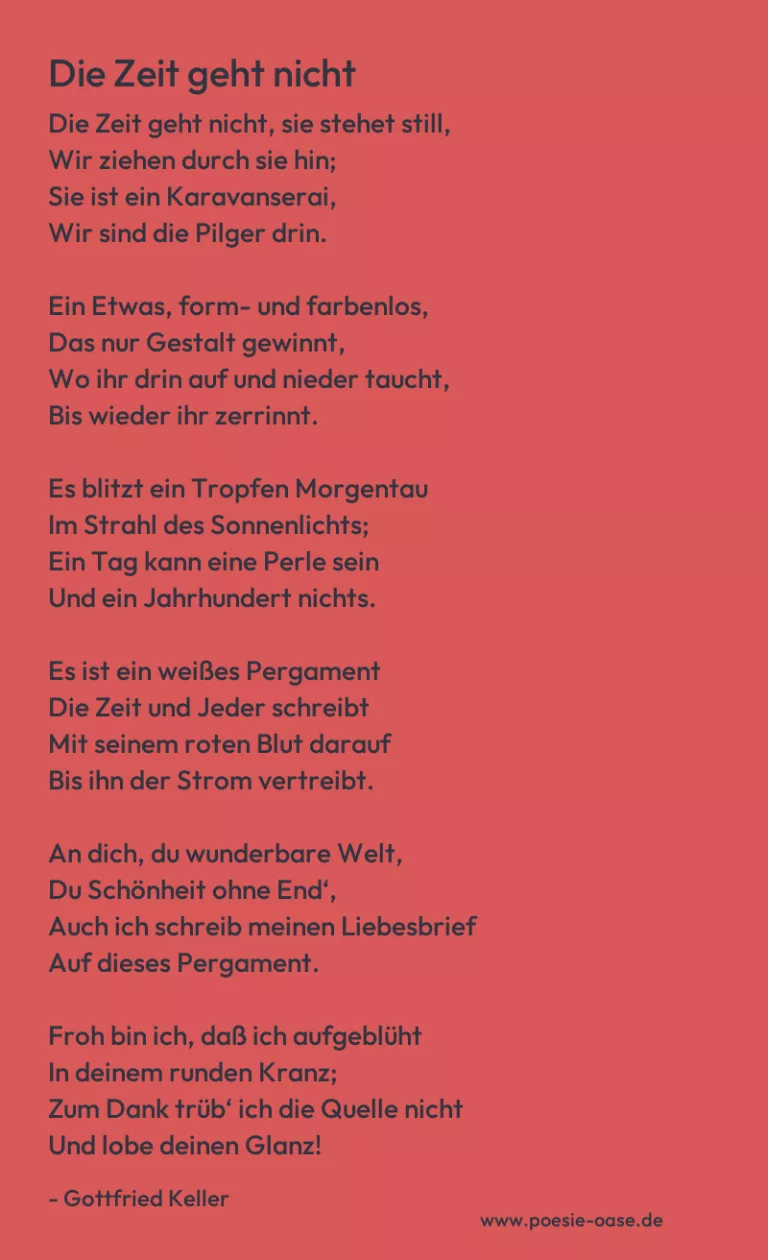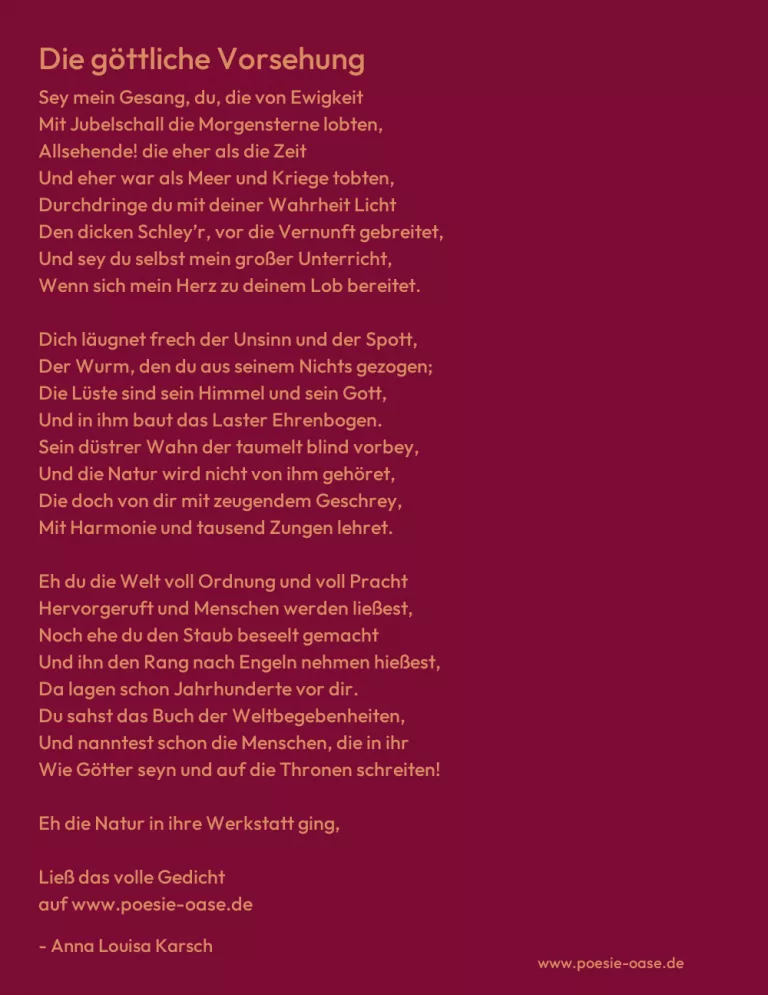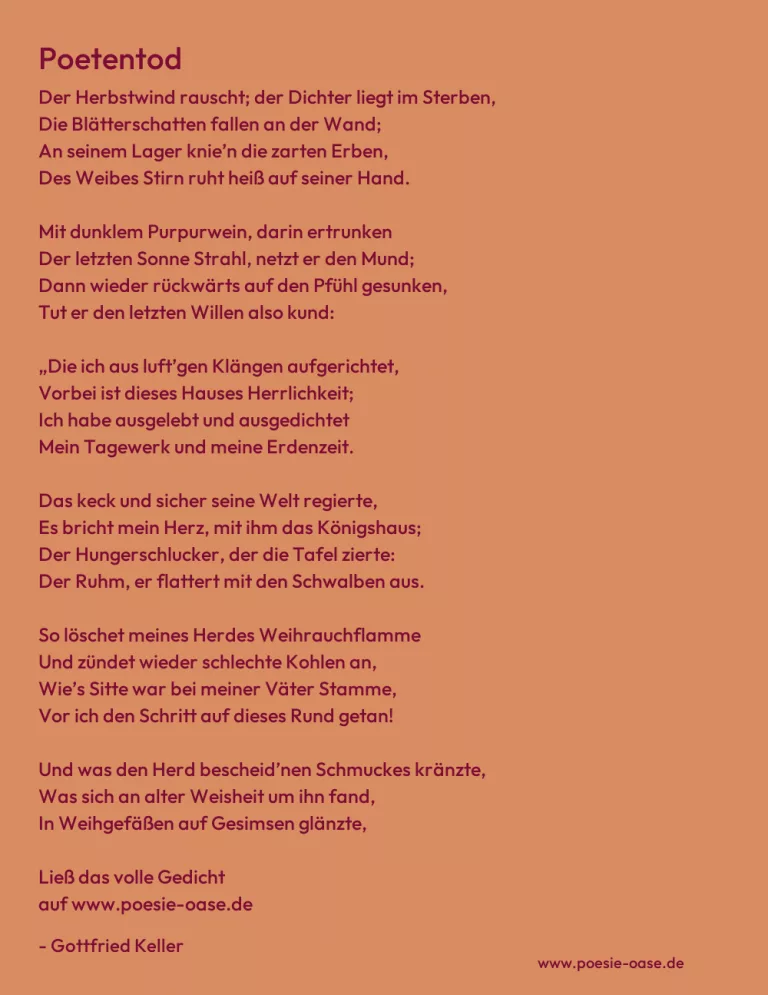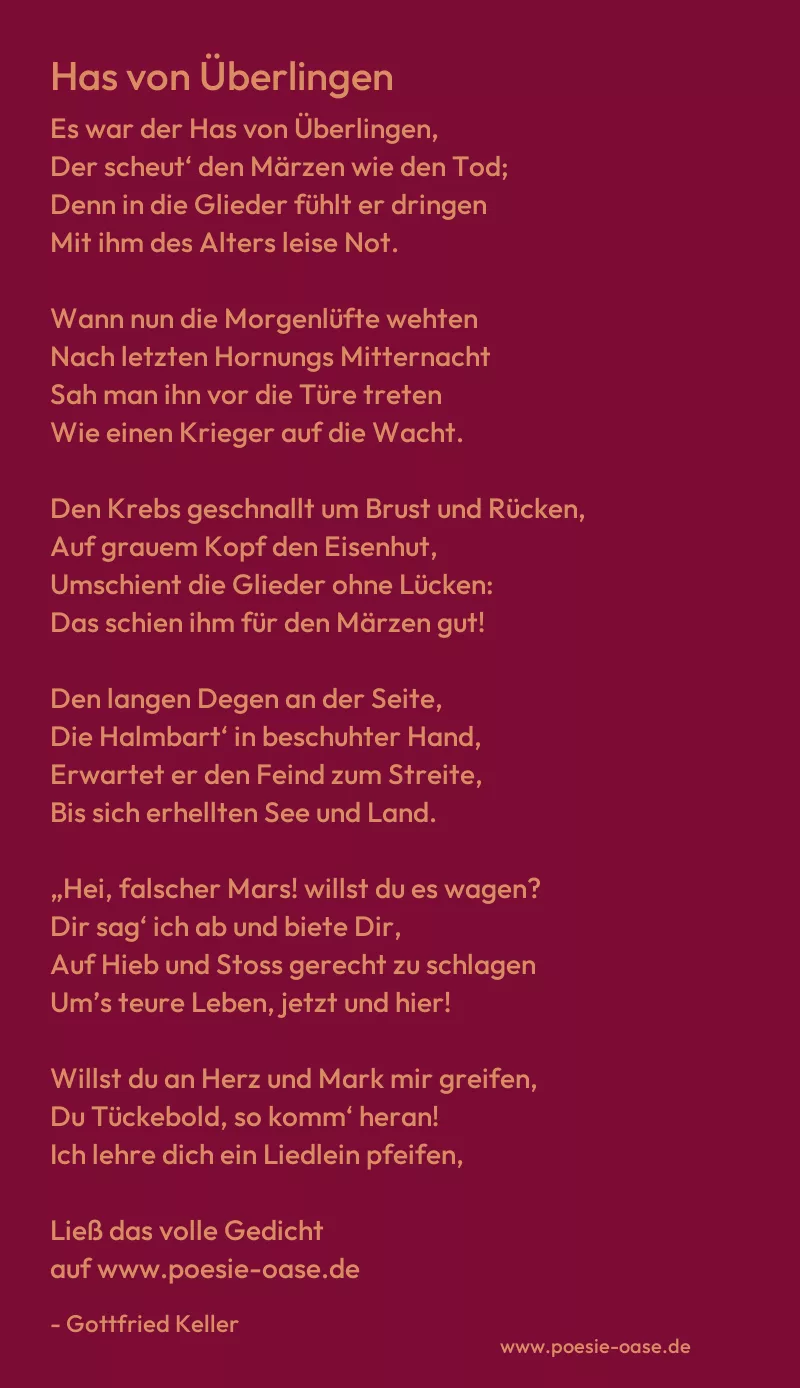Has von Überlingen
Es war der Has von Überlingen,
Der scheut‘ den Märzen wie den Tod;
Denn in die Glieder fühlt er dringen
Mit ihm des Alters leise Not.
Wann nun die Morgenlüfte wehten
Nach letzten Hornungs Mitternacht
Sah man ihn vor die Türe treten
Wie einen Krieger auf die Wacht.
Den Krebs geschnallt um Brust und Rücken,
Auf grauem Kopf den Eisenhut,
Umschient die Glieder ohne Lücken:
Das schien ihm für den Märzen gut!
Den langen Degen an der Seite,
Die Halmbart‘ in beschuhter Hand,
Erwartet er den Feind zum Streite,
Bis sich erhellten See und Land.
„Hei, falscher Mars! willst du es wagen?
Dir sag‘ ich ab und biete Dir,
Auf Hieb und Stoss gerecht zu schlagen
Um’s teure Leben, jetzt und hier!
Willst du an Herz und Mark mir greifen,
Du Tückebold, so komm‘ heran!
Ich lehre dich ein Liedlein pfeifen,
Du findest einen Martismann!“
Fuhr dann dem Alten rauh entgegen
Ein Staubgewölk im Sonnenschein,
Ein Schauer auch von Schnee und Regen,
So hieb und stach er mächtig drein.
Denn in dem Duste sah er drohen
Den Gegner mit gezücktem Speer;
Drum schlug er, bis der Spuk entflohen,
Und blickte siegreich um sich her.
Ein Trunk von goldnem Rebenblute
Erquickt ihn nach bestand’nem Streit,
Und er genoß mit frohem Mute
Des Frühlings neue Herrlichkeit.
So ging es denn nach seinem Willen;
Er schlug den Märzen Jahr um Jahr,
Bis einst am ersten Tag Aprillen
Sein tapfres Herz gebrochen war.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
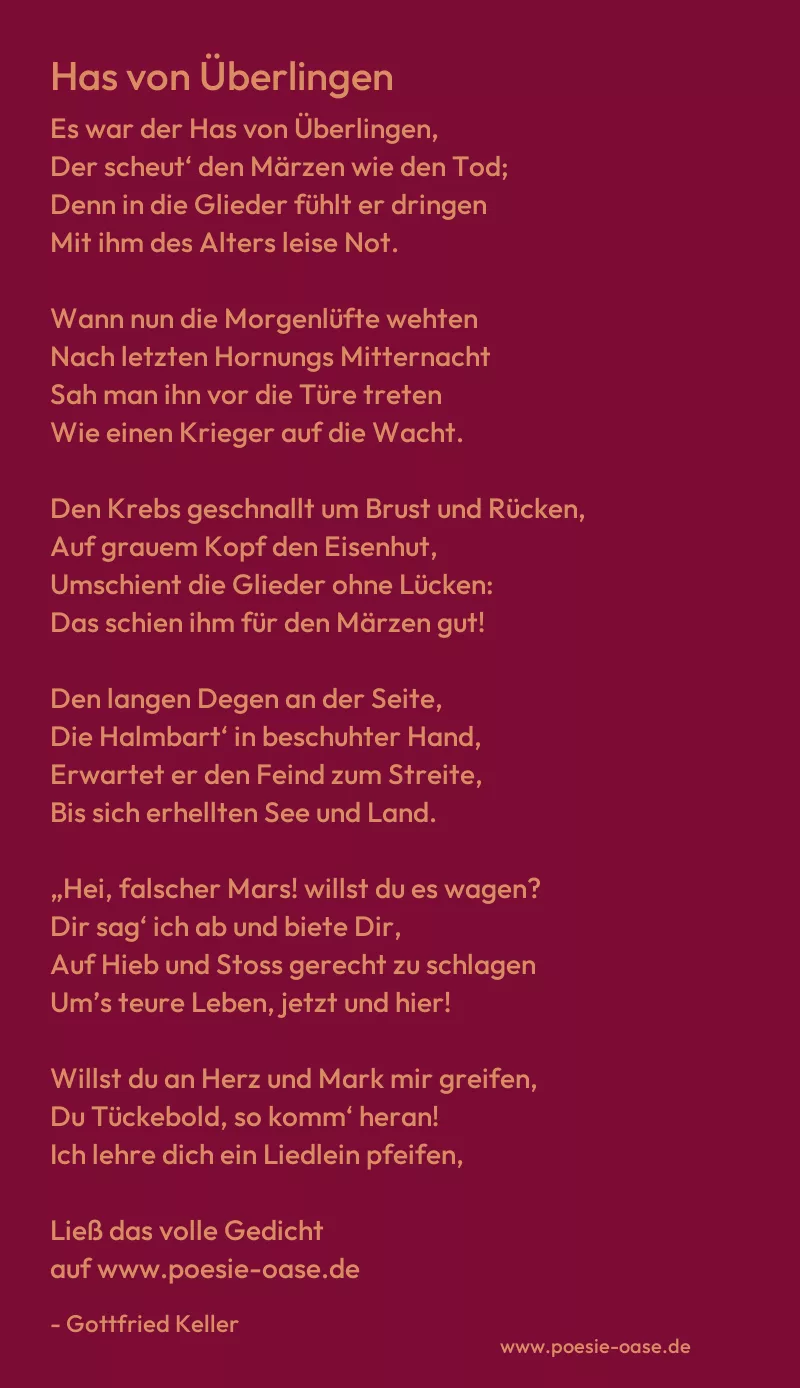
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Has von Überlingen“ von Gottfried Keller ist eine humorvoll-epische Charakterstudie, die in parodistischer Weise die Gestalt eines alten Mannes schildert, der dem März – der ersten Frühlingsluft – wie einem kriegerischen Gegner entgegentritt. Mit liebevoller Ironie verleiht Keller seinem „Has“ eine ritterlich-übersteigerte Haltung, durch die das Altern, die Vergänglichkeit und die menschliche Würde im Kampf gegen die Naturgewalten thematisiert werden.
Der Protagonist, „der Has von Überlingen“, fürchtet den März nicht aus meteorologischer Laune, sondern weil mit ihm „des Alters leise Not“ in die Glieder fährt – also Kälte, Krankheit, Schwäche. Anstatt sich zu schonen, rüstet sich der alte Mann jedoch wie ein Ritter: mit Helm, Degen, Bart (als Lanze), Schienen und dem symbolischen „Krebs“, der vielleicht auf ein orthopädisches oder medizinisches Hilfsmittel verweist. Diese martialische Aufrüstung macht ihn zur tragikomischen Heldenfigur.
In mehreren Strophen wird geschildert, wie er täglich vor die Tür tritt, bewaffnet dem März entgegenblickt, ihm den Kampf ansagt und sich imaginäre Schlachten mit ihm liefert. Keller spielt hier virtuos mit der Sprache des Heldengedichts, setzt sie jedoch in einen dörflich-bürgerlichen Kontext – das epische Pathos trifft auf alltägliche Wirklichkeit, was dem Gedicht seinen besonderen Reiz verleiht.
Der „März“ wird dabei personifiziert: als heimtückischer, falscher Mars, als Widersacher, der mit Staub, Wind, Schnee und Regen anrückt. In dieser stürmischen Verwirrung kämpft der alte Has tapfer, schlägt auf den Feind ein, bis sich das Wetter bessert – ein gefühlter Sieg, den er mit einem Trunk „goldnen Rebenbluts“ (also Wein) feiert. So wird die Naturbeobachtung zur Metapher des inneren Widerstands gegen Schwäche und Altern.
Doch am Ende bleibt auch diese Komödie nicht ohne Tragik: Am ersten April, dem Tag des Spotts und der Narrheit, stirbt der alte Kämpfer. Seine Todesstunde steht im ironischen Kontrast zu seinem heroischen Selbstbild – als hätte der März doch gesiegt, aber sich des Todes mit einem Augenzwinkern bedient. Damit gelingt Keller ein feines Gleichgewicht aus Würdigung und liebevoller Parodie.
„Has von Überlingen“ ist ein meisterhaftes Beispiel für Gottfried Kellers Fähigkeit, kleine menschliche Eigenheiten in große, fast mythische Bilder zu kleiden – und dabei stets das Komische mit dem Ernsten, das Spielerische mit dem Tiefsinn zu verbinden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.