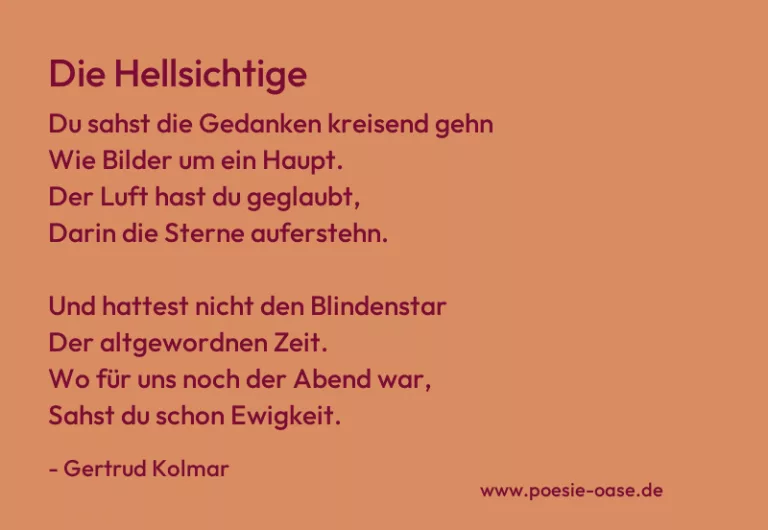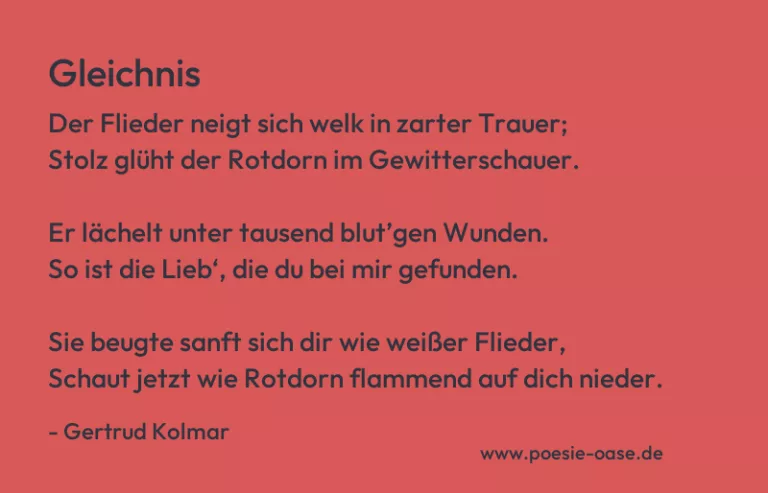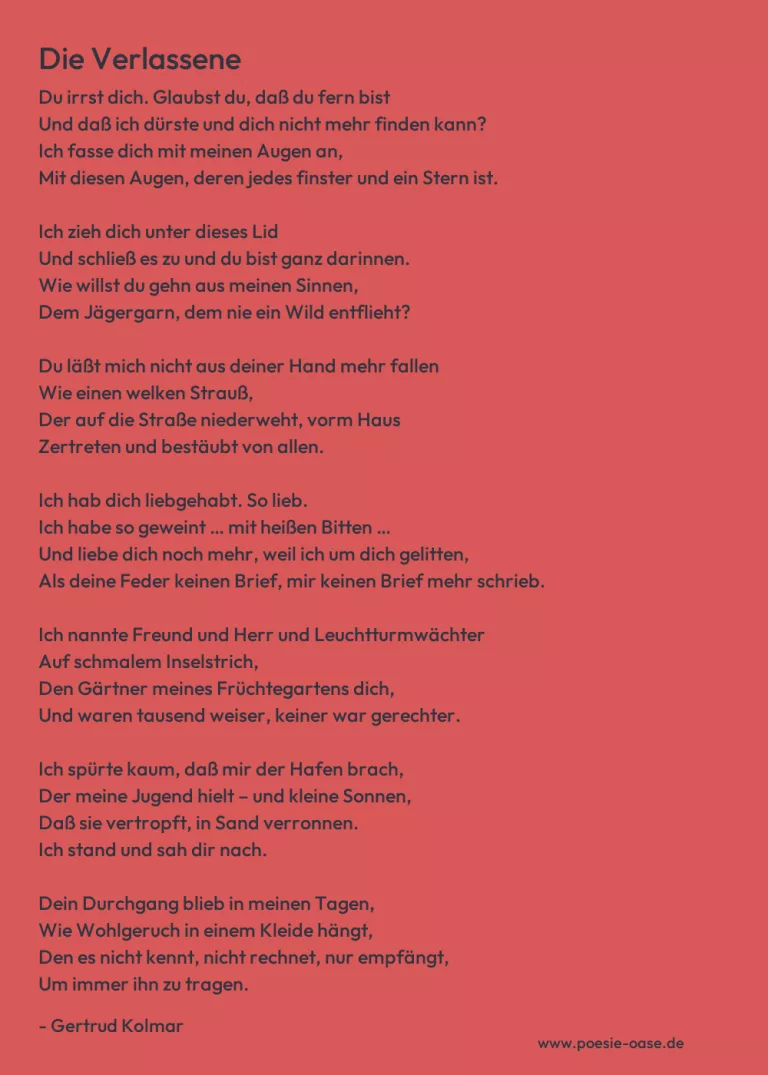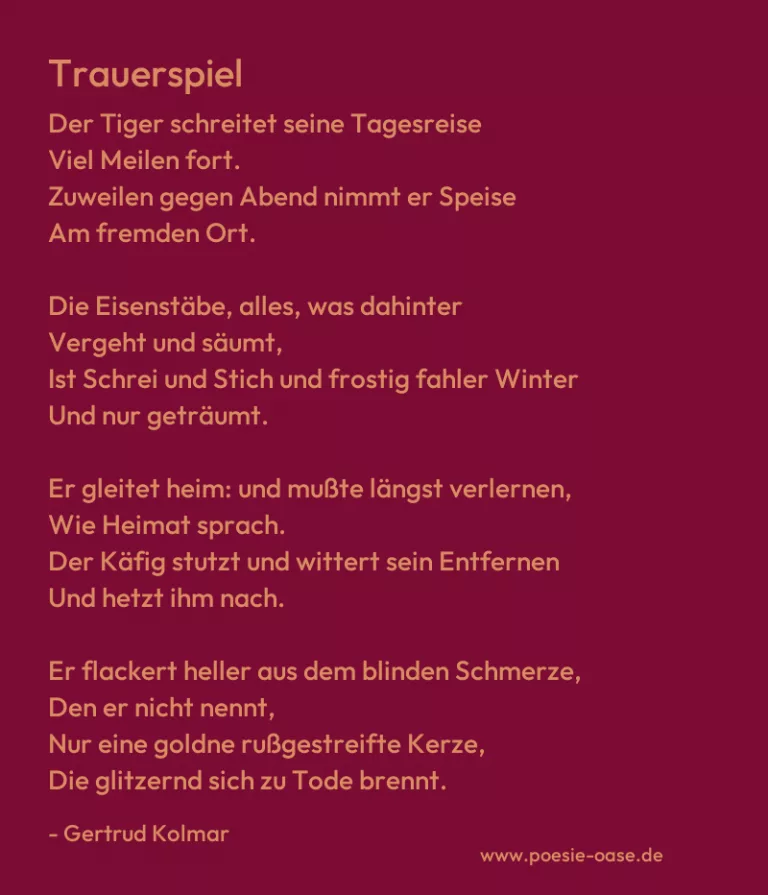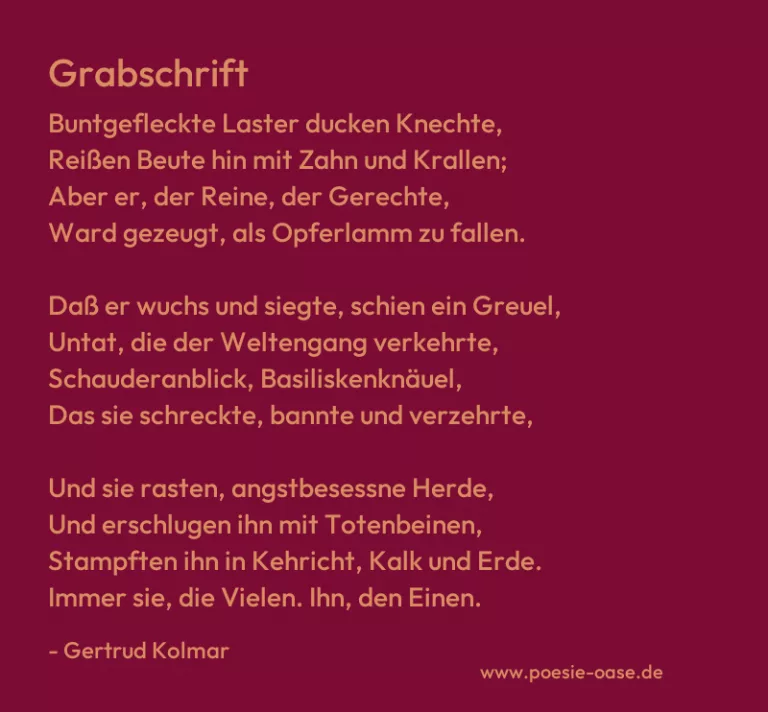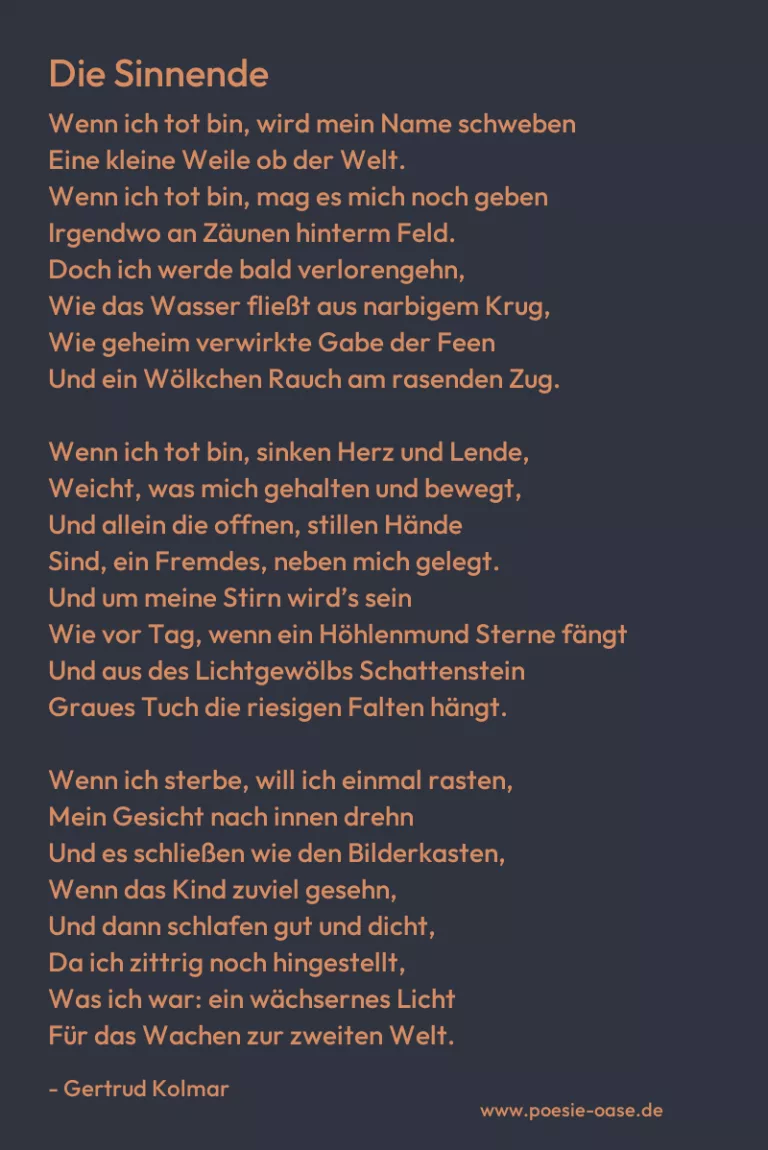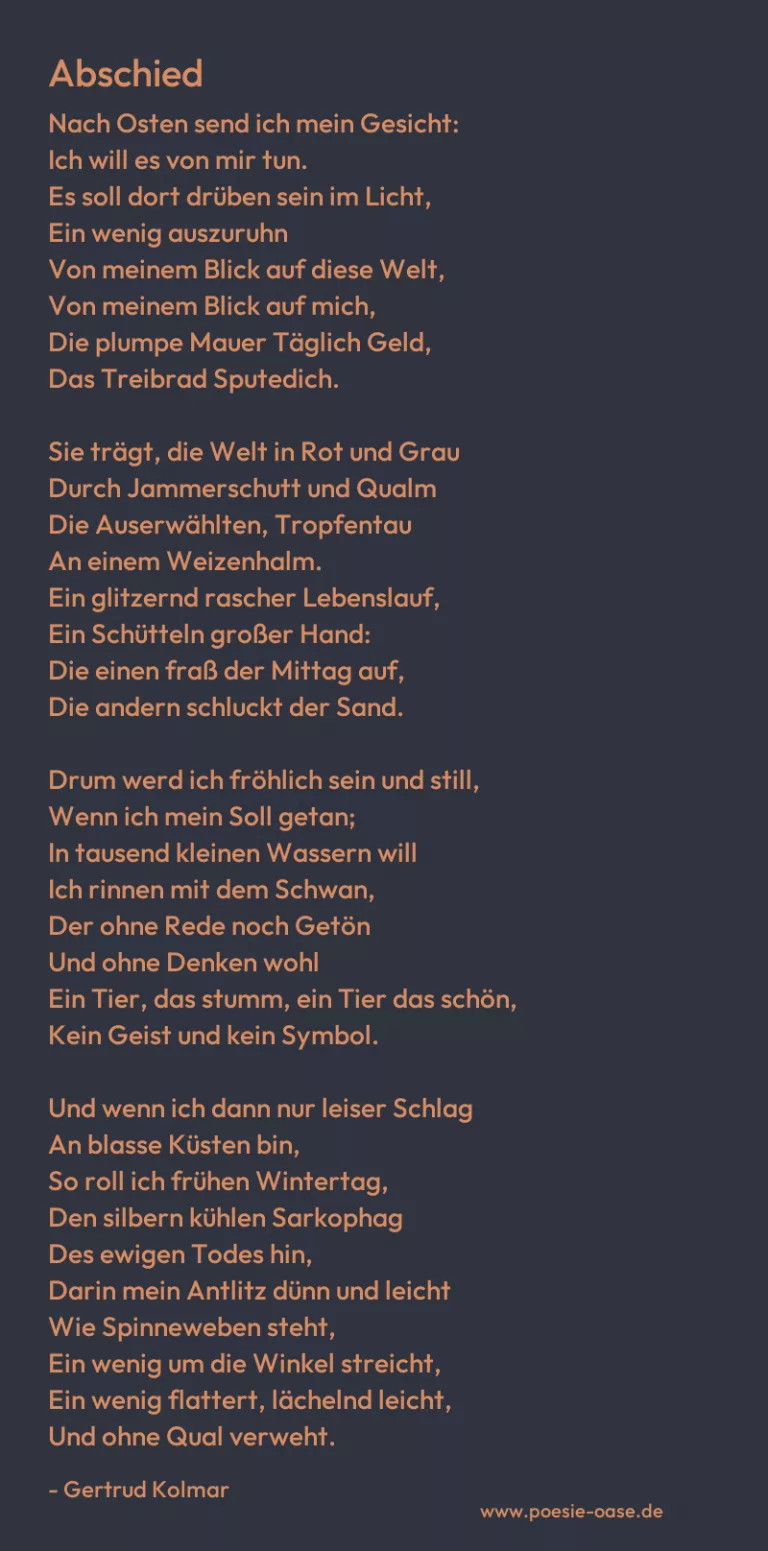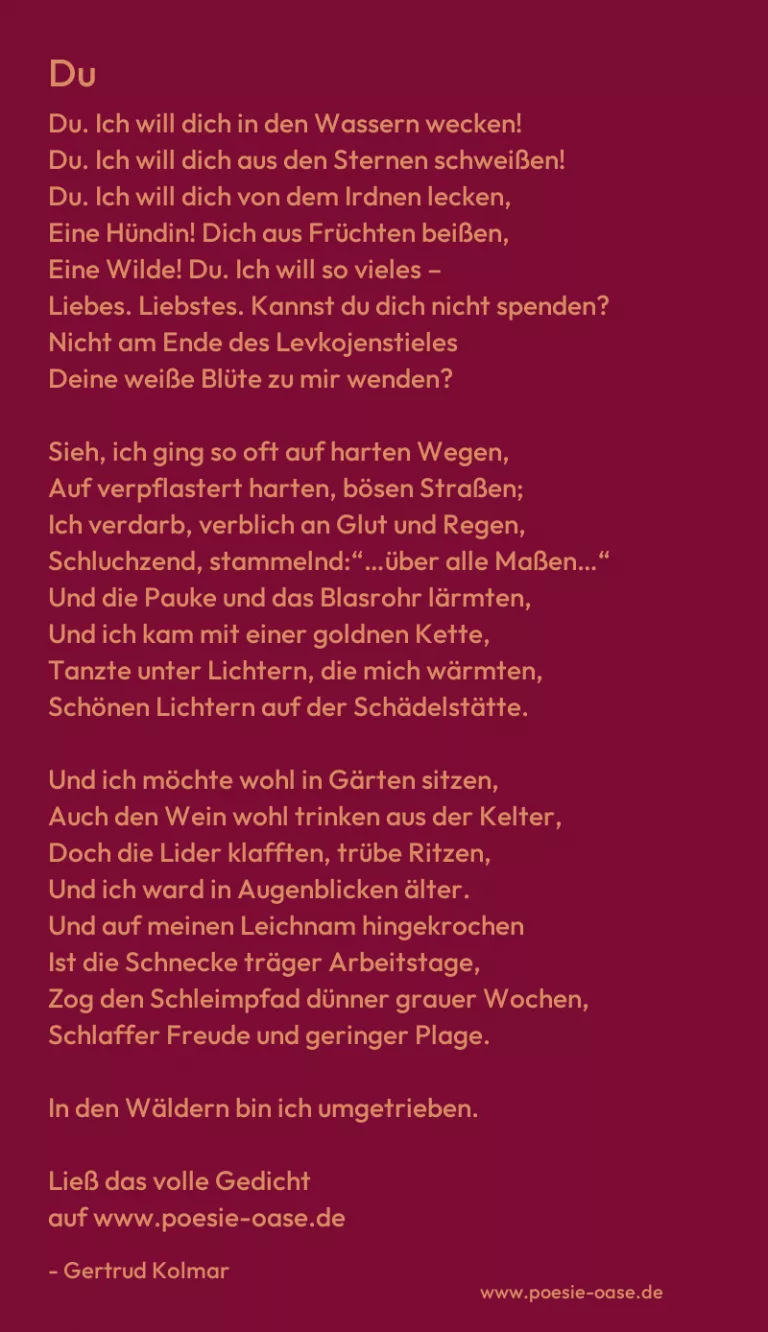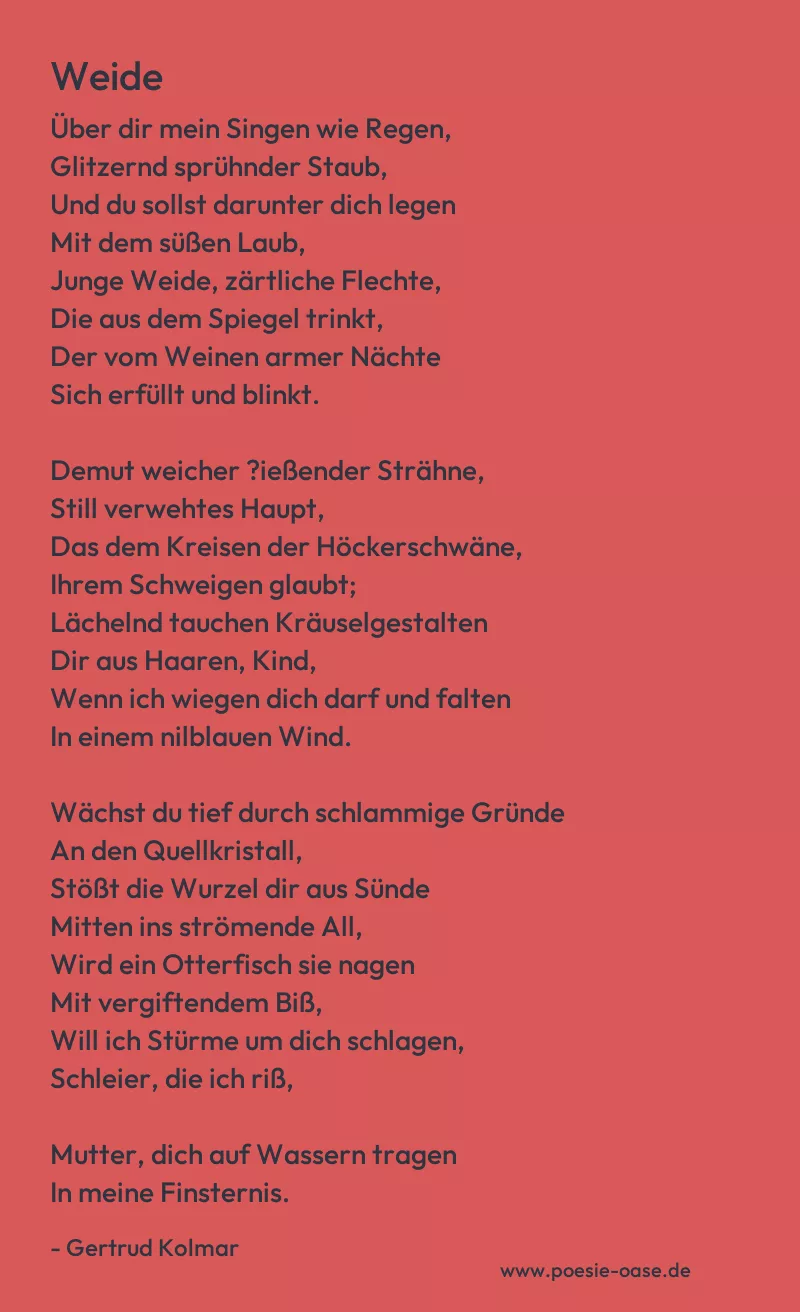Weide
Über dir mein Singen wie Regen,
Glitzernd sprühnder Staub,
Und du sollst darunter dich legen
Mit dem süßen Laub,
Junge Weide, zärtliche Flechte,
Die aus dem Spiegel trinkt,
Der vom Weinen armer Nächte
Sich erfüllt und blinkt.
Demut weicher ?ießender Strähne,
Still verwehtes Haupt,
Das dem Kreisen der Höckerschwäne,
Ihrem Schweigen glaubt;
Lächelnd tauchen Kräuselgestalten
Dir aus Haaren, Kind,
Wenn ich wiegen dich darf und falten
In einem nilblauen Wind.
Wächst du tief durch schlammige Gründe
An den Quellkristall,
Stößt die Wurzel dir aus Sünde
Mitten ins strömende All,
Wird ein Otterfisch sie nagen
Mit vergiftendem Biß,
Will ich Stürme um dich schlagen,
Schleier, die ich riß,
Mutter, dich auf Wassern tragen
In meine Finsternis.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
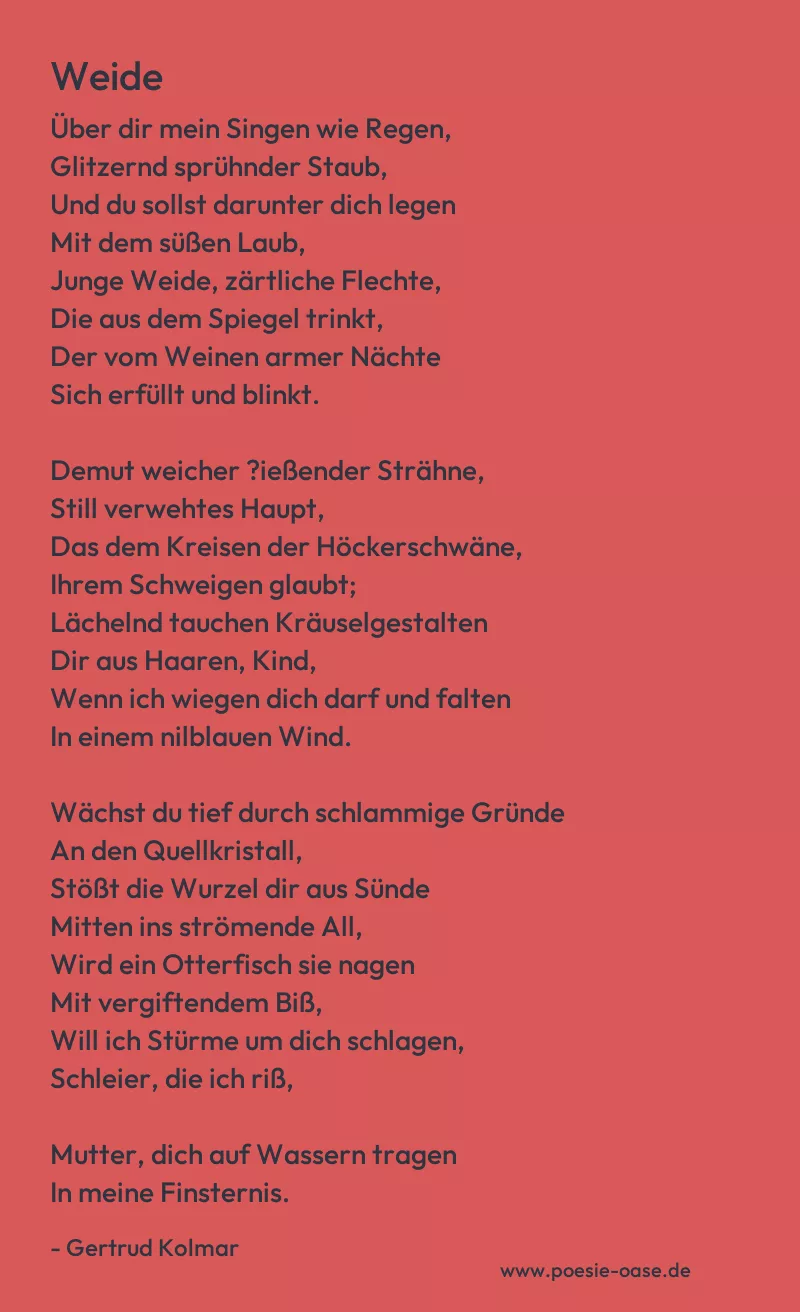
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Weide“ von Gertrud Kolmar entfaltet eine tiefe und zugleich zärtliche Beziehung zwischen der Sprecherin und der symbolischen „jungen Weide“. Die Weide, die in diesem Gedicht auf eine natürliche und fast göttliche Weise beschrieben wird, scheint eine vielschichtige Bedeutung zu tragen. In der ersten Strophe wird das Bild der Weide von einem „Singen wie Regen“ begleitet, was eine Atmosphäre von Sanftheit und Natürlichkeit schafft. Das „Glitzernd sprühende Laub“ und die zärtliche Flechte betonen die Zerbrechlichkeit und die Verletzlichkeit der Weide, die durch die Sprecherin behütet wird. Das „Weinen armer Nächte“ könnte auf vergangenes Leid und Verlust hindeuten, was die Weide in ihrer Umgebung aufnimmt, während die Sprecherin mit Fürsorge darüber wacht.
Im zweiten Teil des Gedichts wird das Bild der Weide noch intensiver mit der Natur und dem Leben verbunden. Die „Demut weicher fließender Strähne“ und das „still verwehte Haupt“ vermitteln eine ruhige, hingebungsvolle Haltung, die die Weide in eine fast mütterliche oder schützende Rolle versetzen. Die „Höckerschwäne“ und das „Schweigen“ beziehen sich möglicherweise auf eine gewisse Würde und Stille, die die Weide als Symbol für Unschuld und Harmonie in sich trägt. Das Wiegen und Falten der Weide in „nilblauen Wind“ schafft ein Bild von Schutz und Geborgenheit, das eine enge Verbindung zwischen der Sprecherin und der Weide hervorruft.
In der dritten Strophe, die einen Kontrast zu den vorherigen ruhigen Bildern bildet, wird die Weide in einer schwierigeren, gefährlicheren Umwelt dargestellt. Sie wächst „durch schlammige Gründe“ und stößt ihre Wurzeln in die „Sünde“, was auf eine Auseinandersetzung mit dunklen, schwierigen Aspekten des Lebens hinweist. Der „Otterfisch“, der die Wurzel mit seinem „vergiftenden Biß“ anfrisst, bringt eine Bedrohung ins Bild, gegen die sich die Sprecherin in Form von „Stürmen“ zur Wehr setzt. Diese Passage symbolisiert möglicherweise den Kampf gegen äußere Kräfte, die das Wachstum und das Leben der Weide bedrohen. Die Sprecherin ist bereit, gegen diese Bedrohungen anzukämpfen, um die Weide zu schützen.
Am Ende des Gedichts stellt sich die Sprecherin als eine Art Mutterfigur dar, die die Weide „auf Wassern trägt“ und in „meine Finsternis“ führt. Dies könnte ein Hinweis auf die Verbindung zwischen der Sprecherin und der Weide als symbolische Darstellung eines Geliebten oder eines inneren Teils der Sprecherin selbst sein. Die „Finsternis“ könnte auf die tieferen, unbekannten Aspekte des Selbst hinweisen, in denen die Weide wie ein zarter, verletzlicher Teil des Ichs geborgen wird. Kolmar beschreibt auf eindrucksvolle Weise den inneren Konflikt zwischen Fürsorge, Schutz und den Gefahren des Lebens, während sie die Weide als zentrales Symbol für diese komplexen Beziehungen einsetzt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.