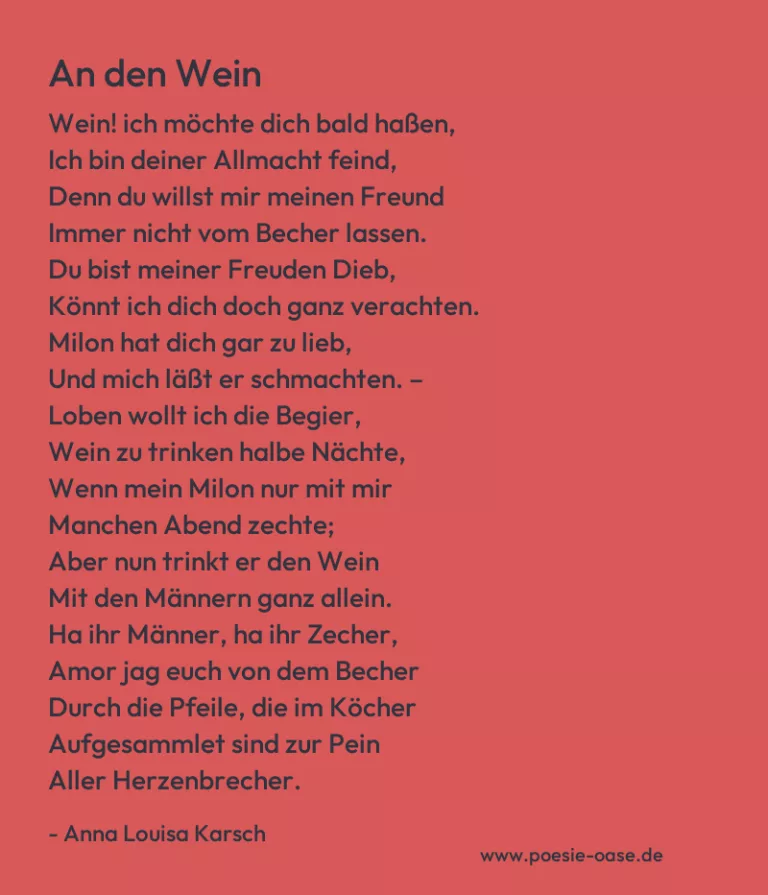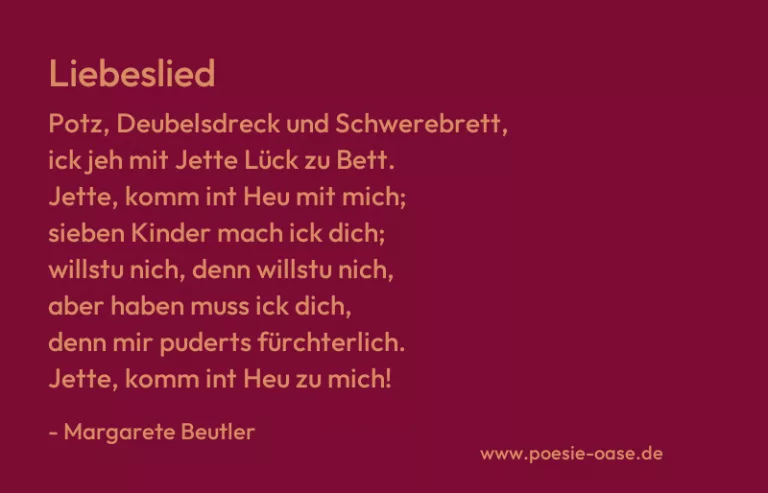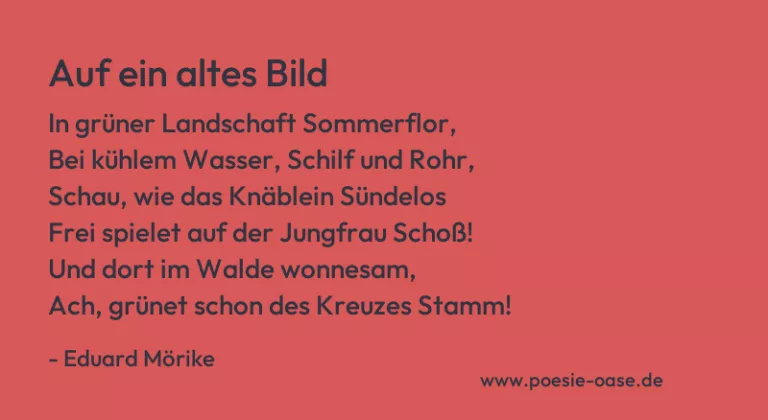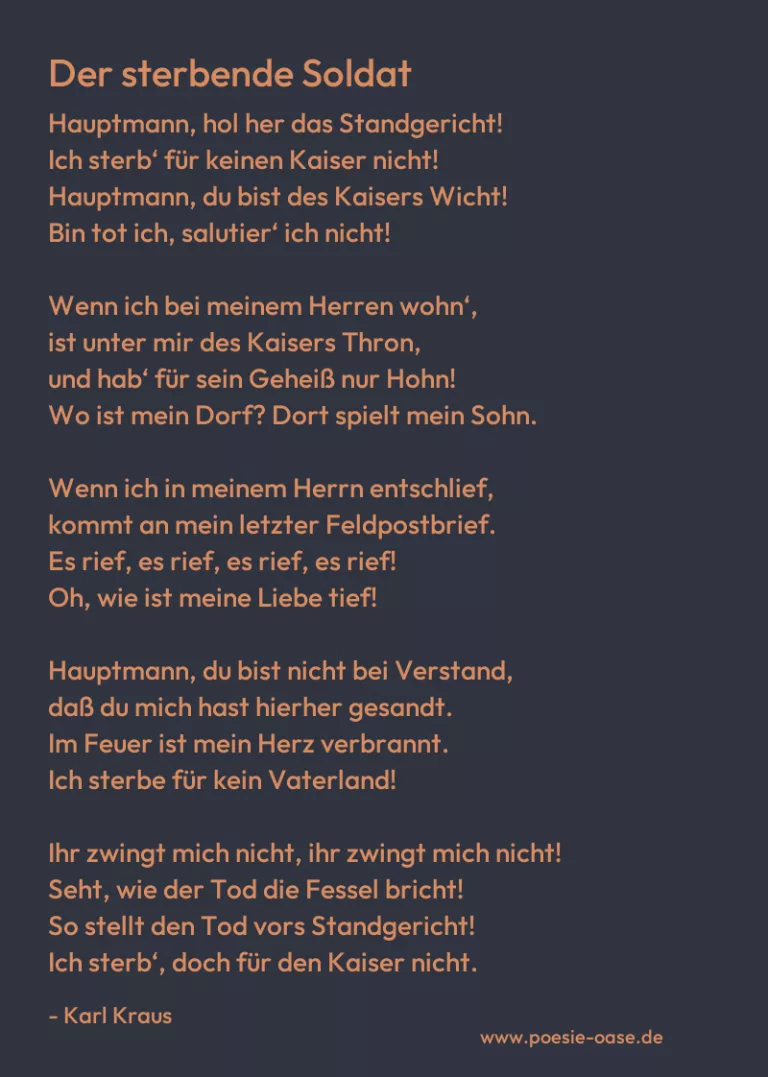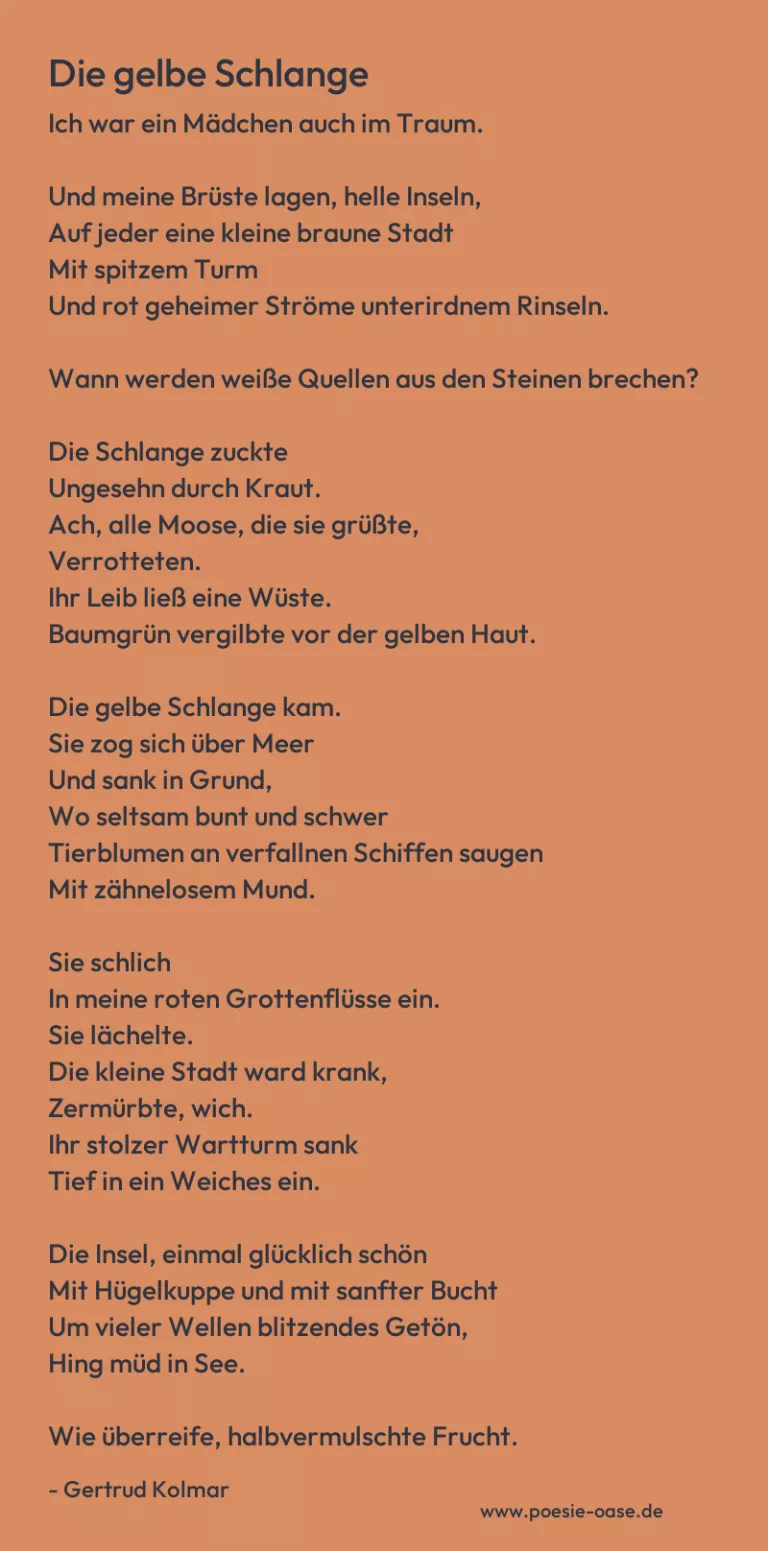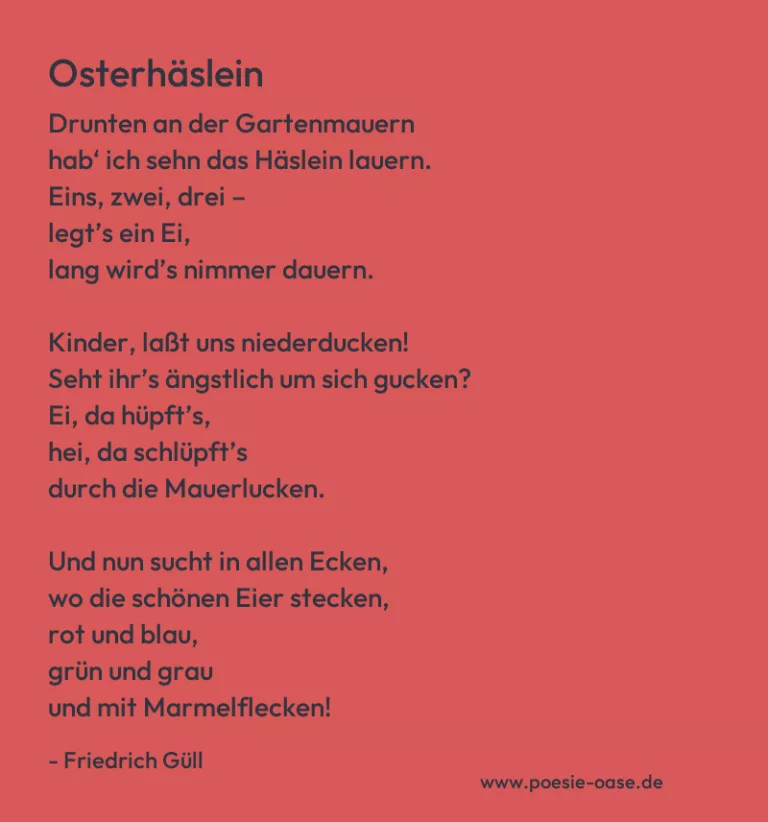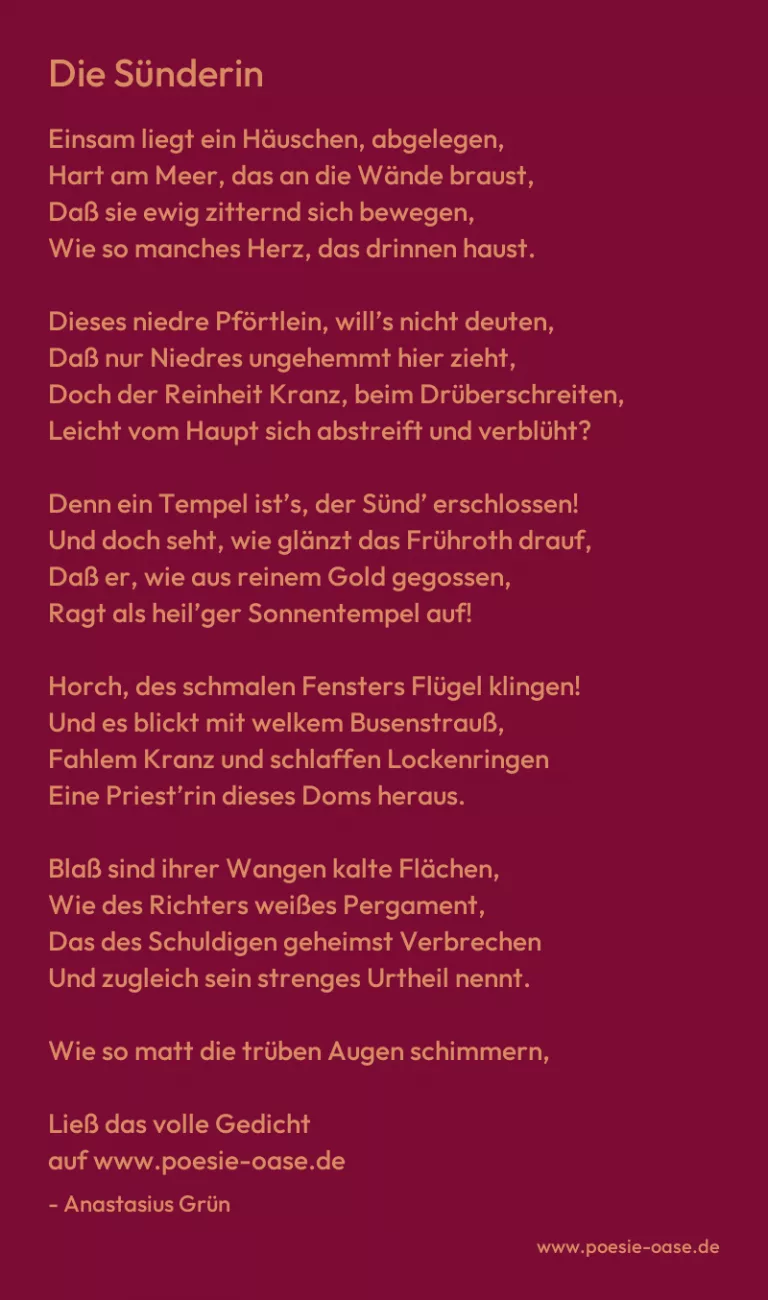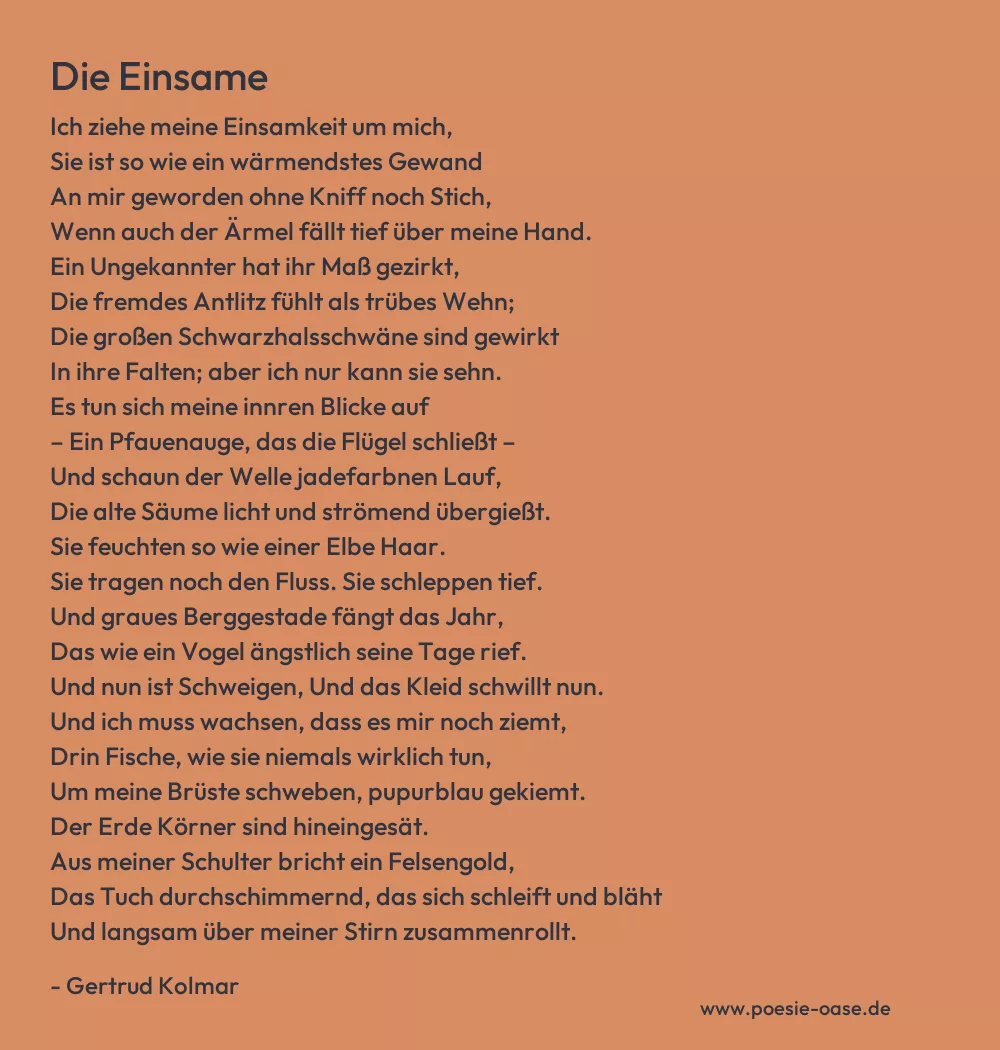Die Einsame
Ich ziehe meine Einsamkeit um mich,
Sie ist so wie ein wärmendstes Gewand
An mir geworden ohne Kniff noch Stich,
Wenn auch der Ärmel fällt tief über meine Hand.
Ein Ungekannter hat ihr Maß gezirkt,
Die fremdes Antlitz fühlt als trübes Wehn;
Die großen Schwarzhalsschwäne sind gewirkt
In ihre Falten; aber ich nur kann sie sehn.
Es tun sich meine innren Blicke auf
– Ein Pfauenauge, das die Flügel schließt –
Und schaun der Welle jadefarbnen Lauf,
Die alte Säume licht und strömend übergießt.
Sie feuchten so wie einer Elbe Haar.
Sie tragen noch den Fluss. Sie schleppen tief.
Und graues Berggestade fängt das Jahr,
Das wie ein Vogel ängstlich seine Tage rief.
Und nun ist Schweigen, Und das Kleid schwillt nun.
Und ich muss wachsen, dass es mir noch ziemt,
Drin Fische, wie sie niemals wirklich tun,
Um meine Brüste schweben, pupurblau gekiemt.
Der Erde Körner sind hineingesät.
Aus meiner Schulter bricht ein Felsengold,
Das Tuch durchschimmernd, das sich schleift und bläht
Und langsam über meiner Stirn zusammenrollt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
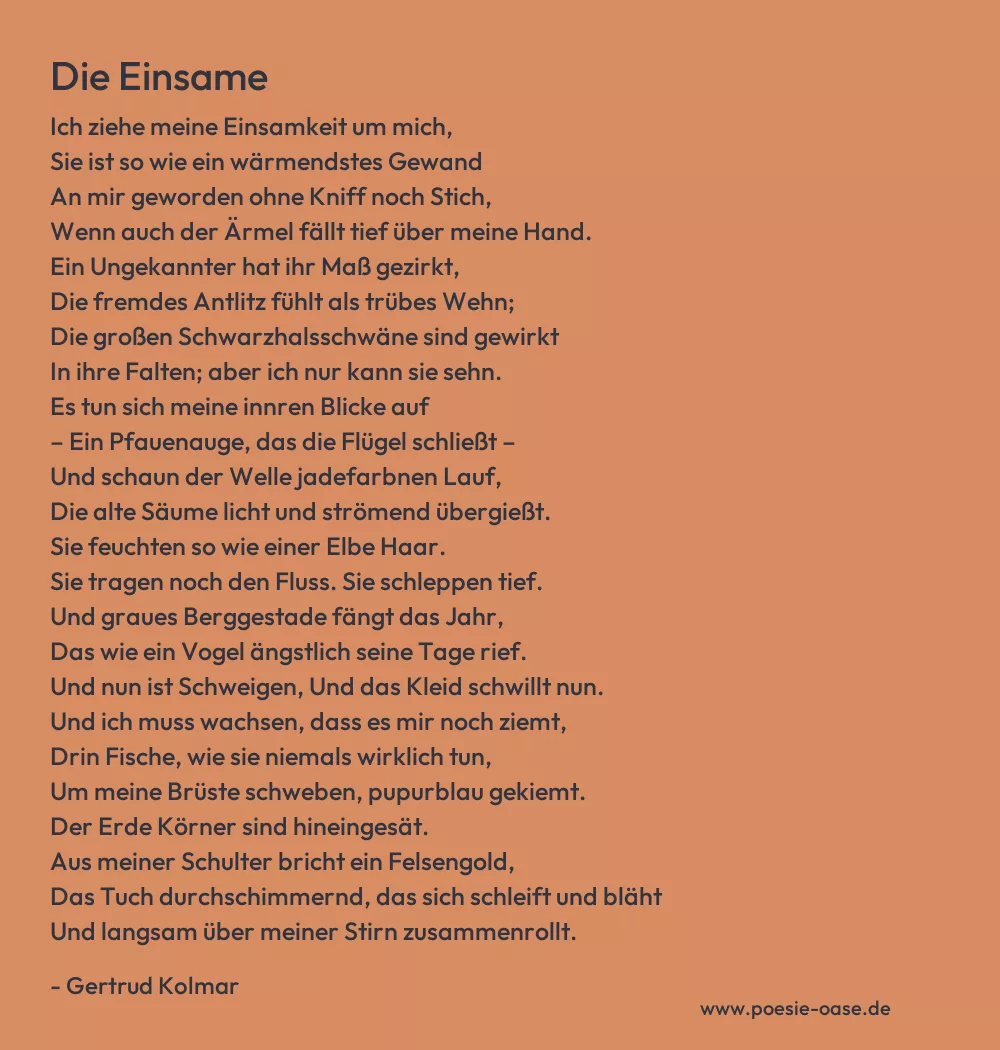
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Einsame“ von Gertrud Kolmar thematisiert die Einsamkeit als ein zutiefst persönliches und gleichzeitig kraftvolles Element der Existenz. Zu Beginn beschreibt die lyrische Sprecherin, wie die Einsamkeit zu ihrem „wärmendsten Gewand“ wird, das sie wie eine vertraute Hülle umhüllt. Dieses Gewand ist so eng mit ihr verwoben, dass es „ohne Kniff noch Stich“ an ihr hängt, was die Untrennbarkeit und die fast körperliche Präsenz der Einsamkeit symbolisiert. Der fallende Ärmel, der „tief über ihre Hand“ reicht, könnte als ein Hinweis auf das Gefühl der Begrenzung oder der Unbeweglichkeit verstanden werden, die mit Einsamkeit einhergehen kann.
In der zweiten Strophe wird die Einsamkeit als ein von einem „Ungekannten“ geschaffenes, fremdes Gewand beschrieben, dessen Maß und Form nicht der Sprecherin selbst gehören, sondern von einer äußeren, unbekannten Quelle bestimmt wurden. Das Bild der „großen Schwarzhalsschwäne“ in den Falten der Einsamkeit verleiht dem Gewand eine mystische und beinahe unheimliche Qualität, die nur von der Sprecherin selbst wahrgenommen wird. Die Schilderung ihres inneren Blicks, der sich wie ein „Pfauenauge“ öffnet, unterstreicht die Introspektivität und die tiefen, emotionalen Strömungen, die in ihr wirken.
Die dritte Strophe führt diese innere Reise fort, indem sie den Blick auf die „jadefarbene Welle“ und das „alte Säume“ lenkt, das von der Zeit und den Erinnerungen überschüttet wird. Diese Wasserbilder und der Fluss, der tief und schwer durch das Gedicht zieht, könnten für die unergründlichen und manchmal schmerzhaften Gedanken und Emotionen stehen, die die Sprecherin in ihrer Einsamkeit trägt. Das „graue Berggestade“ und der „Vogel, der seine Tage rief“, sind weitere Symbole für die Vergänglichkeit und die ständige Veränderung, die die Einsamkeit in sich birgt.
In der letzten Strophe wächst das Bild der Einsamkeit zu einem beinahe mystischen Akt der Verwandlung und der Selbstentfaltung. Die „Brüste“, die von Fischen „pupurblau gekiemt“ schweben, symbolisieren sowohl die Fruchtbarkeit als auch die Verletzlichkeit der Sprecherin. Das „Felsengold“, das aus ihrer Schulter bricht, verweist auf eine innere Stärke und auf das goldene Potential, das in ihr verborgen ist. Die Bewegung des Gewandes und das langsam „zusammenrollende Tuch“ auf ihrer Stirn symbolisieren eine fortwährende Veränderung und Transformation der Identität, die im Prozess der Einsamkeit und Selbstfindung stattfindet.
Das Gedicht entwirft ein Bild der Einsamkeit, das von einer Mischung aus Schmerz, Mystik und innerer Kraft durchzogen ist. Kolmar nutzt starke, bildhafte Sprache, um die Einsamkeit sowohl als Last als auch als Möglichkeit der Selbstverwirklichung darzustellen, die den Raum für innere Entwicklung und Veränderung schafft.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.