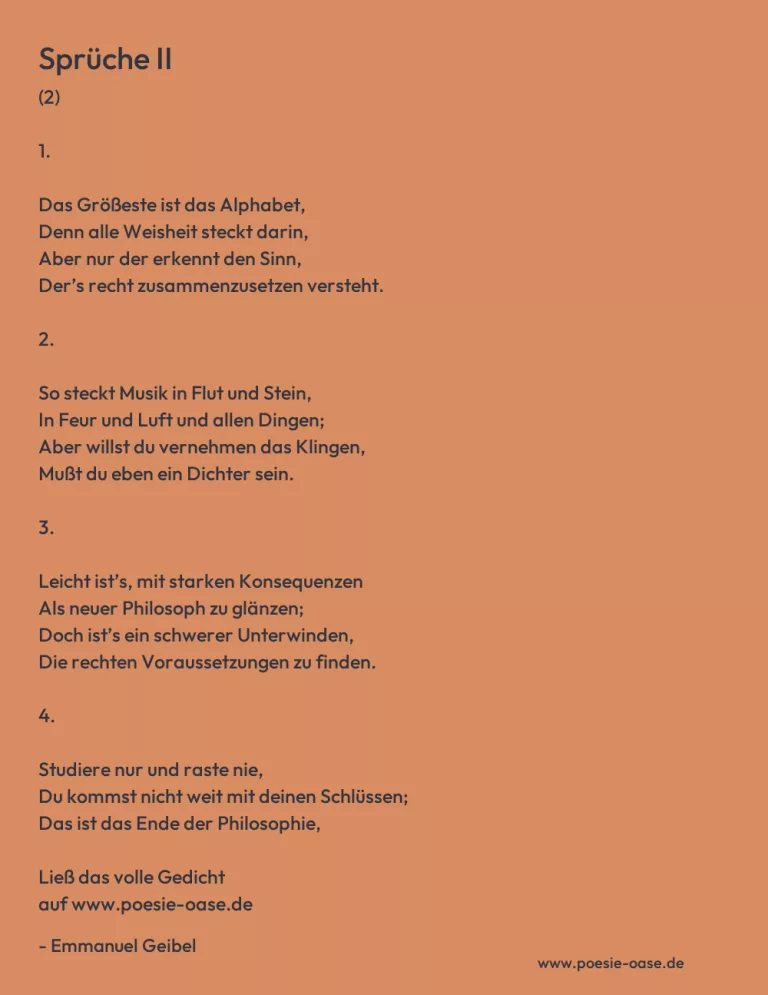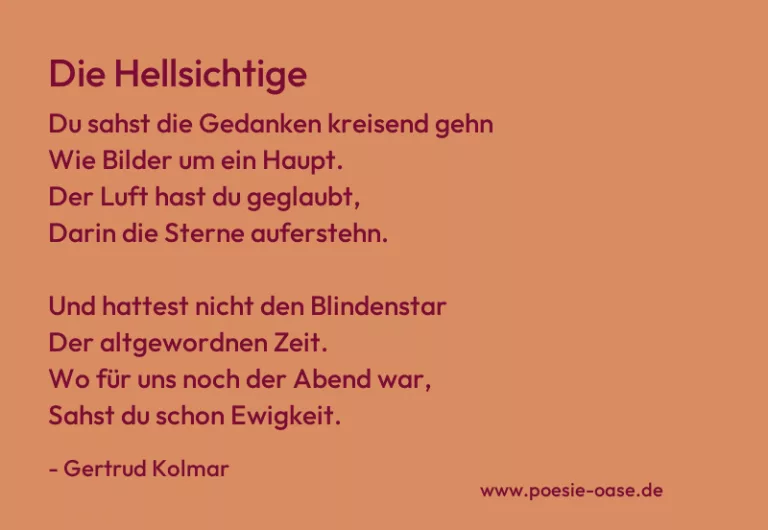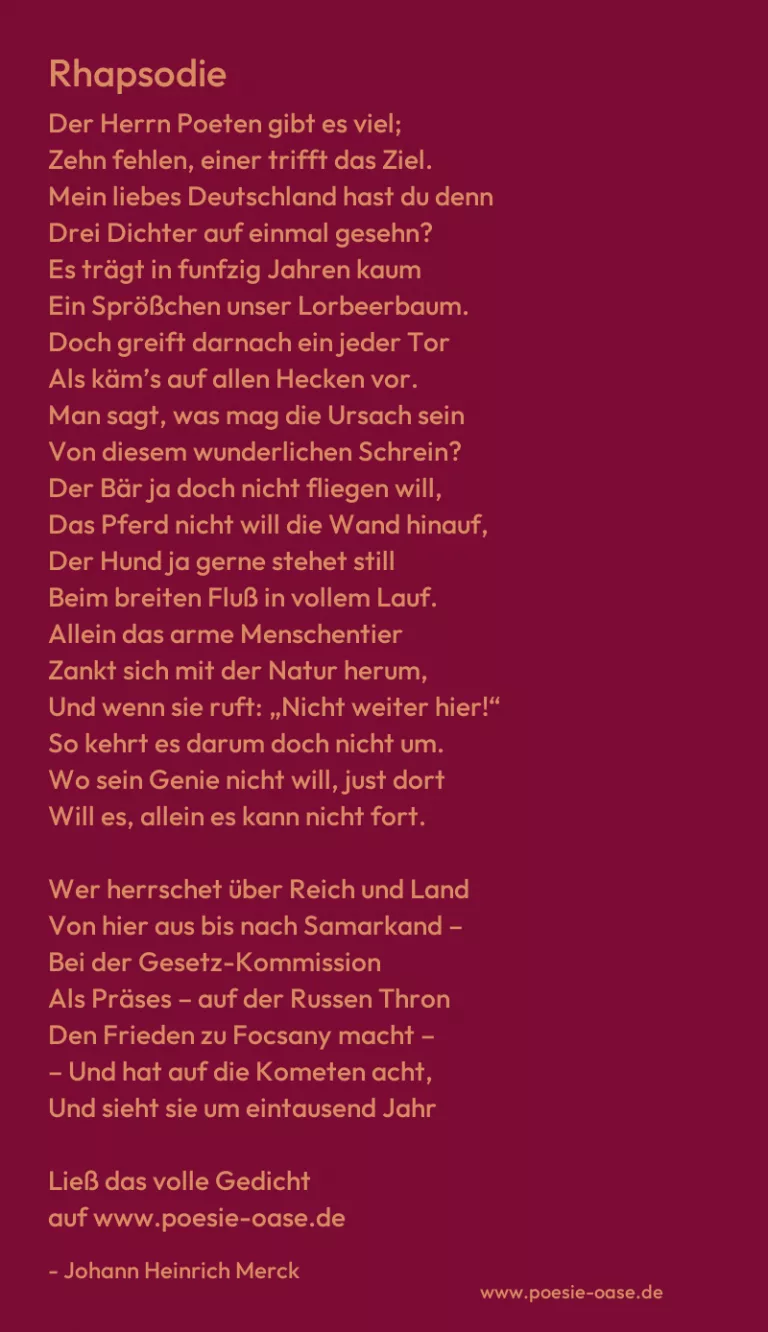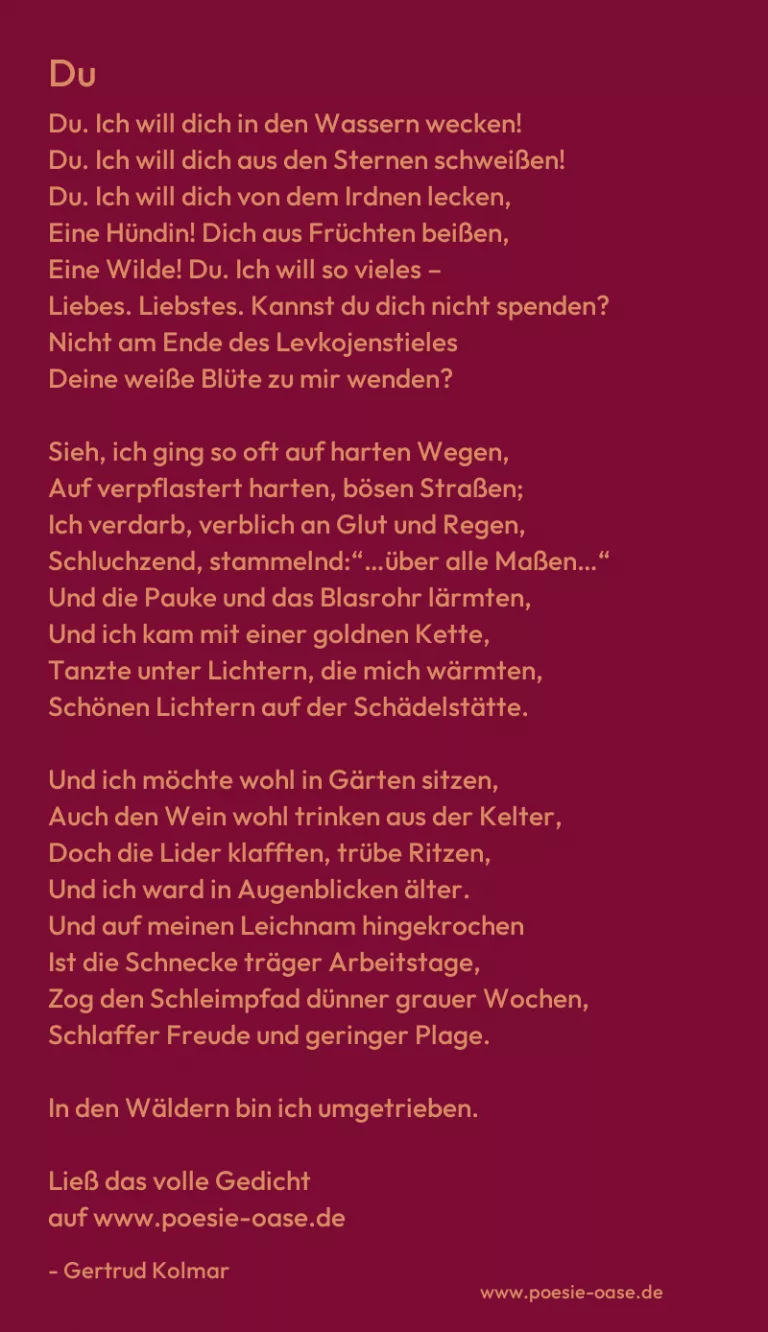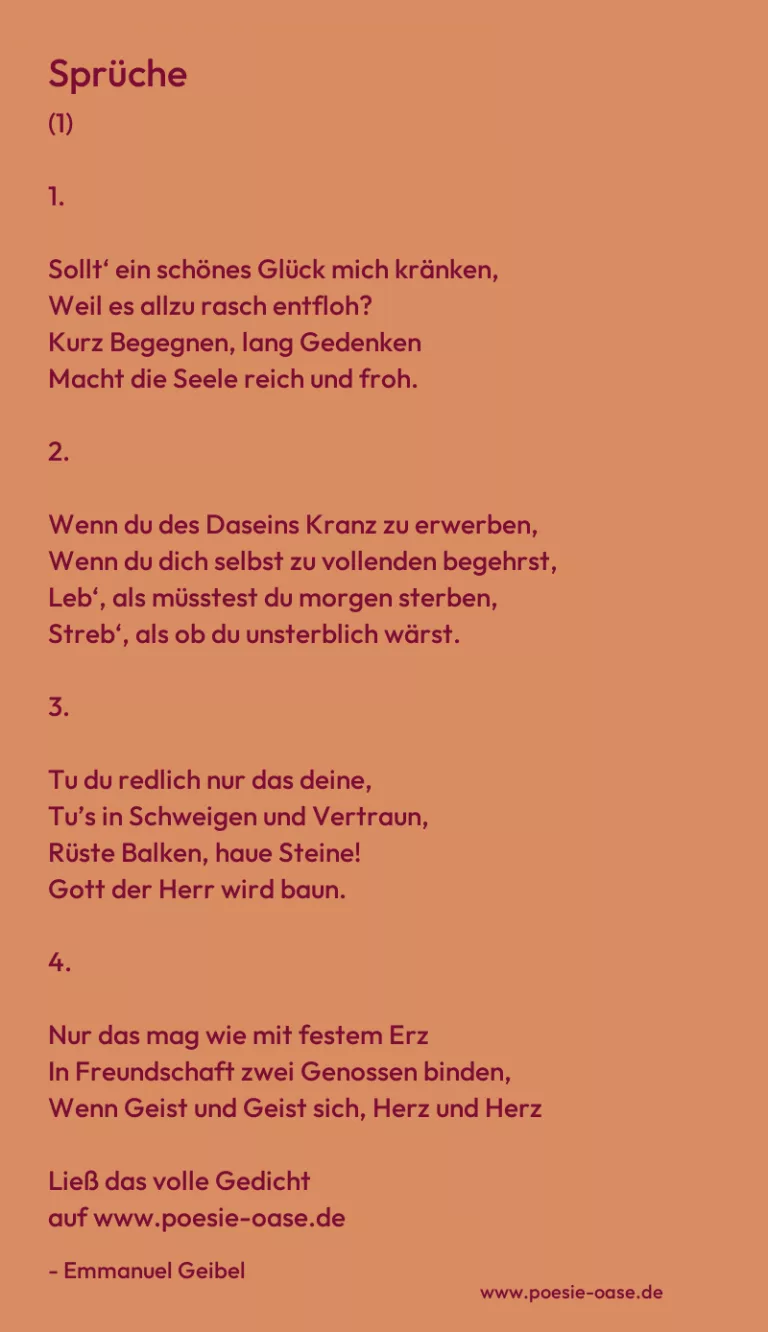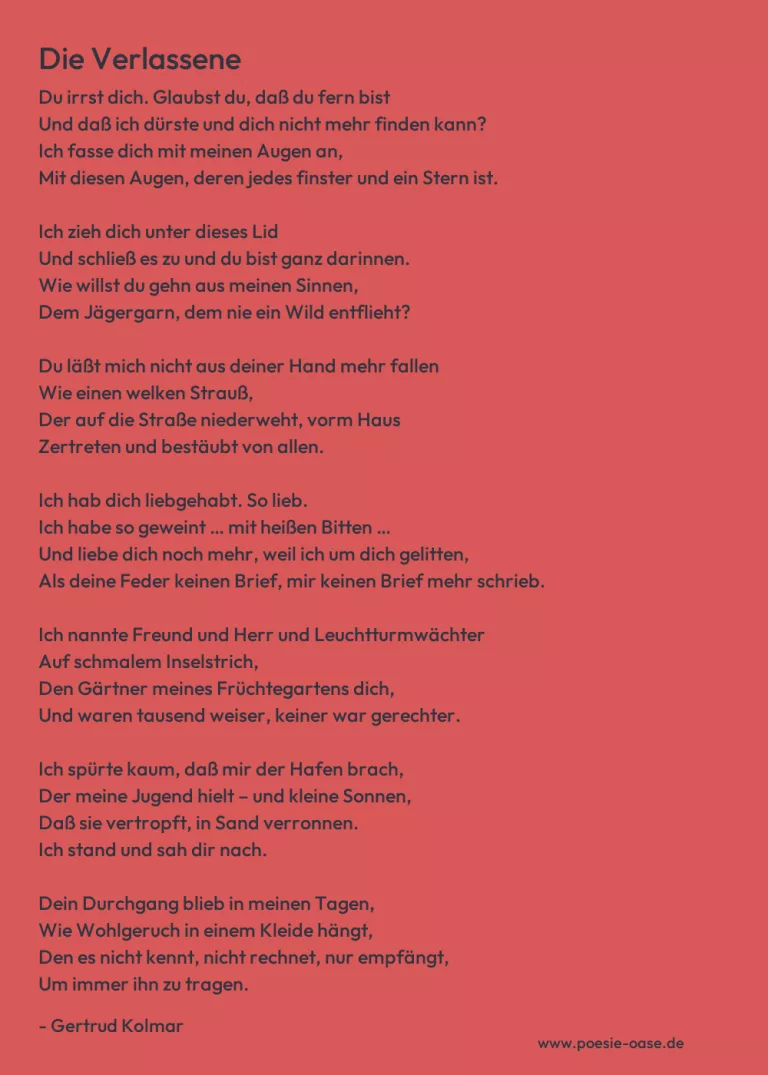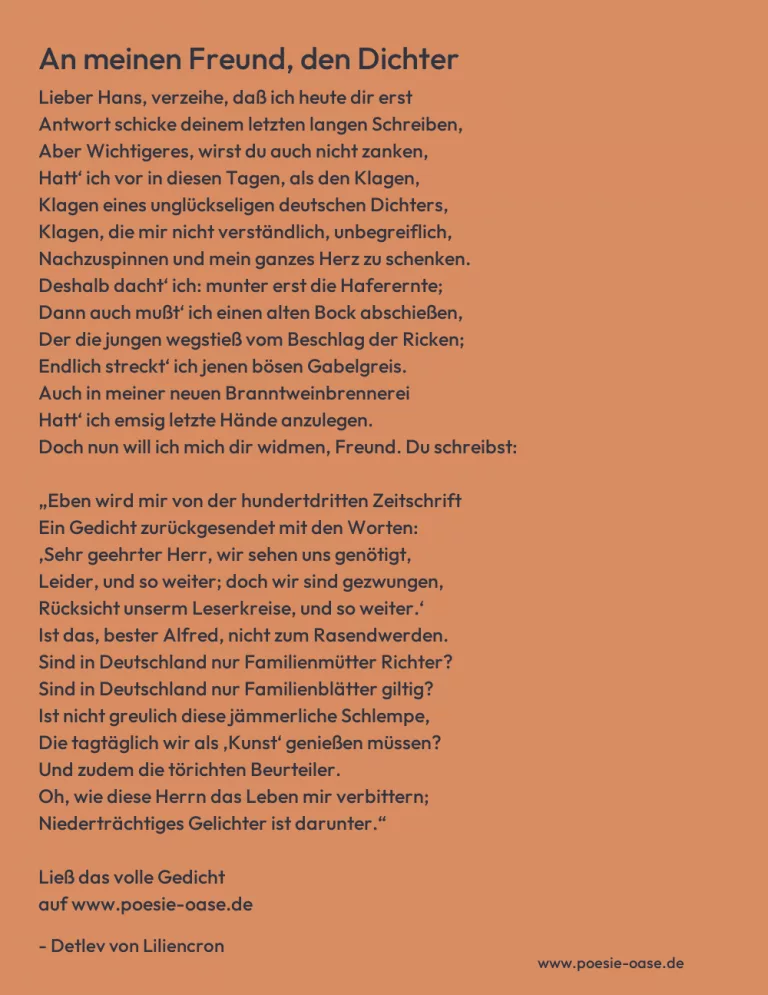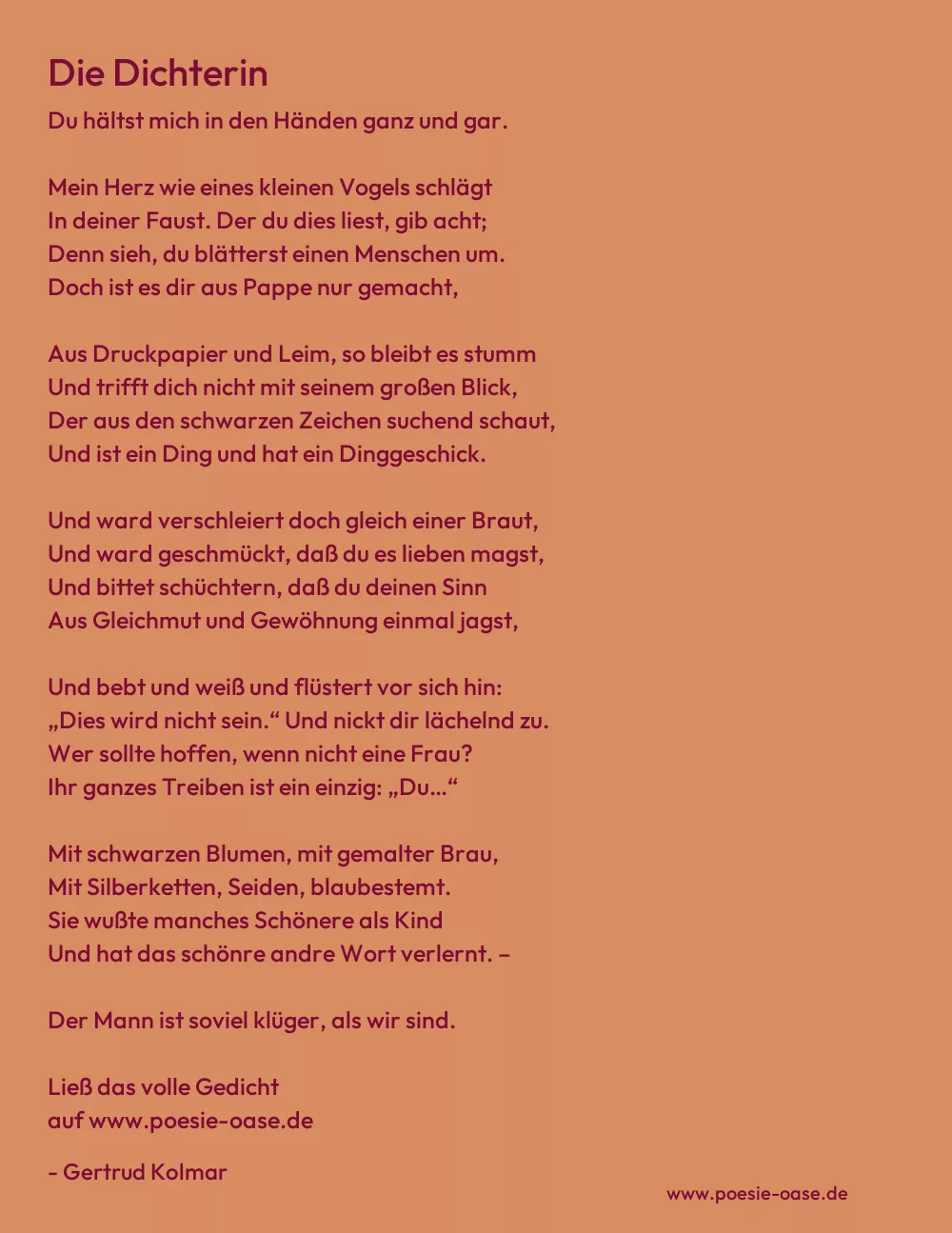Du hältst mich in den Händen ganz und gar.
Mein Herz wie eines kleinen Vogels schlägt
In deiner Faust. Der du dies liest, gib acht;
Denn sieh, du blätterst einen Menschen um.
Doch ist es dir aus Pappe nur gemacht,
Aus Druckpapier und Leim, so bleibt es stumm
Und trifft dich nicht mit seinem großen Blick,
Der aus den schwarzen Zeichen suchend schaut,
Und ist ein Ding und hat ein Dinggeschick.
Und ward verschleiert doch gleich einer Braut,
Und ward geschmückt, daß du es lieben magst,
Und bittet schüchtern, daß du deinen Sinn
Aus Gleichmut und Gewöhnung einmal jagst,
Und bebt und weiß und flüstert vor sich hin:
„Dies wird nicht sein.“ Und nickt dir lächelnd zu.
Wer sollte hoffen, wenn nicht eine Frau?
Ihr ganzes Treiben ist ein einzig: „Du…“
Mit schwarzen Blumen, mit gemalter Brau,
Mit Silberketten, Seiden, blaubestemt.
Sie wußte manches Schönere als Kind
Und hat das schönre andre Wort verlernt. –
Der Mann ist soviel klüger, als wir sind.
In seinem Reden unterhält er sich
Mit Tod und Frühling, Eisenwerk und Zeit;
Ich sage: „Du…“ und immer: „Du und ich.“
Und dieses Buch ist eines Mädchens Kleid,
Das reich und rot sein mag und ärmlich fahl,
Und immer unter liebem Finger nur
Zerknittern dulden will, Befleckung, Mal.
So steh ich, weisend, was mir widerfuhr;
Denn harte Lauge hat es wohl gebleicht,
Doch keine hat es gänzlich ausgespült.
So ruf ich dich. Mein Ruf ist dünn und leicht.
Du hörst, was spricht. Vernimmst du auch, was fühlt?