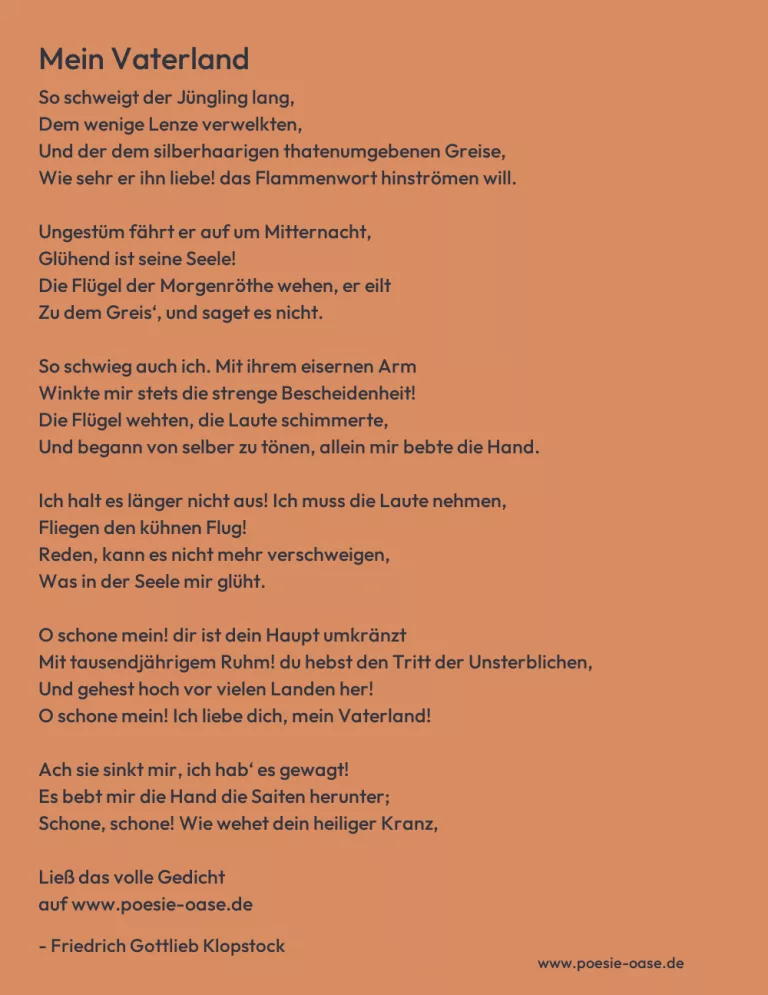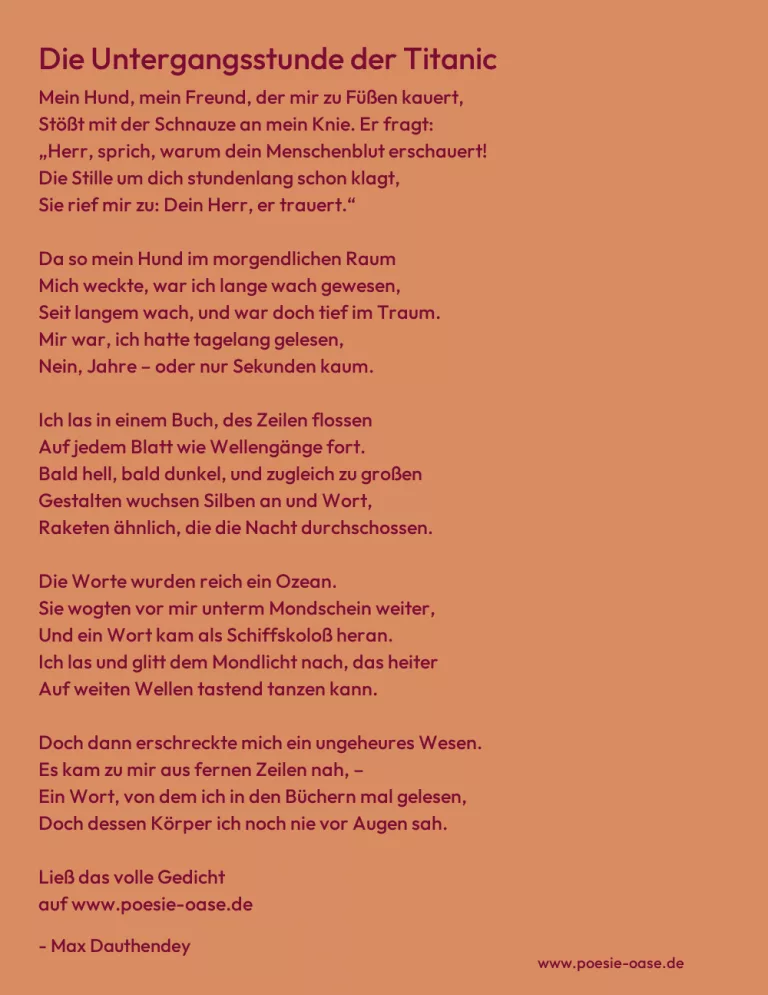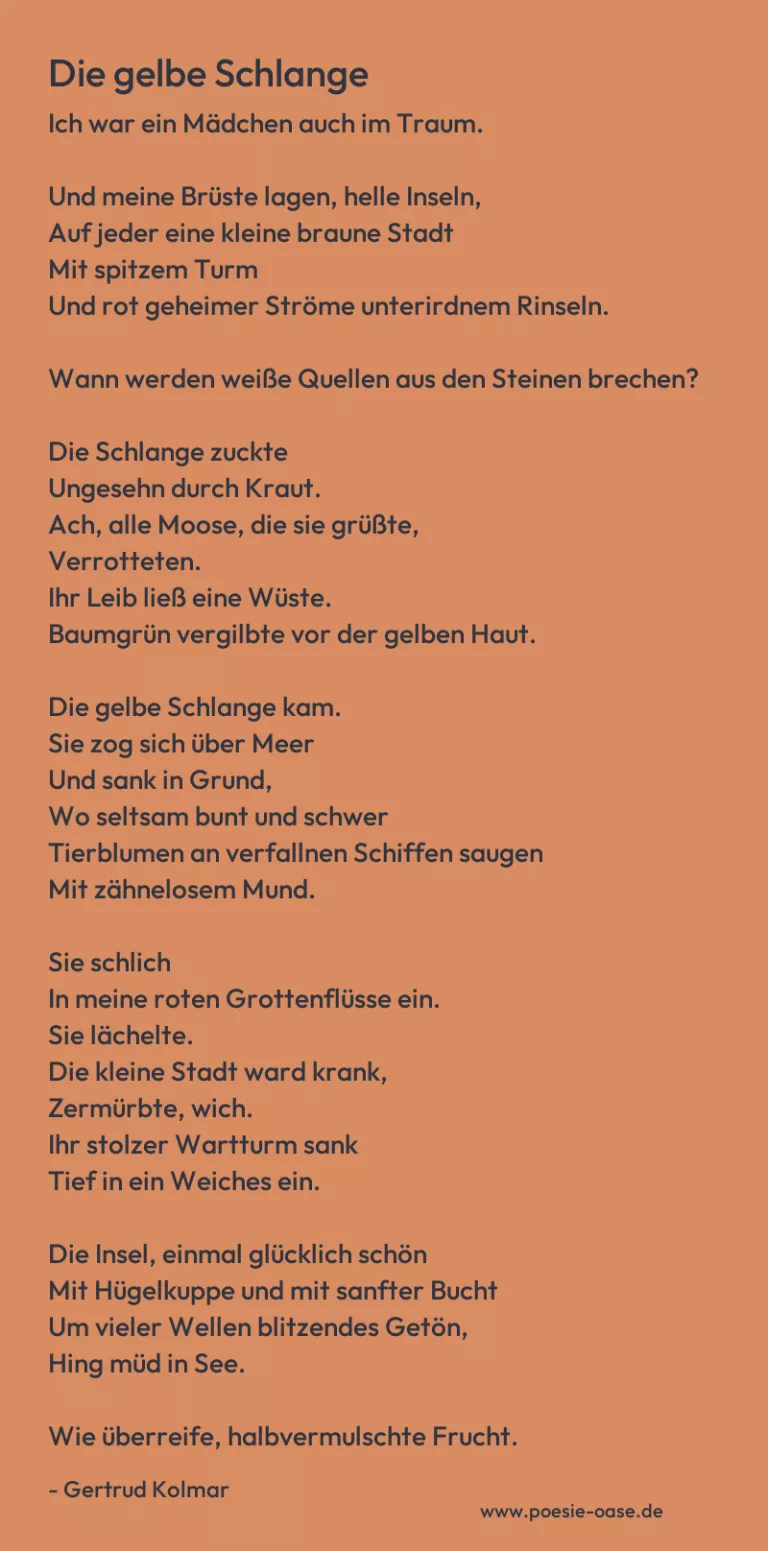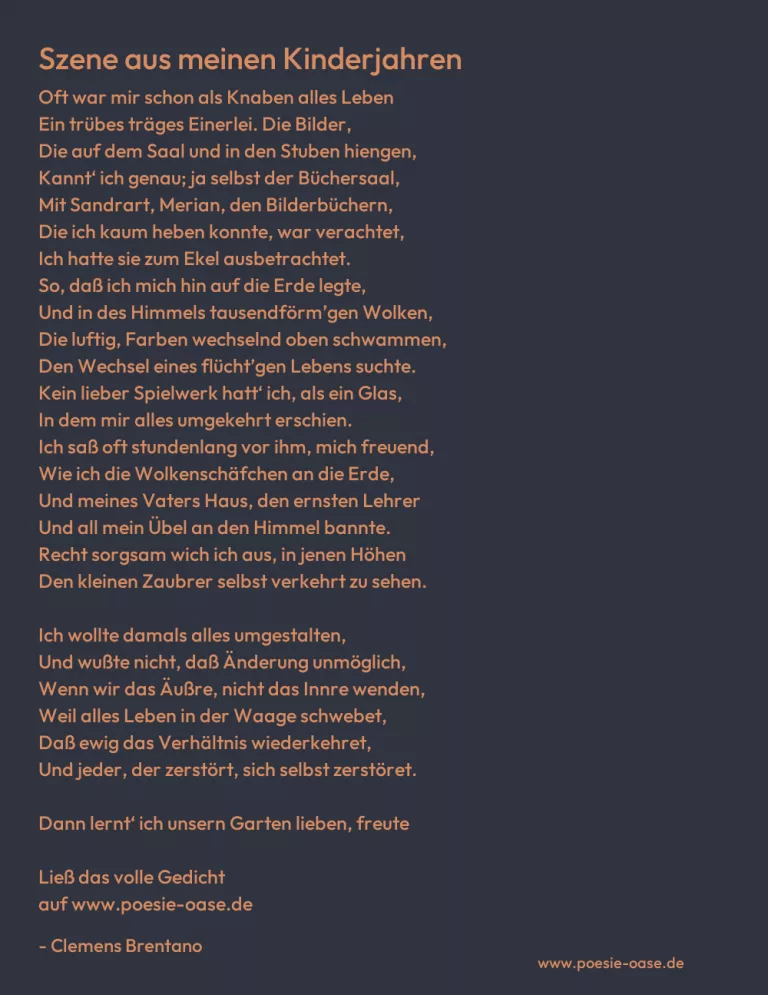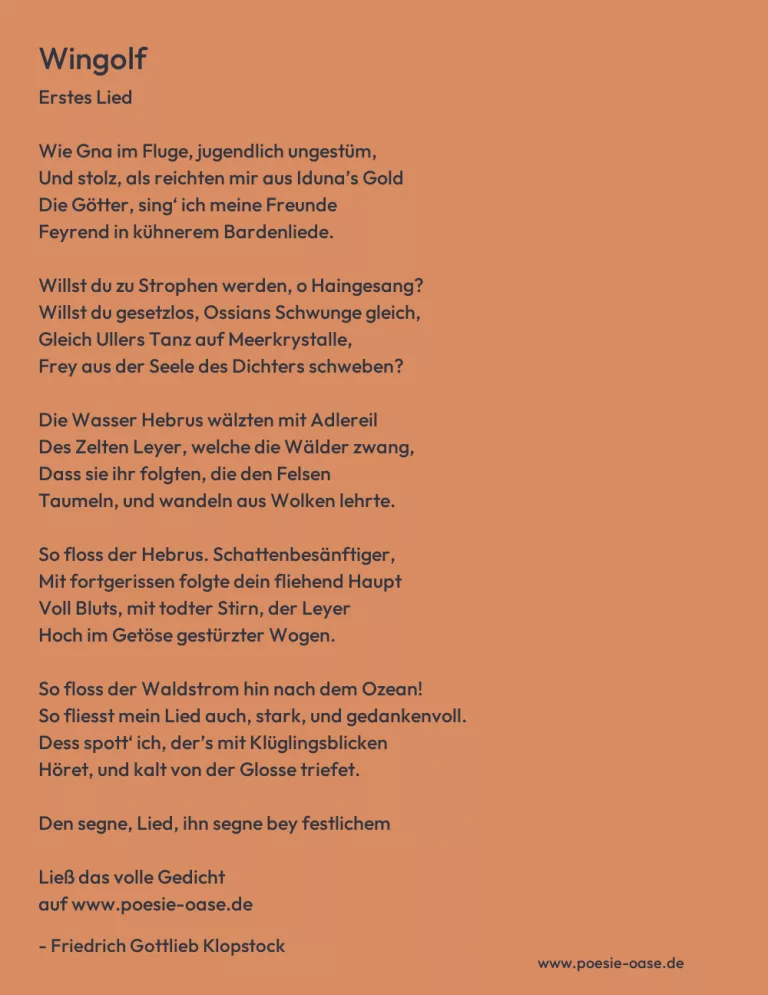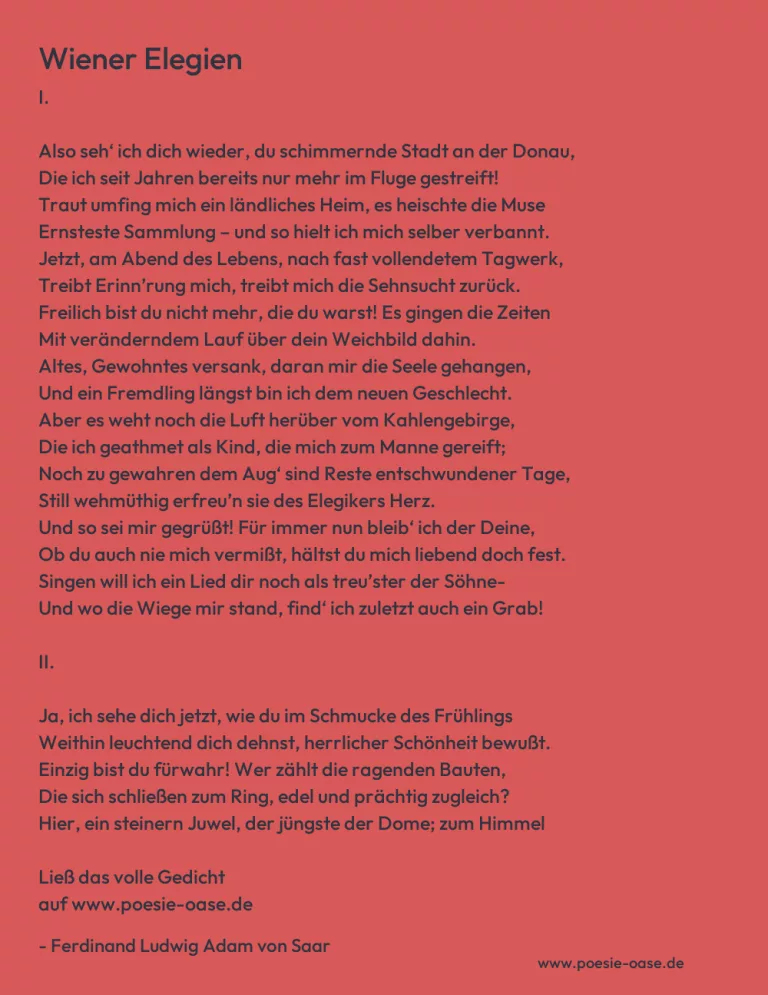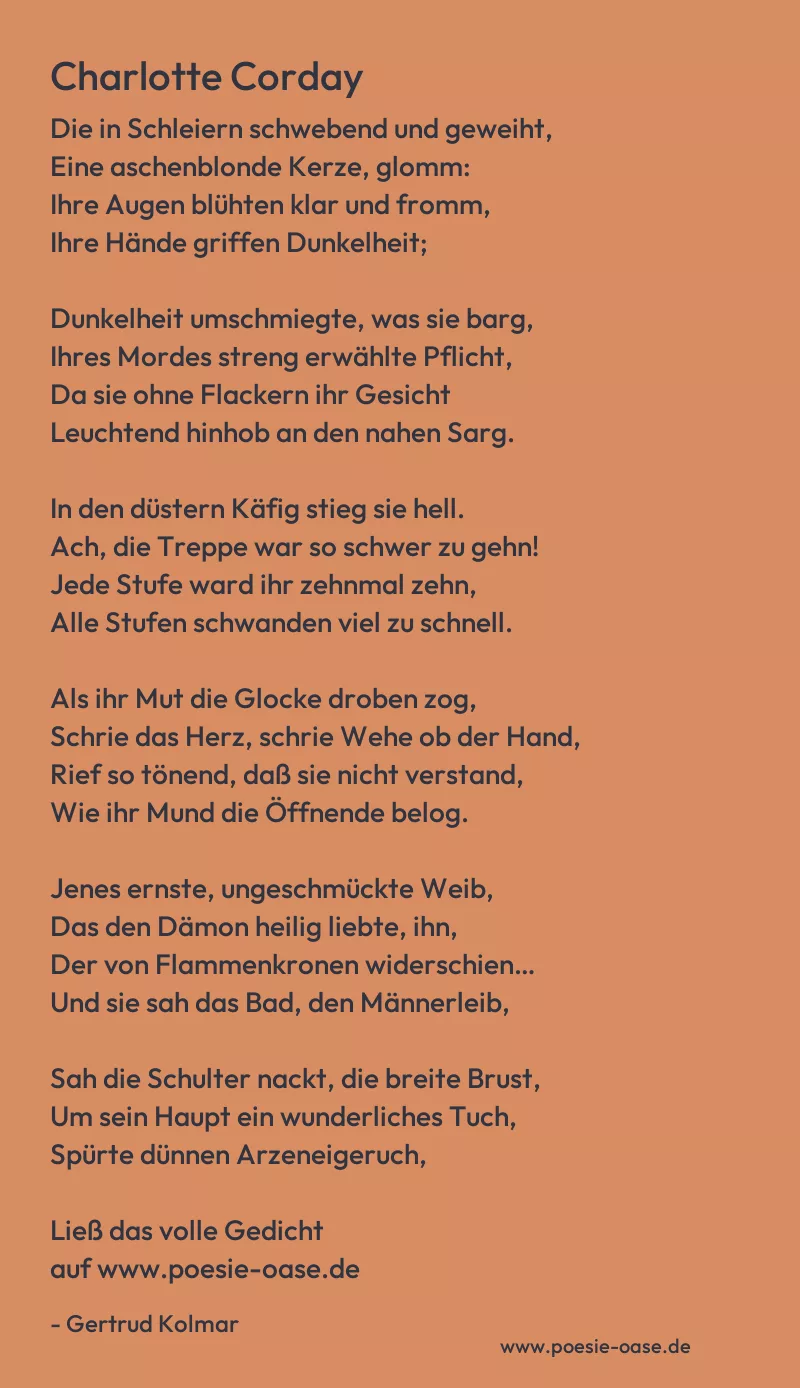Die in Schleiern schwebend und geweiht,
Eine aschenblonde Kerze, glomm:
Ihre Augen blühten klar und fromm,
Ihre Hände griffen Dunkelheit;
Dunkelheit umschmiegte, was sie barg,
Ihres Mordes streng erwählte Pflicht,
Da sie ohne Flackern ihr Gesicht
Leuchtend hinhob an den nahen Sarg.
In den düstern Käfig stieg sie hell.
Ach, die Treppe war so schwer zu gehn!
Jede Stufe ward ihr zehnmal zehn,
Alle Stufen schwanden viel zu schnell.
Als ihr Mut die Glocke droben zog,
Schrie das Herz, schrie Wehe ob der Hand,
Rief so tönend, daß sie nicht verstand,
Wie ihr Mund die Öffnende belog.
Jenes ernste, ungeschmückte Weib,
Das den Dämon heilig liebte, ihn,
Der von Flammenkronen widerschien…
Und sie sah das Bad, den Männerleib,
Sah die Schulter nackt, die breite Brust,
Um sein Haupt ein wunderliches Tuch,
Spürte dünnen Arzeneigeruch,
Fand in falbem armutskranken Dust
Linnen, Wanne, Brett und Tintenfaß,
Federkiel, der winkte. Und sie kam,
Warf vom Lid die Röte ihrer Scham,
Riß ums Antlitz blendend ihren Haß,
Saß so stark und zitternd zu Gericht,
Bot den Zettel, den er fiebrig griff,
Wiederholte schweigend dieses: „Triff!“,
Fest sich fassend schon. Sie wußte nicht,
Daß er groß war. Aber sie war rein,
Stahl, der seine Feuerpranke brach.
Sie erglänzte, zuckte auch und stach
Als ein Messer blitzend in ihn ein.
Werkzeug, gleich umklammert und zerschellt;
Heldin, die dem Glauben starb. Er ruht.
Aus der Wunde fließt sein Herz, sein Blut
Über Frankreich strömend in die Welt.