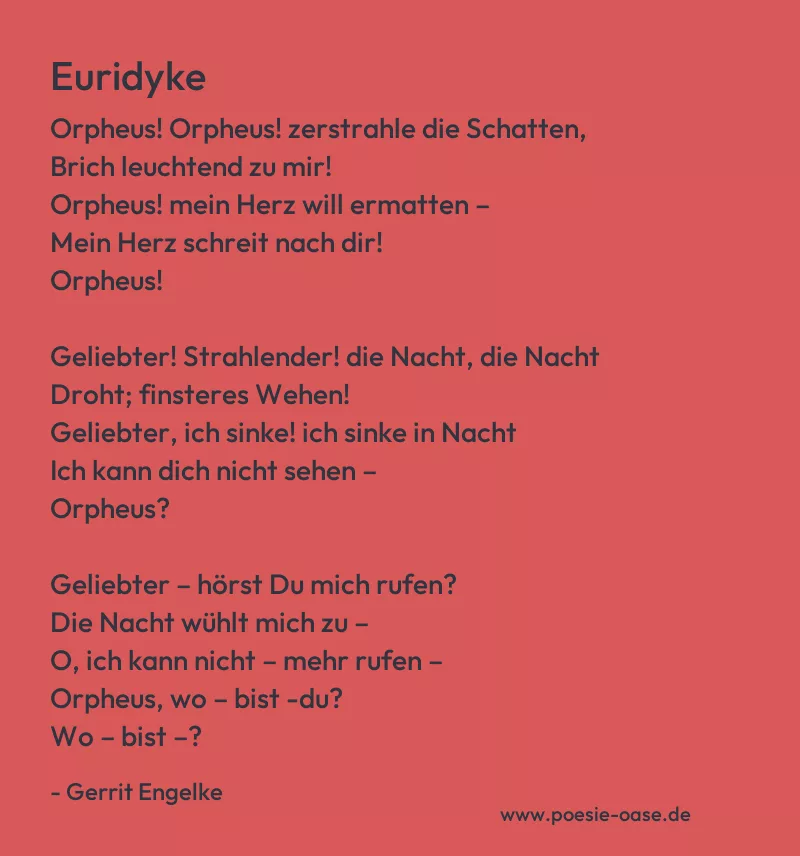Angst, Antike, Gemeinfrei, Helden & Prinzessinnen, Herzschmerz, Himmel & Wolken, Hoffnung, Legenden, Sagen, Sehnsucht, Vergänglichkeit, Wagnisse
Euridyke
Orpheus! Orpheus! zerstrahle die Schatten,
Brich leuchtend zu mir!
Orpheus! mein Herz will ermatten –
Mein Herz schreit nach dir!
Orpheus!
Geliebter! Strahlender! die Nacht, die Nacht
Droht; finsteres Wehen!
Geliebter, ich sinke! ich sinke in Nacht
Ich kann dich nicht sehen –
Orpheus?
Geliebter – hörst Du mich rufen?
Die Nacht wühlt mich zu –
O, ich kann nicht – mehr rufen –
Orpheus, wo – bist -du?
Wo – bist –?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
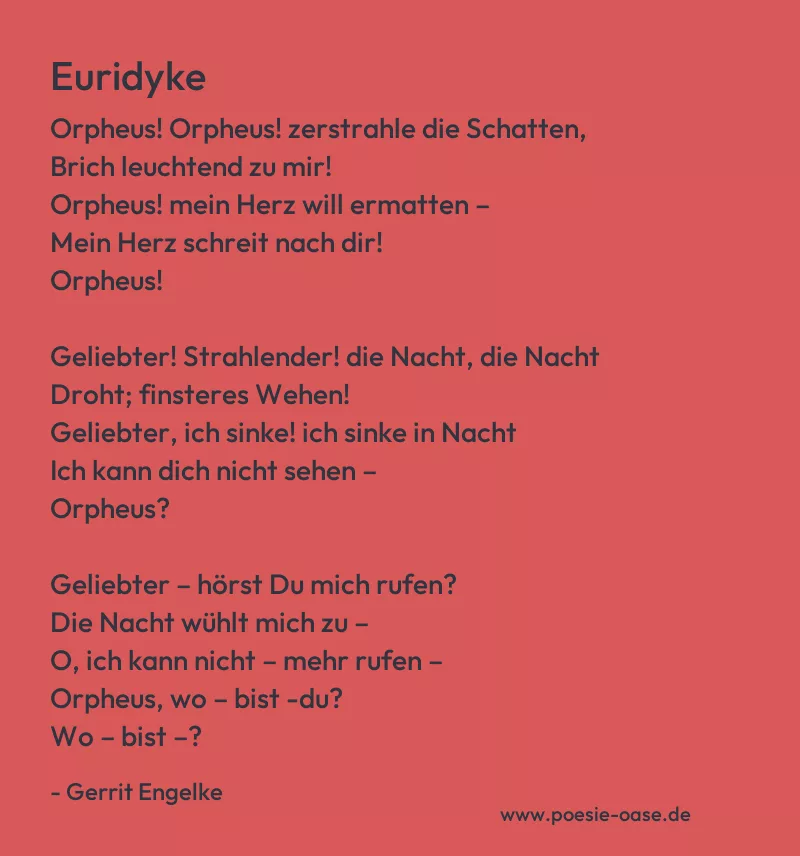
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Eurydike“ von Gerrit Engelke greift den bekannten Mythos von Orpheus und Eurydike auf und schildert aus der Perspektive Eurydikes ihre verzweifelte Sehnsucht nach ihrem Geliebten. Die wiederholten Rufe nach Orpheus verstärken die Dringlichkeit ihres Flehens und machen die zunehmende Verzweiflung spürbar. Eurydike kämpft gegen das drohende Vergessen und die Dunkelheit des Todes an, doch ihr Ruf verhallt ungehört.
Besonders auffällig ist die Sprache des Gedichts, die zwischen ekstatischer Hoffnung und tiefer Resignation schwankt. In der ersten Strophe überwiegt noch der Drang zum Licht, zur Rettung, während sich in der zweiten Strophe bereits die drohende Nacht ankündigt. Die Wiederholung von „ich sinke“ betont das unausweichliche Verlorengehen Eurydikes, die trotz aller Liebe Orpheus nicht mehr erreichen kann.
Die letzte Strophe zeigt schließlich ihr völliges Verschwinden. Ihre Rufe brechen ab, ihre Worte werden kürzer, fragmentierter – als würde sie langsam in der Dunkelheit verlöschen. Das offene, unvollständige Ende des letzten Verses „Wo – bist –?“ hinterlässt eine bedrückende Leere und symbolisiert das endgültige Entgleiten Eurydikes ins Vergessen. Engelke gelingt es mit reduzierten, fast musikalischen Mitteln, die Tragik und Unabwendbarkeit dieses Schicksals intensiv erlebbar zu machen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.