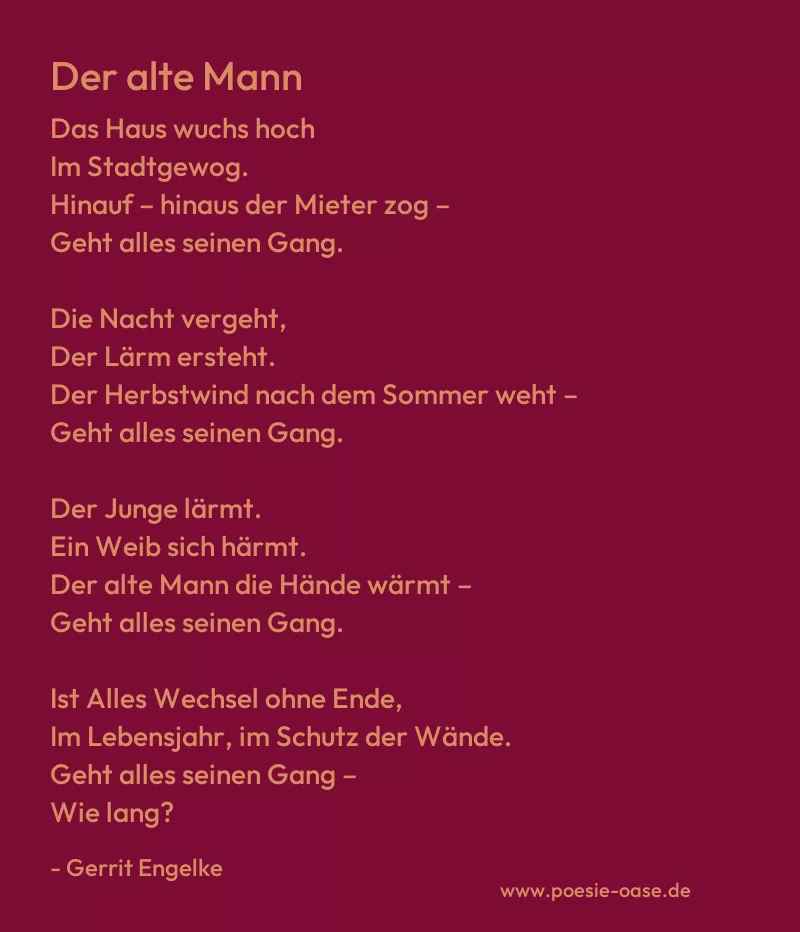Der alte Mann
Das Haus wuchs hoch
Im Stadtgewog.
Hinauf – hinaus der Mieter zog –
Geht alles seinen Gang.
Die Nacht vergeht,
Der Lärm ersteht.
Der Herbstwind nach dem Sommer weht –
Geht alles seinen Gang.
Der Junge lärmt.
Ein Weib sich härmt.
Der alte Mann die Hände wärmt –
Geht alles seinen Gang.
Ist Alles Wechsel ohne Ende,
Im Lebensjahr, im Schutz der Wände.
Geht alles seinen Gang –
Wie lang?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
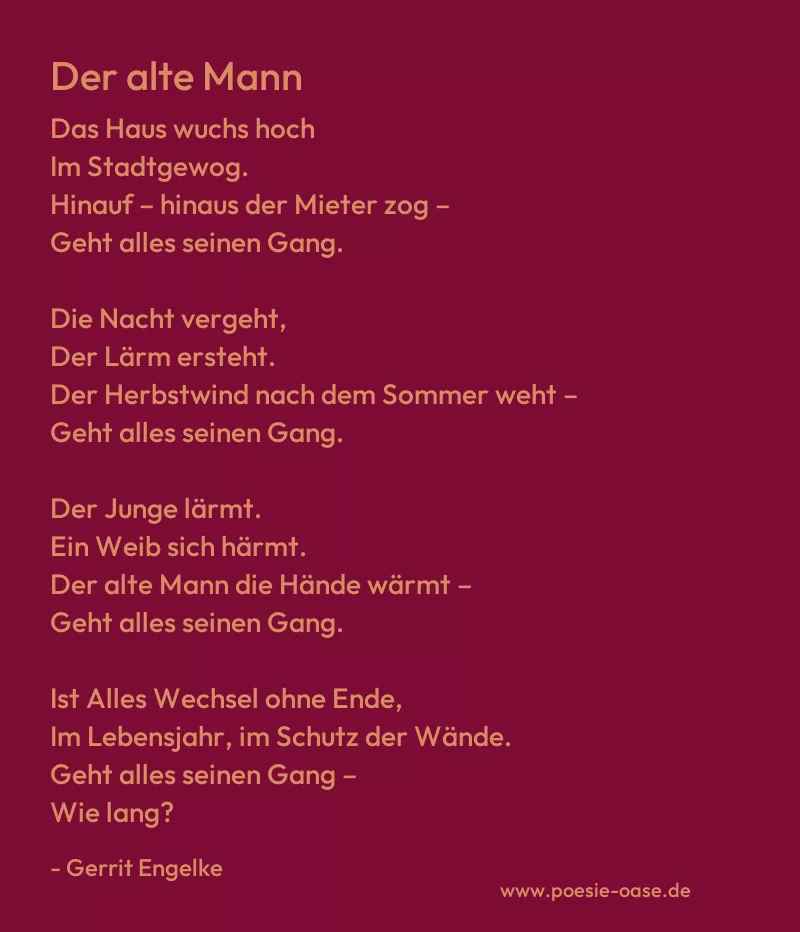
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der alte Mann“ von Gerrit Engelke setzt sich mit der Vergänglichkeit und dem unaufhaltsamen Lauf des Lebens auseinander. Die wiederkehrende Zeile „Geht alles seinen Gang“ unterstreicht die Unvermeidlichkeit des Wandels, sei es im städtischen Treiben, im Wechsel der Jahreszeiten oder im menschlichen Alltag. Das Haus, das wächst, und der Mieter, der auszieht, stehen symbolisch für das beständige Kommen und Gehen des Lebens.
Die zweite Strophe verstärkt dieses Motiv: Die Nacht vergeht, der Lärm kehrt zurück, und die Jahreszeiten folgen ihrem natürlichen Rhythmus. Der Herbstwind, der auf den Sommer folgt, verweist auf den Übergang von Jugend zu Alter, auf das Fortschreiten der Zeit, das nicht aufzuhalten ist. Die Welt verändert sich, doch sie folgt dabei festen Mustern, die das Individuum nur bedingt beeinflussen kann.
In der dritten Strophe treten konkrete Menschen in den Fokus: Ein Kind lärmt, eine Frau sorgt sich, und der alte Mann wärmt seine Hände – drei unterschiedliche Lebensphasen, die exemplarisch für den Zyklus des Daseins stehen. Die abschließende Frage „Wie lang?“ bricht jedoch mit der zuvor festgelegten Gewissheit. Sie verweist auf die Endlichkeit des menschlichen Lebens und die unausweichliche Unsicherheit über dessen Dauer. Damit endet das Gedicht mit einer nachdenklichen Note, die die Routine des Alltags mit der existenziellen Frage nach der eigenen Vergänglichkeit konfrontiert.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.