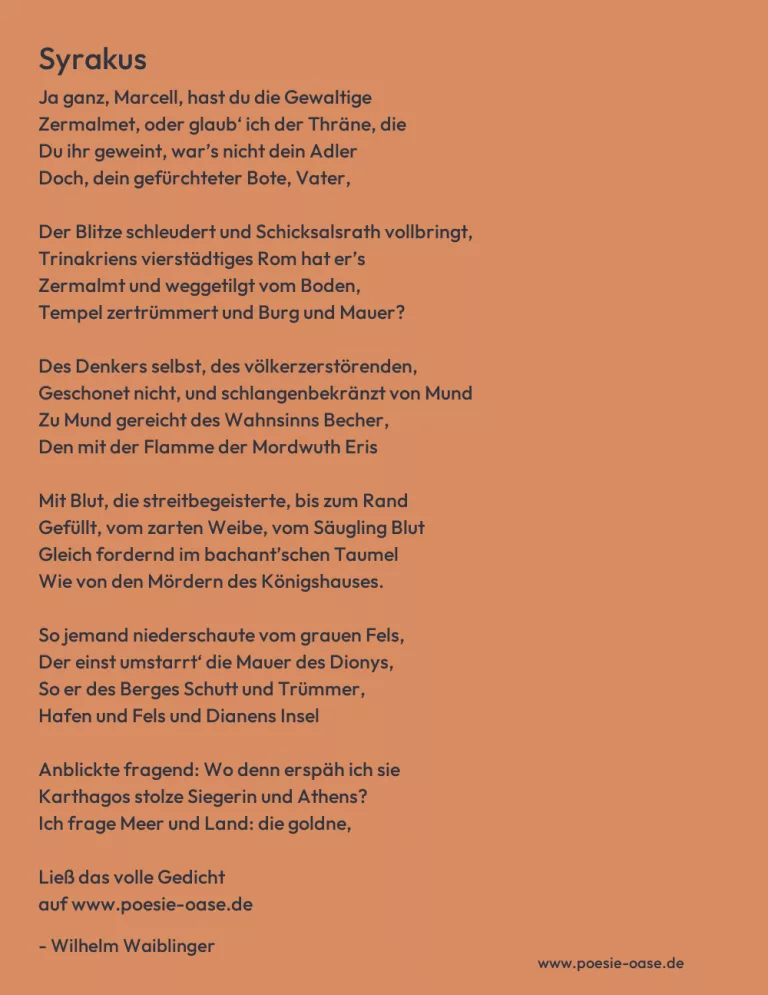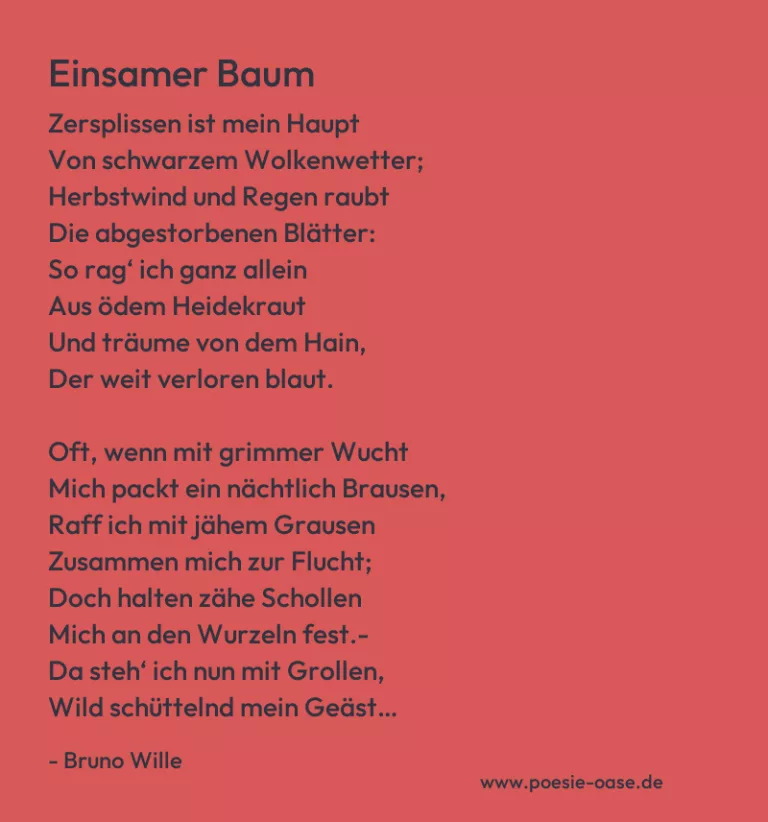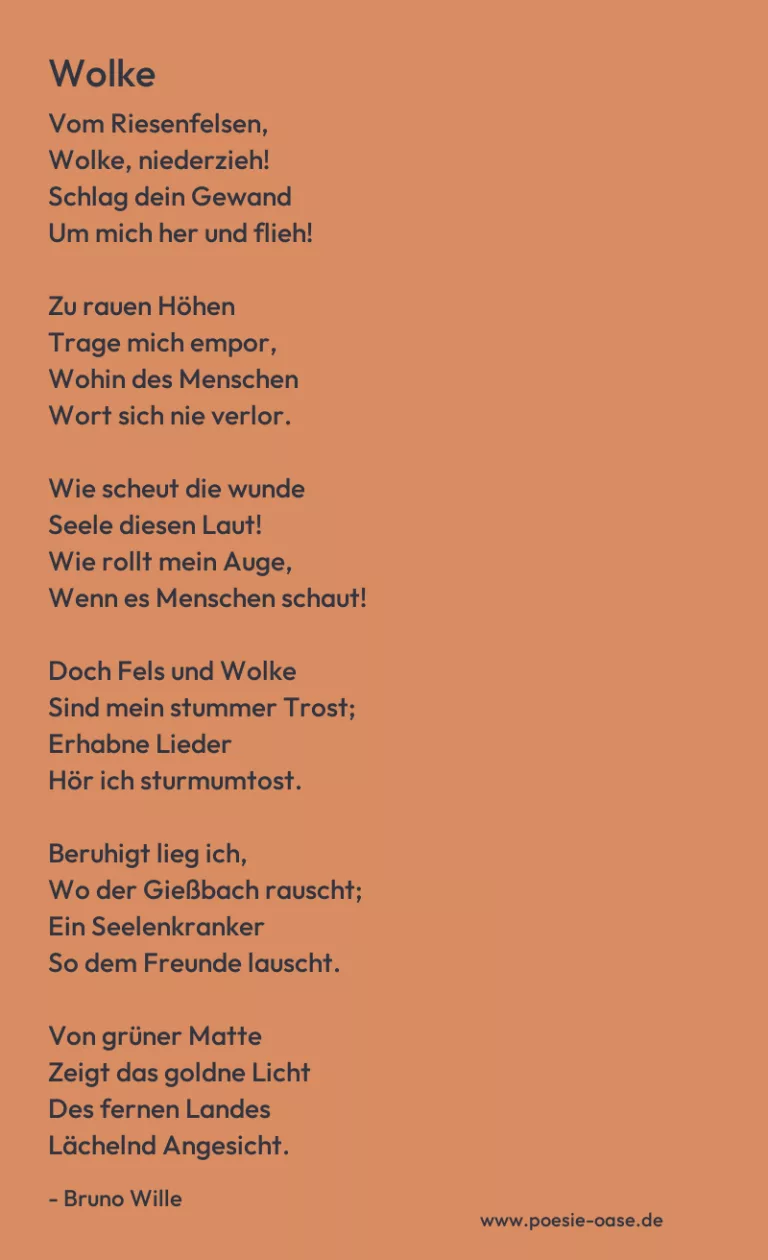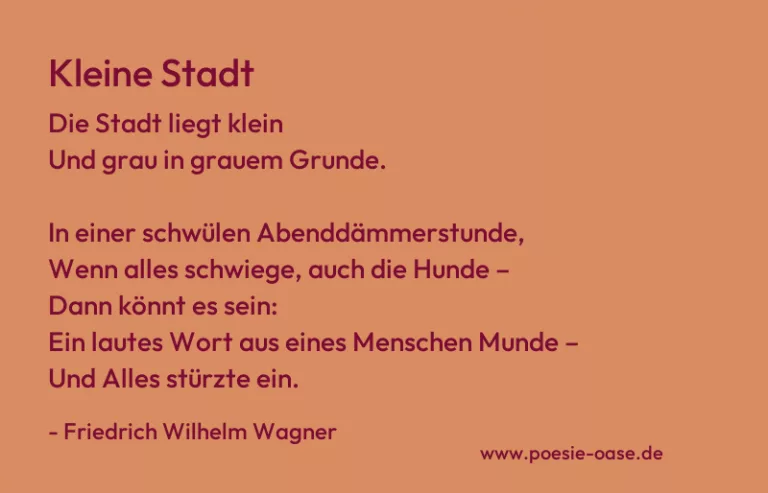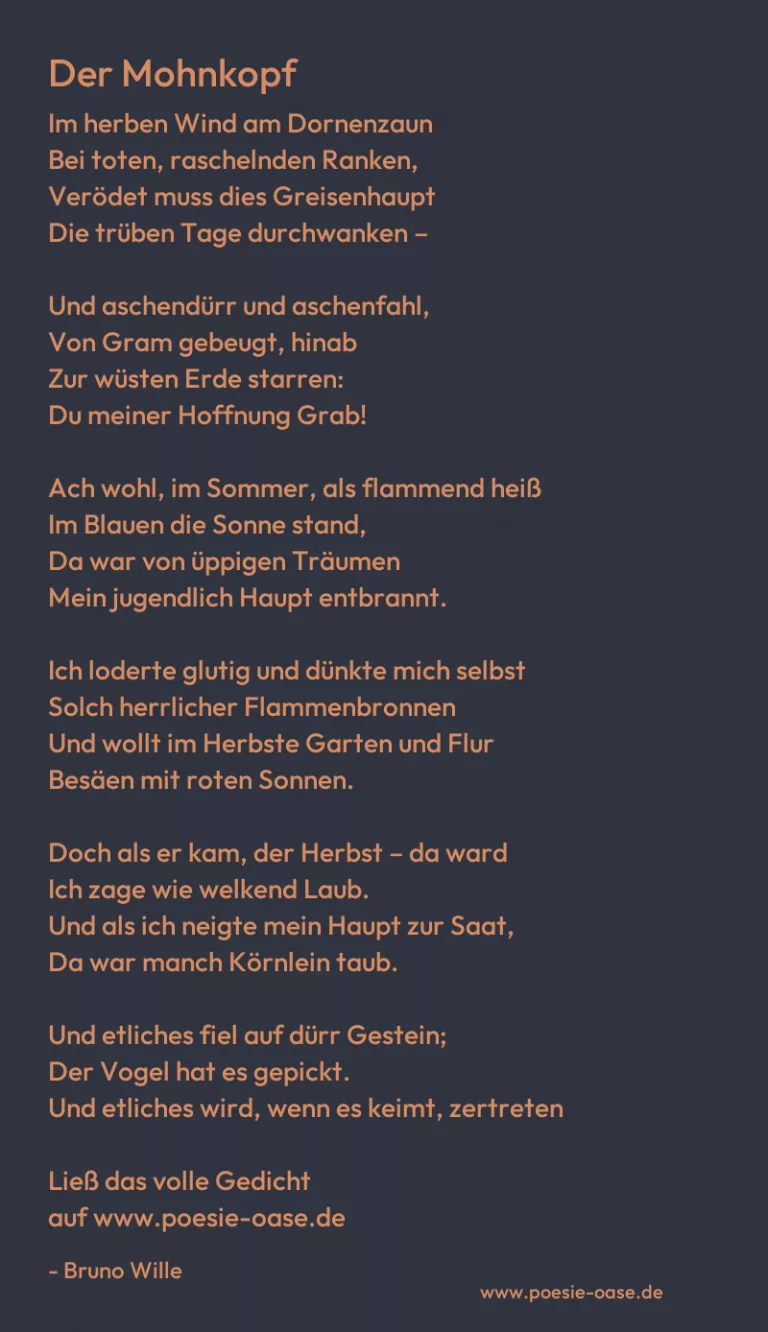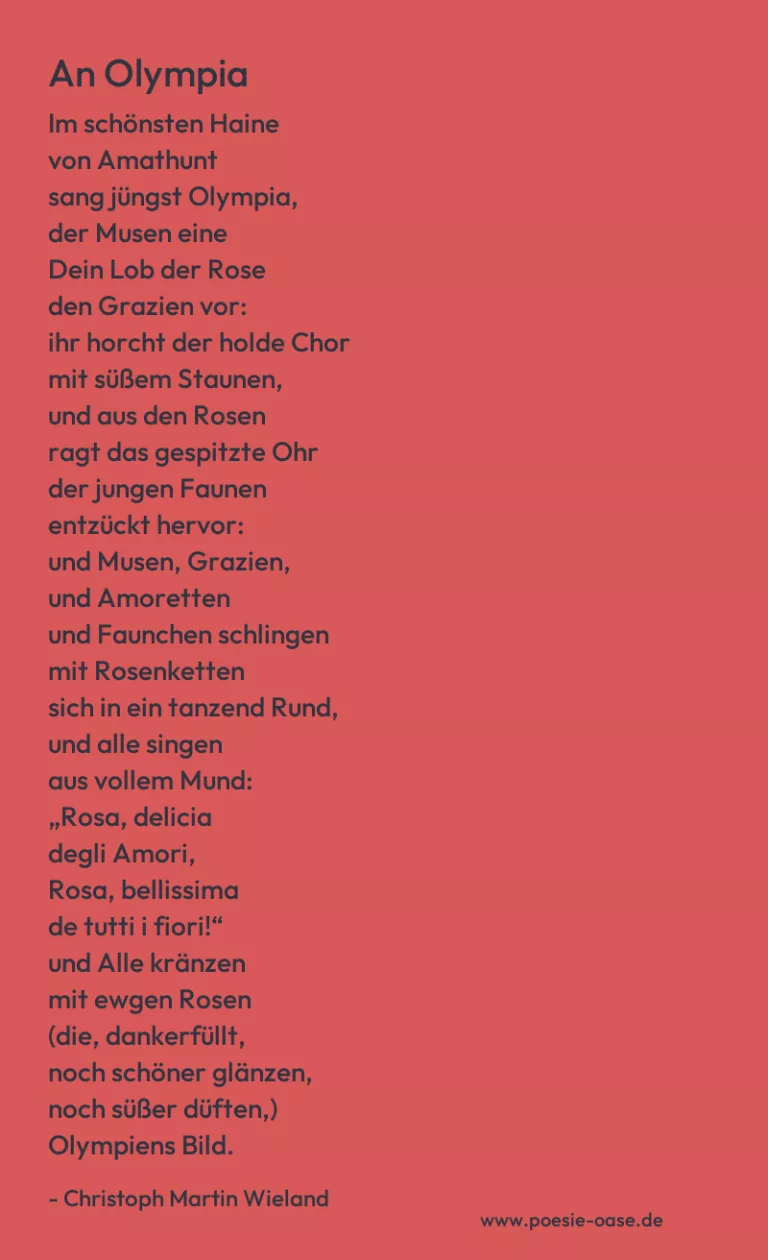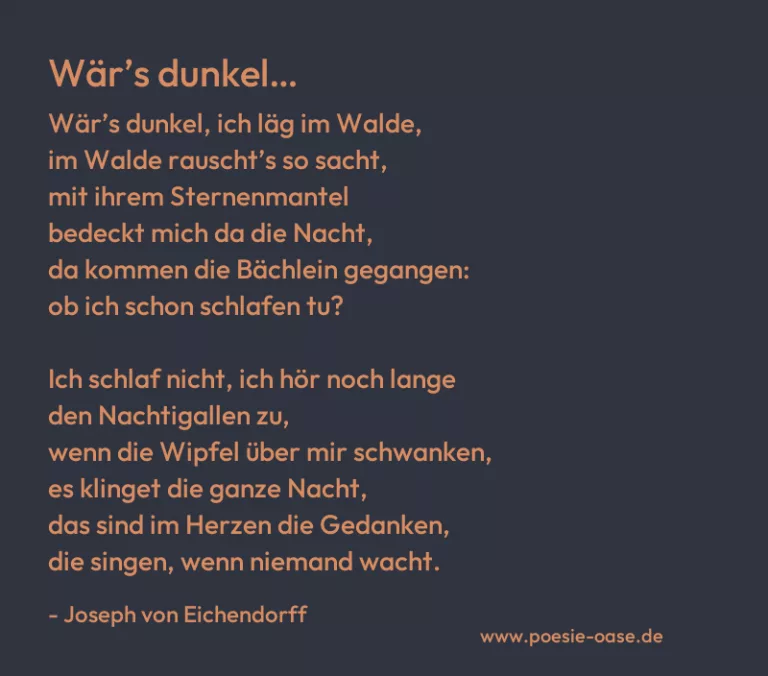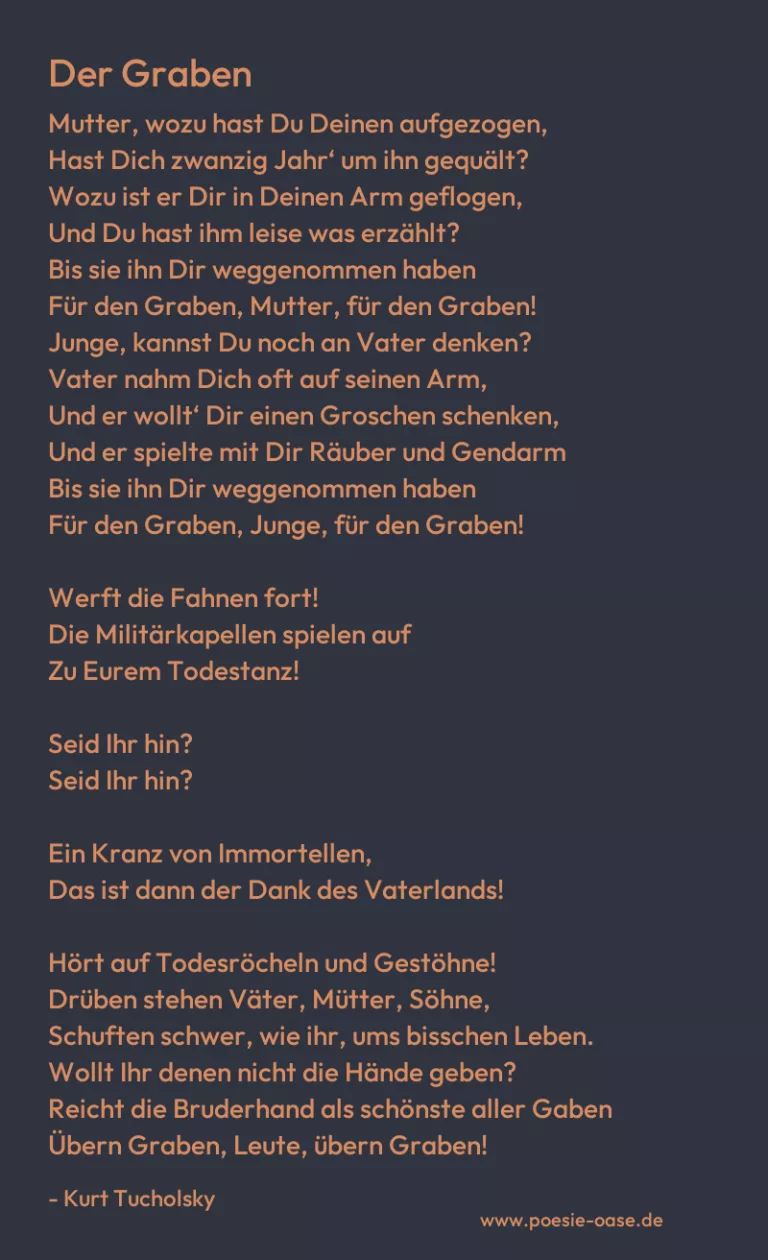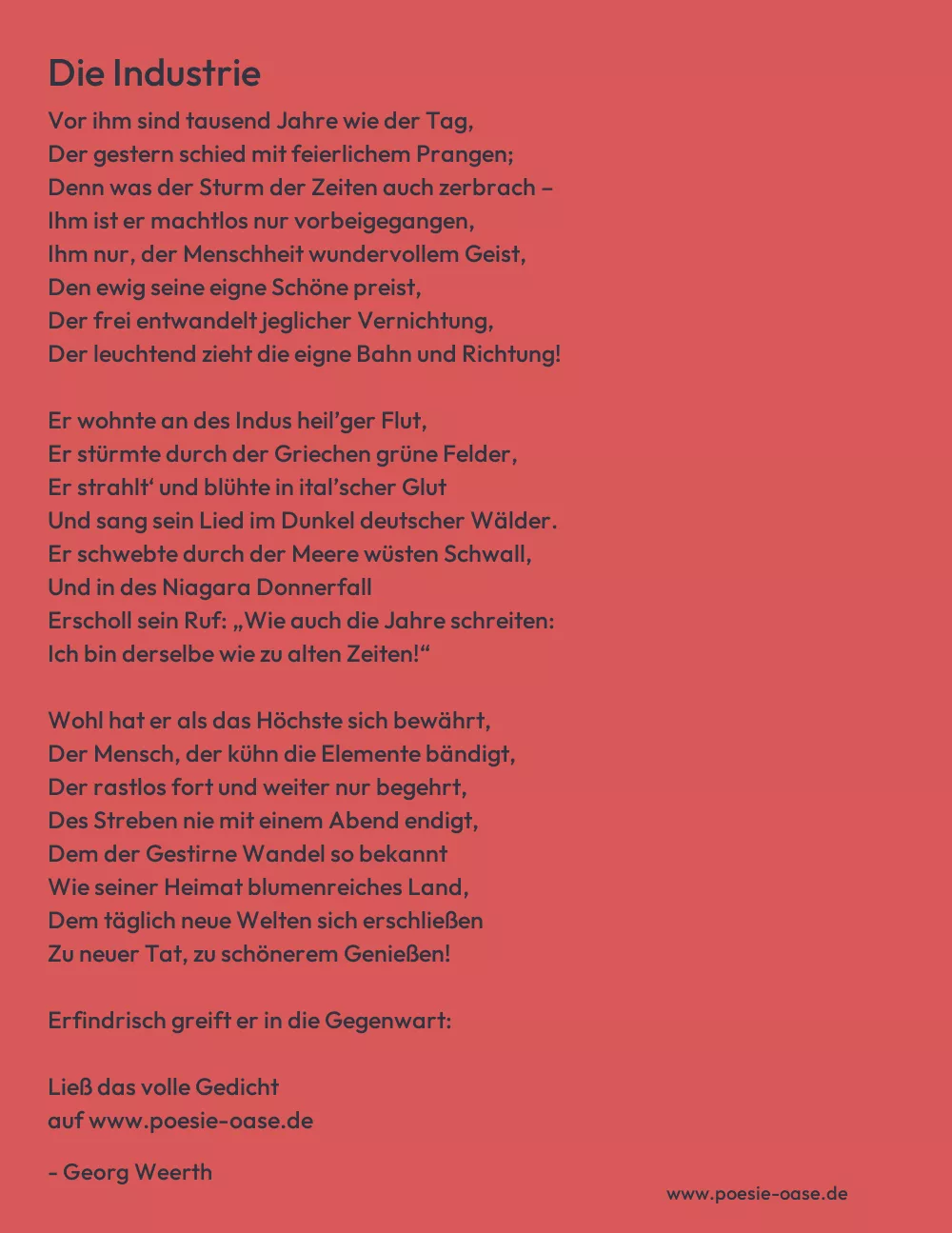Vor ihm sind tausend Jahre wie der Tag,
Der gestern schied mit feierlichem Prangen;
Denn was der Sturm der Zeiten auch zerbrach –
Ihm ist er machtlos nur vorbeigegangen,
Ihm nur, der Menschheit wundervollem Geist,
Den ewig seine eigne Schöne preist,
Der frei entwandelt jeglicher Vernichtung,
Der leuchtend zieht die eigne Bahn und Richtung!
Er wohnte an des Indus heil’ger Flut,
Er stürmte durch der Griechen grüne Felder,
Er strahlt‘ und blühte in ital’scher Glut
Und sang sein Lied im Dunkel deutscher Wälder.
Er schwebte durch der Meere wüsten Schwall,
Und in des Niagara Donnerfall
Erscholl sein Ruf: „Wie auch die Jahre schreiten:
Ich bin derselbe wie zu alten Zeiten!“
Wohl hat er als das Höchste sich bewährt,
Der Mensch, der kühn die Elemente bändigt,
Der rastlos fort und weiter nur begehrt,
Des Streben nie mit einem Abend endigt,
Dem der Gestirne Wandel so bekannt
Wie seiner Heimat blumenreiches Land,
Dem täglich neue Welten sich erschließen
Zu neuer Tat, zu schönerem Genießen!
Erfindrisch greift er in die Gegenwart:
Da keimt es auf zu schimmernder Gestaltung!
Was ein Jahrhundert ahnungsvoll erharrt,
Es ward, es ist in herrlicher Entfaltung! –
O Toren, die dem Leben ihr entrückt,
Euch stets an alten Wundern nur entzückt:
Die Wunder, so der Gegenwart entsprossen,
Sind groß wie die der Tage, so verflossen! –
Es ging der Mensch durch grüner Wälder Pracht,
Und prüfend wählte er die Riesenfichte;
Er wand das Eisen aus der Berge Schacht
Und trug’s empor zum frohen Sonnenlichte.
Drauf, in der Schiffe flutbespültem Raum,
Fuhr er frohlockend zu dem Küstensaum
Entfernter Völker, transatlant’schem Strande
Die Kunde bringend europä’scher Lande.
Und in der Städte dampf umhülltem Schoß,
Wie rast die Flamme wild aus tausend Essen!
In reinen Formen windet es sich los,
Was ungebildet die Natur besessen. –
O wär’s dem sel’gen Gotte doch erlaubt,
Aufs neu zu heben sein ambrosisch Haupt:
Hephaistos, säh den Dampf die Bahn er wallen,
Dem Menschen staunend, würd er niederfallen!
Nicht braucht’s der Morgenröte Flügel mehr,
Um sich zu betten in den letzten Zonen:
Die eigne Kunst trägt brausend uns einher
Weit durch den großen Garten der Nationen!
Entgegen eilt, was Strom und See getrennt,
Und rings in Millionen Augen brennt
Hell das Bewußtsein, daß die Nacht entschwunden,
Der Mensch den Menschen wieder hat gefunden!
So donnert laut das Ringen unsrer Zeit,
Die Industrie ist Göttin unsren Tagen!
Zwar noch erscheint’s, sie halte starr gefeit
Mit Basiliskenblick der Herzen Schlagen;
Denn düster sitzt sie auf dem finstern Thron,
Und geißelnd treibt zu unerhörter Fron,
Tief auf der Stirn des Unheils grausen Stempel,
Den Armen sie zu ihrem kalten Tempel!
Und Menschen opfernd steht sie wieder da,
Des Irrtums unersättliche Begierde;
Weinend verhüllt sein Haupt der Paria,
Indes der andre strahlt in güldner Zierde:
Doch Tränen fließen jedem großen Krieg,
Es führt die Not nur zu gewisserm Sieg!
Und wer sie schmieden lernte, Schwert und Ketten,
Kann mit dem Schwert aus Ketten sich erretten!
Was er verlieh, des Menschen hehrer Geist,
Nicht Einem – Allen wird es angehören!
Und wie die letzte Kette klirrend reißt
Und wie die letzten Arme sich empören:
Verwandelt steht die dunkle Göttin da –
Beglückt, erfreut ist Alles, was ihr nah!
Der Arbeit Not, die niemand lindern wollte,
Sie war’s, die selbst den Fels beiseite rollte!
Dann ist’s vollbracht! Und in das große Buch,
Das tönend der Geschichte Wunder kündet,
Schreibt man: „Daß jetzt der Mensch sich selbst genug,
Da sich der Mensch am Menschen nur entzündet.“
Frei rauscht der Rede lang gedämpfter Klang,
Frei auf der Erde geht des Menschen Gang!
Und die Natur mit zaubervollem Kusse
Lockt die Lebend’gen fröhlich zum Genusse!